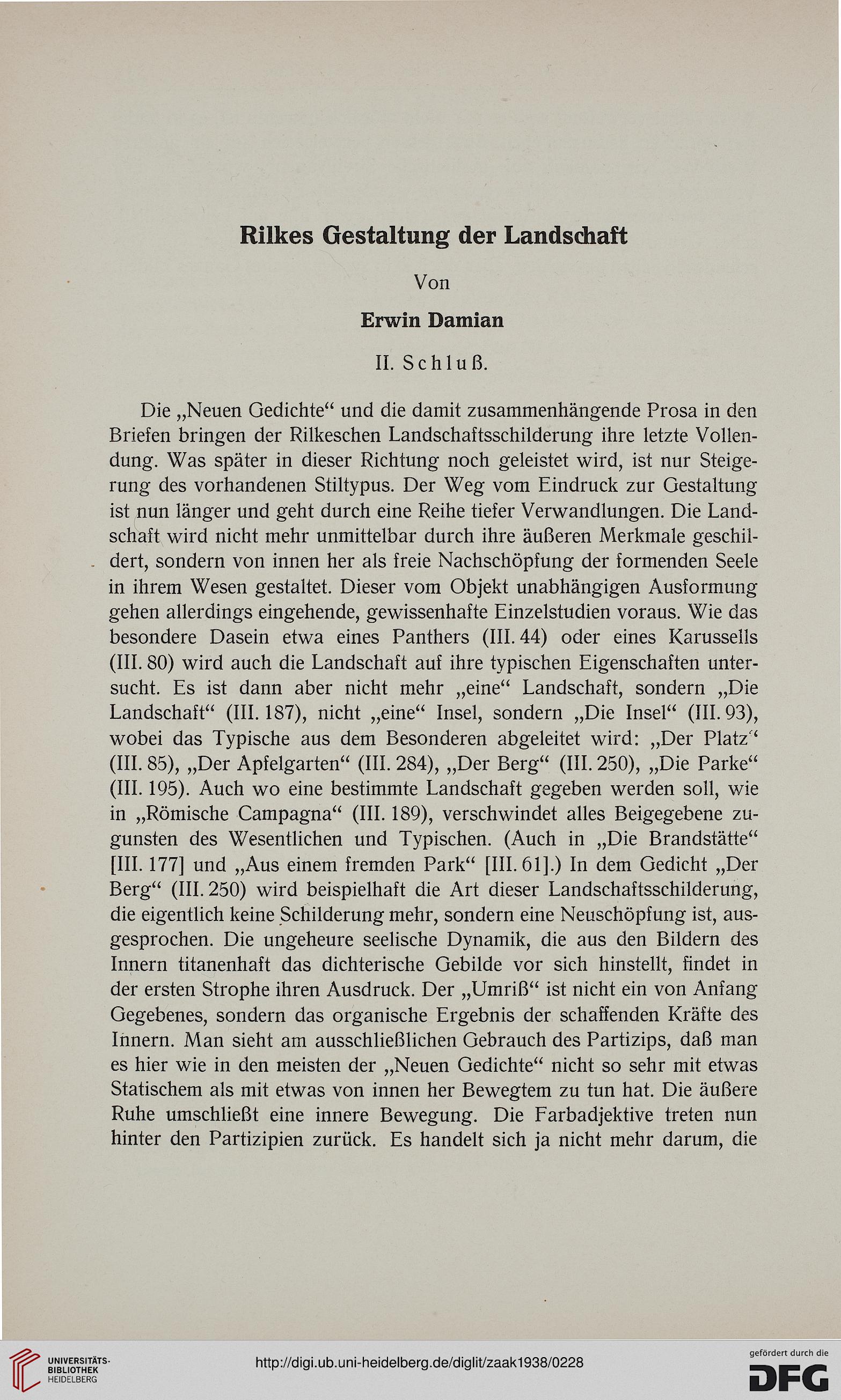Rilkes Gestaltung der Landschaft
Von
Erwin Damian
II. Schluß.
Die „Neuen Gedichte" und die damit zusammenhängende Prosa in den
Briefen bringen der Rilkeschen Landschaftsschilderung ihre letzte Vollen-
dung. Was später in dieser Richtung noch geleistet wird, ist nur Steige-
rung des vorhandenen Stiltypus. Der Weg vom Eindruck zur Gestaltung
ist nun länger und geht durch eine Reihe tiefer Verwandlungen. Die Land-
schaft wird nicht mehr unmittelbar durch ihre äußeren Merkmale geschil-
dert, sondern von innen her als freie Nachschöpfung der formenden Seele
in ihrem Wesen gestaltet. Dieser vom Objekt unabhängigen Ausformung
gehen allerdings eingehende, gewissenhafte Einzelstudien voraus. Wie das
besondere Dasein etwa eines Panthers (III. 44) oder eines Karussells
(III. 80) wird auch die Landschaft auf ihre typischen Eigenschaften unter-
sucht. Es ist dann aber nicht mehr „eine" Landschaft, sondern „Die
Landschaft" (III. 187), nicht „eine" Insel, sondern „Die Insel" (III. 93),
wobei das Typische aus dem Besonderen abgeleitet wird: „Der Platz''
(III. 85), „Der Apfelgarten" (III. 284), „Der Berg" (III. 250), „Die Parke"
(III. 195). Auch wo eine bestimmte Landschaft gegeben werden soll, wie
in „Römische Campagna" (III. 189), verschwindet alles Beigegebene zu-
gunsten des Wesentlichen und Typischen. (Auch in „Die Brandstätte"
[III. 177] und „Aus einem fremden Park" [III. 61].) In dem Gedicht „Der
Berg" (III. 250) wird beispielhaft die Art dieser Landschaftsschilderung,
die eigentlich keine Schilderung mehr, sondern eine Neuschöpfung ist, aus-
gesprochen. Die ungeheure seelische Dynamik, die aus den Bildern des
Innern titanenhaft das dichterische Gebilde vor sich hinstellt, findet in
der ersten Strophe ihren Ausdruck. Der „Umriß" ist nicht ein von Anfang
Gegebenes, sondern das organische Ergebnis der schaffenden Kräfte des
Innern. Man sieht am ausschließlichen Gebrauch des Partizips, daß man
es hier wie in den meisten der „Neuen Gedichte" nicht so sehr mit etwas
Statischem als mit etwas von innen her Bewegtem zu tun hat. Die äußere
Ruhe umschließt eine innere Bewegung. Die Farbadjektive treten nun
hinter den Partizipien zurück. Es handelt sich ja nicht mehr darum, die
Von
Erwin Damian
II. Schluß.
Die „Neuen Gedichte" und die damit zusammenhängende Prosa in den
Briefen bringen der Rilkeschen Landschaftsschilderung ihre letzte Vollen-
dung. Was später in dieser Richtung noch geleistet wird, ist nur Steige-
rung des vorhandenen Stiltypus. Der Weg vom Eindruck zur Gestaltung
ist nun länger und geht durch eine Reihe tiefer Verwandlungen. Die Land-
schaft wird nicht mehr unmittelbar durch ihre äußeren Merkmale geschil-
dert, sondern von innen her als freie Nachschöpfung der formenden Seele
in ihrem Wesen gestaltet. Dieser vom Objekt unabhängigen Ausformung
gehen allerdings eingehende, gewissenhafte Einzelstudien voraus. Wie das
besondere Dasein etwa eines Panthers (III. 44) oder eines Karussells
(III. 80) wird auch die Landschaft auf ihre typischen Eigenschaften unter-
sucht. Es ist dann aber nicht mehr „eine" Landschaft, sondern „Die
Landschaft" (III. 187), nicht „eine" Insel, sondern „Die Insel" (III. 93),
wobei das Typische aus dem Besonderen abgeleitet wird: „Der Platz''
(III. 85), „Der Apfelgarten" (III. 284), „Der Berg" (III. 250), „Die Parke"
(III. 195). Auch wo eine bestimmte Landschaft gegeben werden soll, wie
in „Römische Campagna" (III. 189), verschwindet alles Beigegebene zu-
gunsten des Wesentlichen und Typischen. (Auch in „Die Brandstätte"
[III. 177] und „Aus einem fremden Park" [III. 61].) In dem Gedicht „Der
Berg" (III. 250) wird beispielhaft die Art dieser Landschaftsschilderung,
die eigentlich keine Schilderung mehr, sondern eine Neuschöpfung ist, aus-
gesprochen. Die ungeheure seelische Dynamik, die aus den Bildern des
Innern titanenhaft das dichterische Gebilde vor sich hinstellt, findet in
der ersten Strophe ihren Ausdruck. Der „Umriß" ist nicht ein von Anfang
Gegebenes, sondern das organische Ergebnis der schaffenden Kräfte des
Innern. Man sieht am ausschließlichen Gebrauch des Partizips, daß man
es hier wie in den meisten der „Neuen Gedichte" nicht so sehr mit etwas
Statischem als mit etwas von innen her Bewegtem zu tun hat. Die äußere
Ruhe umschließt eine innere Bewegung. Die Farbadjektive treten nun
hinter den Partizipien zurück. Es handelt sich ja nicht mehr darum, die