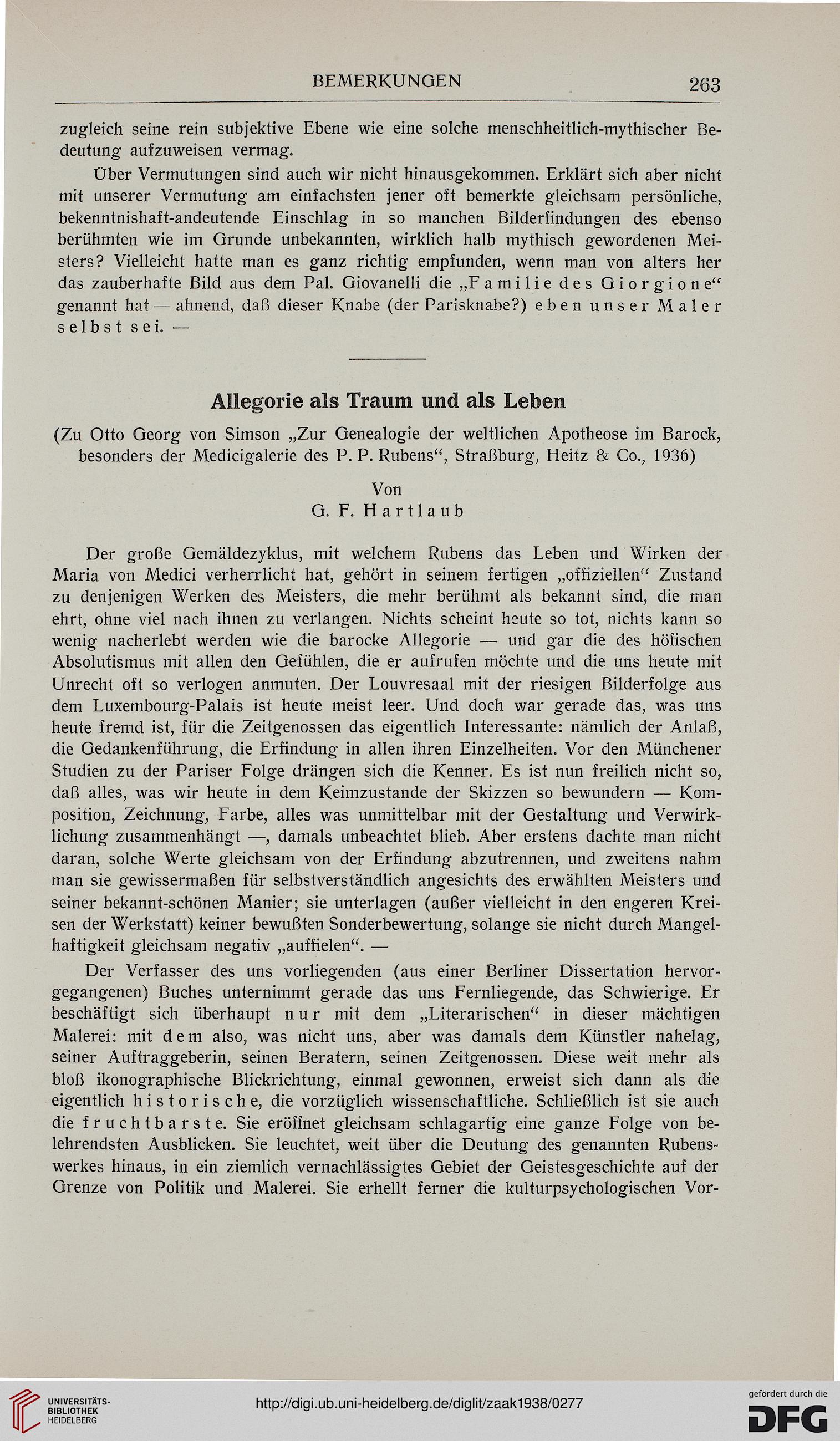zugleich seine rein subjektive Ebene wie eine solche menschheitlich-mythischer Be-
deutung aufzuweisen vermag.
Über Vermutungen sind auch wir nicht hinausgekommen. Erklärt sich aber nicht
mit unserer Vermutung am einfachsten jener oft bemerkte gleichsam persönliche,
bekenntnishaft-andeutende Einschlag in so manchen Bilderfindungen des ebenso
berühmten wie im Grunde unbekannten, wirklich halb mythisch gewordenen Mei-
sters? Vielleicht hatte man es ganz richtig empfunden, wenn man von alters her
das zauberhafte Bild aus dem Pal. Giovanelli die „Familie des G i o r g i o n e"
genannt hat — ahnend, daß dieser Knabe (der Parisknabe?) eben unser Maler
selbst sei. —
Allegorie als Traum und als Leben
(Zu Otto Georg von Simson „Zur Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock,
besonders der Medicigalerie des P. P. Rubens", Straßburg, Heitz & Co., 1936)
Von
G. F. H a r 11 a u b
Der große Gemäldezyklus, mit welchem Rubens das Leben und Wirken der
Maria von Medici verherrlicht hat, gehört in seinem fertigen „offiziellen" Zustand
zu denjenigen Werken des Meisters, die mehr berühmt als bekannt sind, die man
ehrt, ohne viel nach ihnen zu verlangen. Nichts scheint heute so tot, nichts kann so
wenig nacherlebt werden wie die barocke Allegorie — und gar die des höfischen
Absolutismus mit allen den Gefühlen, die er aufrufen möchte und die uns heute mit
Unrecht oft so verlogen anmuten. Der Louvresaal mit der riesigen Bilderfolge aus
dem Luxembourg-Palais ist heute meist leer. Und doch war gerade das, was uns
heute fremd ist, für die Zeitgenossen das eigentlich Interessante: nämlich der Anlaß,
die Gedankenführung, die Erfindung in allen ihren Einzelheiten. Vor den Münchener
Studien zu der Pariser Folge drängen sich die Kenner. Es ist nun freilich nicht so,
daß alles, was wir heute in dem Keimzustande der Skizzen so bewundern — Kom-
position, Zeichnung, Farbe, alles was unmittelbar mit der Gestaltung und Verwirk-
lichung zusammenhängt —, damals unbeachtet blieb. Aber erstens dachte man nicht
daran, solche Werte gleichsam von der Erfindung abzutrennen, und zweitens nahm
man sie gewissermaßen für selbstverständlich angesichts des erwählten Meisters und
seiner bekannt-schönen Manier; sie unterlagen (außer vielleicht in den engeren Krei-
sen der Werkstatt) keiner bewußten Sonderbewertung, solange sie nicht durch Mangel-
haftigkeit gleichsam negativ „auffielen". —
Der Verfasser des uns vorliegenden (aus einer Berliner Dissertation hervor-
gegangenen) Buches unternimmt gerade das uns Fernliegende, das Schwierige. Er
beschäftigt sich überhaupt nur mit dem „Literarischen" in dieser mächtigen
Malerei: mit dem also, was nicht uns, aber was damals dem Künstler nahelag,
seiner Auftraggeberin, seinen Beratern, seinen Zeitgenossen. Diese weit mehr als
bloß ikonographische Blickrichtung, einmal gewonnen, erweist sich dann als die
eigentlich historische, die vorzüglich wissenschaftliche. Schließlich ist sie auch
die fruchtbarste. Sie eröffnet gleichsam schlagartig eine ganze Folge von be-
lehrendsten Ausblicken. Sie leuchtet, weit über die Deutung des genannten Rubens-
werkes hinaus, in ein ziemlich vernachlässigtes Gebiet der Geistesgeschichte auf der
Grenze von Politik und Malerei. Sie erhellt ferner die kulturpsychologischen Vor-
deutung aufzuweisen vermag.
Über Vermutungen sind auch wir nicht hinausgekommen. Erklärt sich aber nicht
mit unserer Vermutung am einfachsten jener oft bemerkte gleichsam persönliche,
bekenntnishaft-andeutende Einschlag in so manchen Bilderfindungen des ebenso
berühmten wie im Grunde unbekannten, wirklich halb mythisch gewordenen Mei-
sters? Vielleicht hatte man es ganz richtig empfunden, wenn man von alters her
das zauberhafte Bild aus dem Pal. Giovanelli die „Familie des G i o r g i o n e"
genannt hat — ahnend, daß dieser Knabe (der Parisknabe?) eben unser Maler
selbst sei. —
Allegorie als Traum und als Leben
(Zu Otto Georg von Simson „Zur Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock,
besonders der Medicigalerie des P. P. Rubens", Straßburg, Heitz & Co., 1936)
Von
G. F. H a r 11 a u b
Der große Gemäldezyklus, mit welchem Rubens das Leben und Wirken der
Maria von Medici verherrlicht hat, gehört in seinem fertigen „offiziellen" Zustand
zu denjenigen Werken des Meisters, die mehr berühmt als bekannt sind, die man
ehrt, ohne viel nach ihnen zu verlangen. Nichts scheint heute so tot, nichts kann so
wenig nacherlebt werden wie die barocke Allegorie — und gar die des höfischen
Absolutismus mit allen den Gefühlen, die er aufrufen möchte und die uns heute mit
Unrecht oft so verlogen anmuten. Der Louvresaal mit der riesigen Bilderfolge aus
dem Luxembourg-Palais ist heute meist leer. Und doch war gerade das, was uns
heute fremd ist, für die Zeitgenossen das eigentlich Interessante: nämlich der Anlaß,
die Gedankenführung, die Erfindung in allen ihren Einzelheiten. Vor den Münchener
Studien zu der Pariser Folge drängen sich die Kenner. Es ist nun freilich nicht so,
daß alles, was wir heute in dem Keimzustande der Skizzen so bewundern — Kom-
position, Zeichnung, Farbe, alles was unmittelbar mit der Gestaltung und Verwirk-
lichung zusammenhängt —, damals unbeachtet blieb. Aber erstens dachte man nicht
daran, solche Werte gleichsam von der Erfindung abzutrennen, und zweitens nahm
man sie gewissermaßen für selbstverständlich angesichts des erwählten Meisters und
seiner bekannt-schönen Manier; sie unterlagen (außer vielleicht in den engeren Krei-
sen der Werkstatt) keiner bewußten Sonderbewertung, solange sie nicht durch Mangel-
haftigkeit gleichsam negativ „auffielen". —
Der Verfasser des uns vorliegenden (aus einer Berliner Dissertation hervor-
gegangenen) Buches unternimmt gerade das uns Fernliegende, das Schwierige. Er
beschäftigt sich überhaupt nur mit dem „Literarischen" in dieser mächtigen
Malerei: mit dem also, was nicht uns, aber was damals dem Künstler nahelag,
seiner Auftraggeberin, seinen Beratern, seinen Zeitgenossen. Diese weit mehr als
bloß ikonographische Blickrichtung, einmal gewonnen, erweist sich dann als die
eigentlich historische, die vorzüglich wissenschaftliche. Schließlich ist sie auch
die fruchtbarste. Sie eröffnet gleichsam schlagartig eine ganze Folge von be-
lehrendsten Ausblicken. Sie leuchtet, weit über die Deutung des genannten Rubens-
werkes hinaus, in ein ziemlich vernachlässigtes Gebiet der Geistesgeschichte auf der
Grenze von Politik und Malerei. Sie erhellt ferner die kulturpsychologischen Vor-