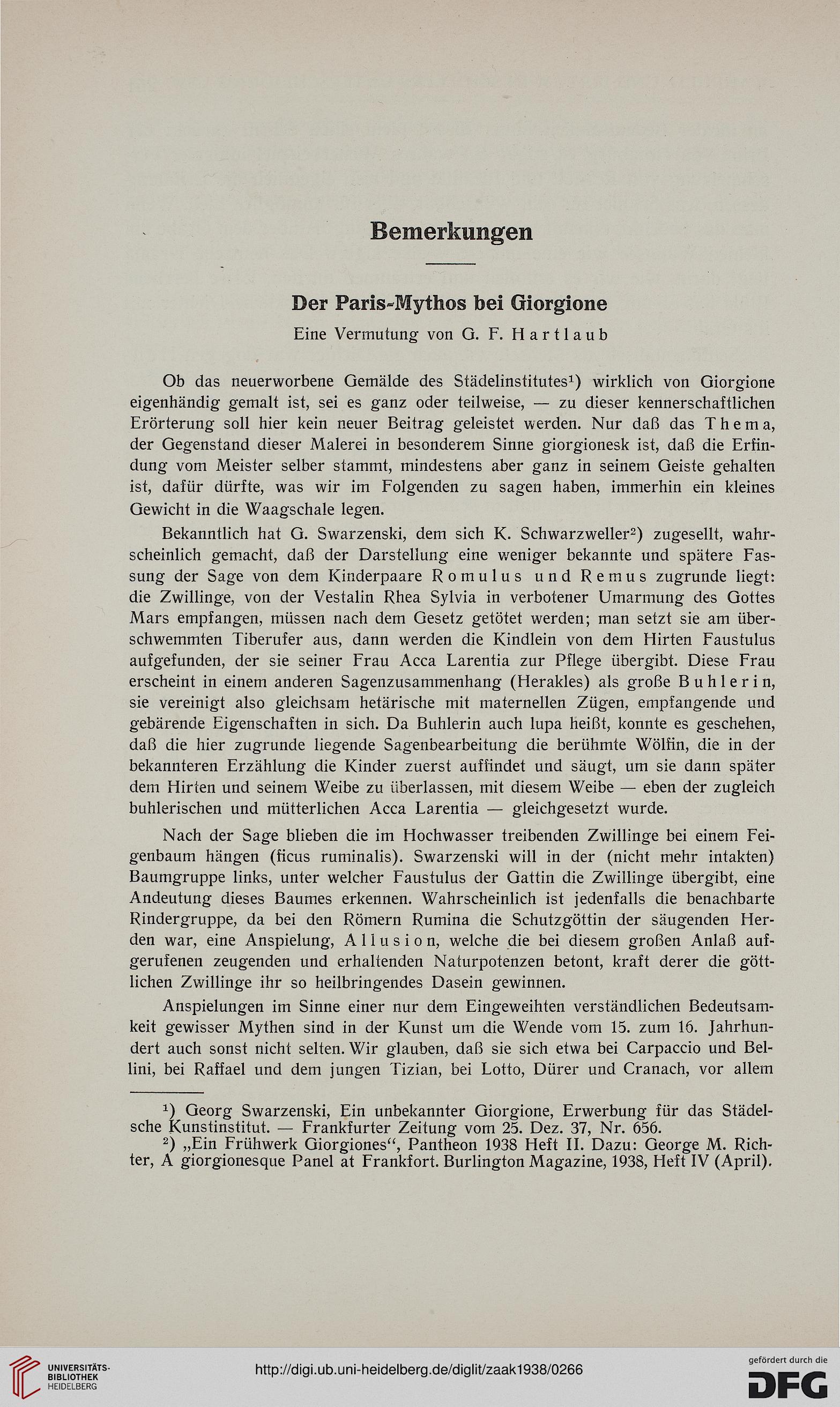Bemerkungen
Der Paris-Mythos bei Giorgione
Eine Vermutung von G. F. Hartlaub
Ob das neuerworbene Gemälde des Städelinstitutes1) wirklich von Giorgione
eigenhändig gemalt ist, sei es ganz oder teilweise, — zu dieser kennerschaftlichen
Erörterung soll hier kein neuer Beitrag geleistet werden. Nur daß das Thema,
der Gegenstand dieser Malerei in besonderem Sinne giorgionesk ist, daß die Erfin-
dung vom Meister selber stammt, mindestens aber ganz in seinem Geiste gehalten
ist, dafür dürfte, was wir im Folgenden zu sagen haben, immerhin ein kleines
Gewicht in die Waagschale legen.
Bekanntlich hat G. Swarzenski, dem sich K. Schwarzweller2) zugesellt, wahr-
scheinlich gemacht, daß der Darstellung eine weniger bekannte und spätere Fas-
sung der Sage von dem Kinderpaare Romulus undRemus zugrunde liegt:
die Zwillinge, von der Vestalin Rhea Sylvia in verbotener Umarmung des Gottes
Mars empfangen, müssen nach dem Gesetz getötet werden; man setzt sie am über-
schwemmten Tiberufer aus, dann werden die Kindlein von dem Hirten Faustulus
aufgefunden, der sie seiner Frau Acca Larentia zur Pflege übergibt. Diese Frau
erscheint in einem anderen Sagenzusammenhang (Herakles) als große B u h 1 e r i n,
sie vereinigt also gleichsam hetärische mit maternellen Zügen, empfangende und
gebärende Eigenschaften in sich. Da Buhlerin auch lupa heißt, konnte es geschehen,
daß die hier zugrunde liegende Sagenbearbeitung die berühmte Wölfin, die in der
bekannteren Erzählung die Kinder zuerst auffindet und säugt, um sie dann später
dem Hirten und seinem Weibe zu überlassen, mit diesem Weibe — eben der zugleich
buhlerischen und mütterlichen Acca Larentia — gleichgesetzt wurde.
Nach der Sage blieben die im Hochwasser treibenden Zwillinge bei einem Fei-
genbaum hängen (ficus ruminalis). Swarzenski will in der (nicht mehr intakten)
Baumgruppe links, unter welcher Faustulus der Gattin die Zwillinge übergibt, eine
Andeutung dieses Baumes erkennen. Wahrscheinlich ist jedenfalls die benachbarte
Rindergruppe, da bei den Römern Rumina die Schutzgöttin der säugenden Her-
den war, eine Anspielung, Allusion, welche die bei diesem großen Anlaß auf-
gerufenen zeugenden und erhaltenden Naturpotenzen betont, kraft derer die gött-
lichen Zwillinge ihr so heilbringendes Dasein gewinnen.
Anspielungen im Sinne einer nur dem Eingeweihten verständlichen Bedeutsam-
keit gewisser Mythen sind in der Kunst um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhun-
dert auch sonst nicht selten. Wir glauben, daß sie sich etwa bei Carpaccio und Bel-
lini, bei Raffael und dem jungen Tizian, bei Lotto, Dürer und Cranach, vor allem
1) Georg Swarzenski, Ein unbekannter Giorgione, Erwerbung für das Städel-
sche Kunstinstitut. — Frankfurter Zeitung vom 25. Dez. 37, Nr. 656.
2) „Ein Frühwerk Giorgiones", Pantheon 1938 Heft II. Dazu: George M. Rich-
ter, A giorgionesque Panel at Frankfort. Burlington Magazine, 1938, Heft IV (April).
Der Paris-Mythos bei Giorgione
Eine Vermutung von G. F. Hartlaub
Ob das neuerworbene Gemälde des Städelinstitutes1) wirklich von Giorgione
eigenhändig gemalt ist, sei es ganz oder teilweise, — zu dieser kennerschaftlichen
Erörterung soll hier kein neuer Beitrag geleistet werden. Nur daß das Thema,
der Gegenstand dieser Malerei in besonderem Sinne giorgionesk ist, daß die Erfin-
dung vom Meister selber stammt, mindestens aber ganz in seinem Geiste gehalten
ist, dafür dürfte, was wir im Folgenden zu sagen haben, immerhin ein kleines
Gewicht in die Waagschale legen.
Bekanntlich hat G. Swarzenski, dem sich K. Schwarzweller2) zugesellt, wahr-
scheinlich gemacht, daß der Darstellung eine weniger bekannte und spätere Fas-
sung der Sage von dem Kinderpaare Romulus undRemus zugrunde liegt:
die Zwillinge, von der Vestalin Rhea Sylvia in verbotener Umarmung des Gottes
Mars empfangen, müssen nach dem Gesetz getötet werden; man setzt sie am über-
schwemmten Tiberufer aus, dann werden die Kindlein von dem Hirten Faustulus
aufgefunden, der sie seiner Frau Acca Larentia zur Pflege übergibt. Diese Frau
erscheint in einem anderen Sagenzusammenhang (Herakles) als große B u h 1 e r i n,
sie vereinigt also gleichsam hetärische mit maternellen Zügen, empfangende und
gebärende Eigenschaften in sich. Da Buhlerin auch lupa heißt, konnte es geschehen,
daß die hier zugrunde liegende Sagenbearbeitung die berühmte Wölfin, die in der
bekannteren Erzählung die Kinder zuerst auffindet und säugt, um sie dann später
dem Hirten und seinem Weibe zu überlassen, mit diesem Weibe — eben der zugleich
buhlerischen und mütterlichen Acca Larentia — gleichgesetzt wurde.
Nach der Sage blieben die im Hochwasser treibenden Zwillinge bei einem Fei-
genbaum hängen (ficus ruminalis). Swarzenski will in der (nicht mehr intakten)
Baumgruppe links, unter welcher Faustulus der Gattin die Zwillinge übergibt, eine
Andeutung dieses Baumes erkennen. Wahrscheinlich ist jedenfalls die benachbarte
Rindergruppe, da bei den Römern Rumina die Schutzgöttin der säugenden Her-
den war, eine Anspielung, Allusion, welche die bei diesem großen Anlaß auf-
gerufenen zeugenden und erhaltenden Naturpotenzen betont, kraft derer die gött-
lichen Zwillinge ihr so heilbringendes Dasein gewinnen.
Anspielungen im Sinne einer nur dem Eingeweihten verständlichen Bedeutsam-
keit gewisser Mythen sind in der Kunst um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhun-
dert auch sonst nicht selten. Wir glauben, daß sie sich etwa bei Carpaccio und Bel-
lini, bei Raffael und dem jungen Tizian, bei Lotto, Dürer und Cranach, vor allem
1) Georg Swarzenski, Ein unbekannter Giorgione, Erwerbung für das Städel-
sche Kunstinstitut. — Frankfurter Zeitung vom 25. Dez. 37, Nr. 656.
2) „Ein Frühwerk Giorgiones", Pantheon 1938 Heft II. Dazu: George M. Rich-
ter, A giorgionesque Panel at Frankfort. Burlington Magazine, 1938, Heft IV (April).