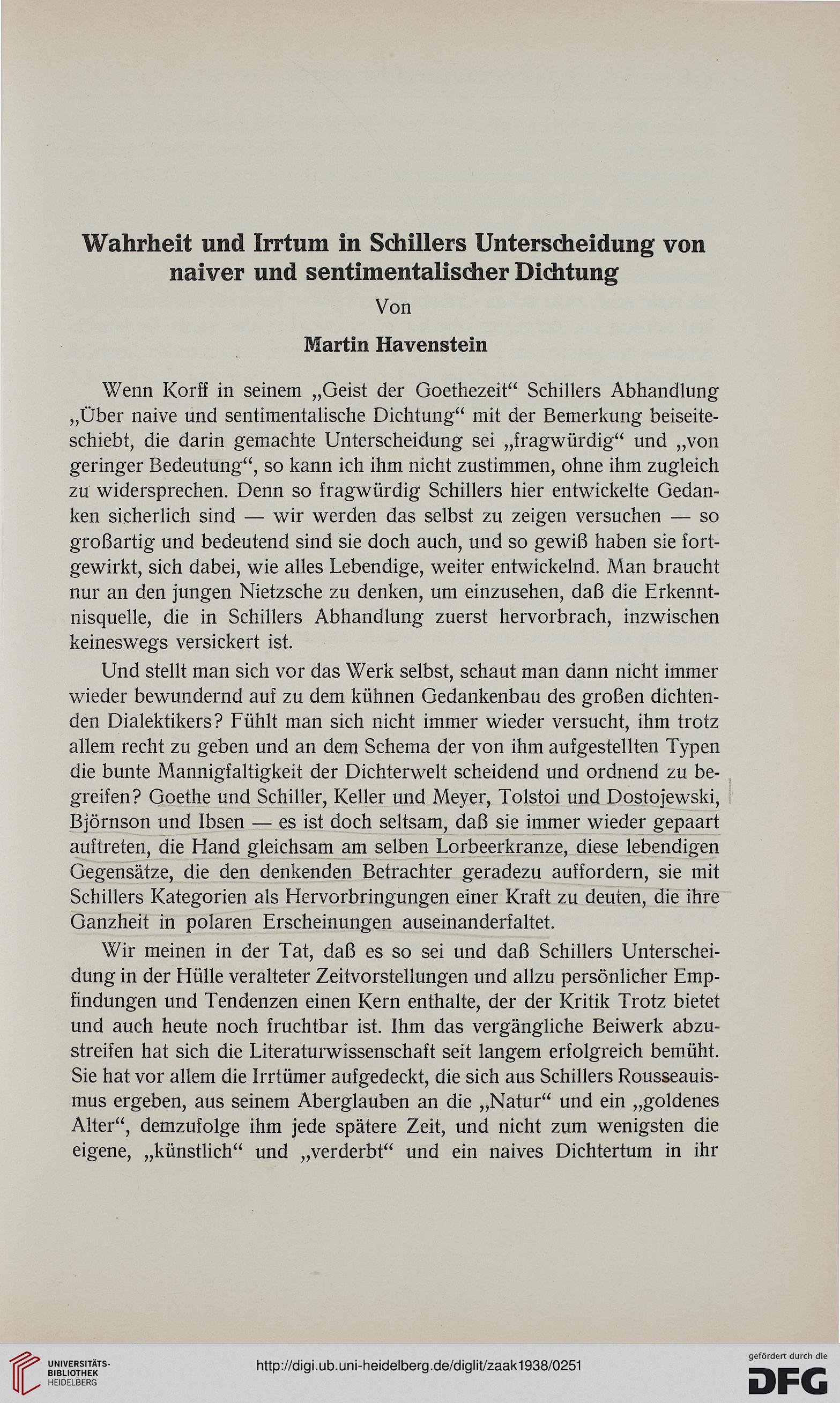Wahrheit und Irrtum in Schillers Unterscheidung von
naiver und sentimentalischer Dichtung
Von
Martin Havenstein
Wenn Korff in seinem „Geist der Goethezeit" Schillers Abhandlung
„Über naive und sentimentalische Dichtung" mit der Bemerkung beiseite-
schiebt, die darin gemachte Unterscheidung sei „fragwürdig" und „von
geringer Bedeutung", so kann ich ihm nicht zustimmen, ohne ihm zugleich
zu widersprechen. Denn so fragwürdig Schillers hier entwickelte Gedan-
ken sicherlich sind — wir werden das selbst zu zeigen versuchen — so
großartig und bedeutend sind sie doch auch, und so gewiß haben sie fort-
gewirkt, sich dabei, wie alles Lebendige, weiter entwickelnd. Man braucht
nur an den jungen Nietzsche zu denken, um einzusehen, daß die Erkennt-
nisquelle, die in Schillers Abhandlung zuerst hervorbrach, inzwischen
keineswegs versickert ist.
Und stellt man sich vor das Werk selbst, schaut man dann nicht immer
wieder bewundernd auf zu dem kühnen Gedankenbau des großen dichten-
den Dialektikers? Fühlt man sich nicht immer wieder versucht, ihm trotz
allem recht zu geben und an dem Schema der von ihm aufgestellten Typen
die bunte Mannigfaltigkeit der Dichterwelt scheidend und ordnend zu be-
greifen? Goethe und Schiller, Keller und Meyer, Tolstoi und Dostojewski,
Björnson und Ibsen — es ist doch seltsam, daß sie immer wieder gepaart
auftreten, die Hand gleichsam am selben Lorbeerkranze, diese lebendigen
Gegensätze, die den denkenden Betrachter geradezu auffordern, sie mit
Schillers Kategorien als Hervorbringungen einer Kraft zu deuten, die ihre
Ganzheit in polaren Erscheinungen auseinanderfaltet.
Wir meinen in der Tat, daß es so sei und daß Schillers Unterschei-
dung in der Hülle veralteter Zeitvorstellungen und allzu persönlicher Emp-
findungen und Tendenzen einen Kern enthalte, der der Kritik Trotz bietet
und auch heute noch fruchtbar ist. Ihm das vergängliche Beiwerk abzu-
streifen hat sich die Literaturwissenschaft seit langem erfolgreich bemüht.
Sie hat vor allem die Irrtümer aufgedeckt, die sich aus Schillers Rousseauis-
mus ergeben, aus seinem Aberglauben an die „Natur" und ein „goldenes
Alter", demzufolge ihm jede spätere Zeit, und nicht zum wenigsten die
eigene, „künstlich" und „verderbt" und ein naives Dichtertum in ihr
naiver und sentimentalischer Dichtung
Von
Martin Havenstein
Wenn Korff in seinem „Geist der Goethezeit" Schillers Abhandlung
„Über naive und sentimentalische Dichtung" mit der Bemerkung beiseite-
schiebt, die darin gemachte Unterscheidung sei „fragwürdig" und „von
geringer Bedeutung", so kann ich ihm nicht zustimmen, ohne ihm zugleich
zu widersprechen. Denn so fragwürdig Schillers hier entwickelte Gedan-
ken sicherlich sind — wir werden das selbst zu zeigen versuchen — so
großartig und bedeutend sind sie doch auch, und so gewiß haben sie fort-
gewirkt, sich dabei, wie alles Lebendige, weiter entwickelnd. Man braucht
nur an den jungen Nietzsche zu denken, um einzusehen, daß die Erkennt-
nisquelle, die in Schillers Abhandlung zuerst hervorbrach, inzwischen
keineswegs versickert ist.
Und stellt man sich vor das Werk selbst, schaut man dann nicht immer
wieder bewundernd auf zu dem kühnen Gedankenbau des großen dichten-
den Dialektikers? Fühlt man sich nicht immer wieder versucht, ihm trotz
allem recht zu geben und an dem Schema der von ihm aufgestellten Typen
die bunte Mannigfaltigkeit der Dichterwelt scheidend und ordnend zu be-
greifen? Goethe und Schiller, Keller und Meyer, Tolstoi und Dostojewski,
Björnson und Ibsen — es ist doch seltsam, daß sie immer wieder gepaart
auftreten, die Hand gleichsam am selben Lorbeerkranze, diese lebendigen
Gegensätze, die den denkenden Betrachter geradezu auffordern, sie mit
Schillers Kategorien als Hervorbringungen einer Kraft zu deuten, die ihre
Ganzheit in polaren Erscheinungen auseinanderfaltet.
Wir meinen in der Tat, daß es so sei und daß Schillers Unterschei-
dung in der Hülle veralteter Zeitvorstellungen und allzu persönlicher Emp-
findungen und Tendenzen einen Kern enthalte, der der Kritik Trotz bietet
und auch heute noch fruchtbar ist. Ihm das vergängliche Beiwerk abzu-
streifen hat sich die Literaturwissenschaft seit langem erfolgreich bemüht.
Sie hat vor allem die Irrtümer aufgedeckt, die sich aus Schillers Rousseauis-
mus ergeben, aus seinem Aberglauben an die „Natur" und ein „goldenes
Alter", demzufolge ihm jede spätere Zeit, und nicht zum wenigsten die
eigene, „künstlich" und „verderbt" und ein naives Dichtertum in ihr