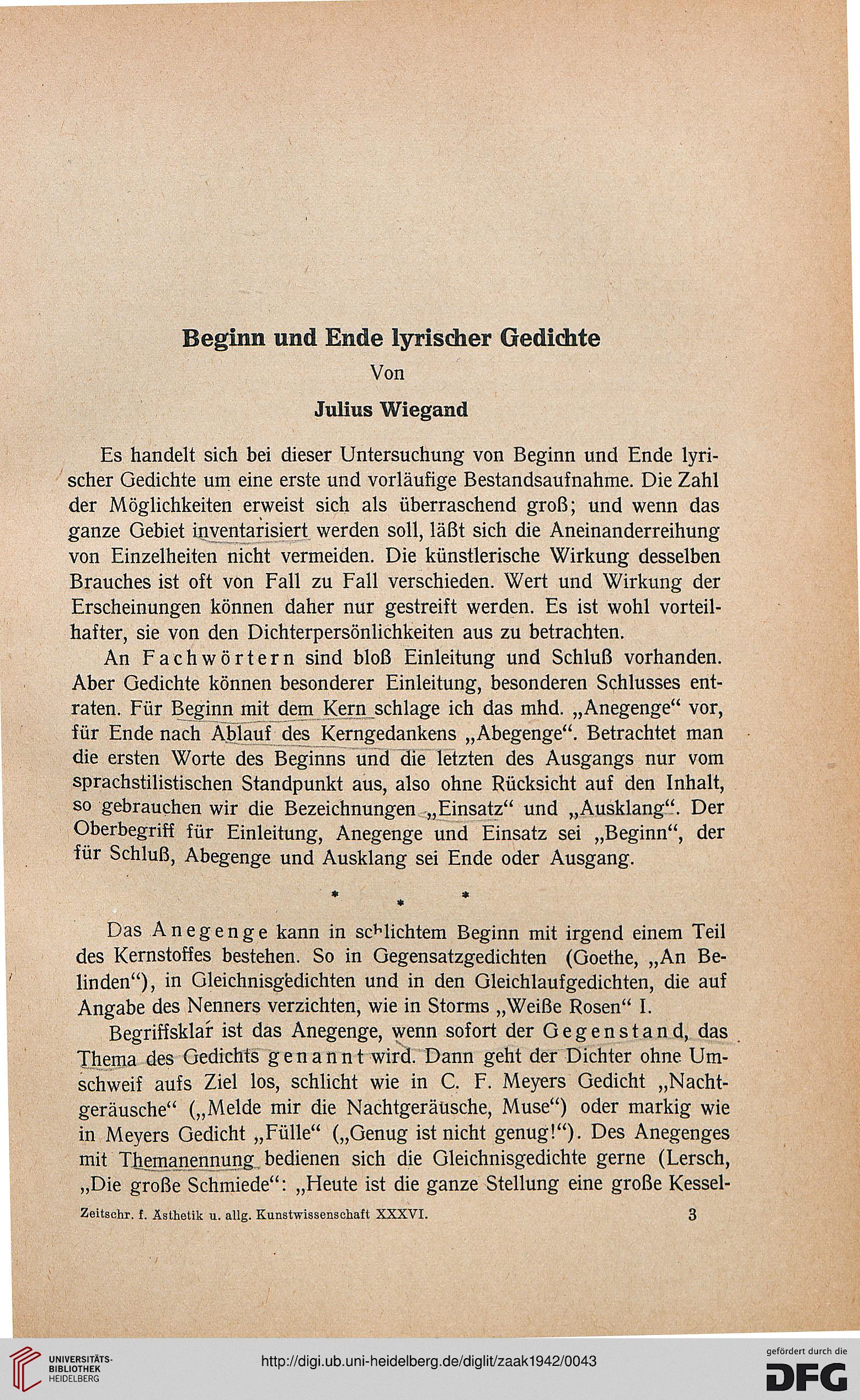Beginn und Ende lyrischer Gedichte
Von
Julius Wiegand
Es handelt sich bei dieser Untersuchung von Beginn und Ende lyri-
scher Gedichte um eine erste und vorläufige Bestandsaufnahme. Die Zahl
der Möglichkeiten erweist sich als überraschend groß; und wenn das
ganze Gebiet inventarisiert werden soll, läßt sich die Aneinanderreihung
von Einzelheiten nicht vermeiden. Die künstlerische Wirkung desselben
Brauches ist oft von Fall zu Fall verschieden. Wert und Wirkung der
Erscheinungen können daher nur gestreift werden. Es ist wohl vorteil-
hafter, sie von den Dichterpersönlichkeiten aus zu betrachten.
An Fachwörtern sind bloß Einleitung und Schluß vorhanden.
Aber Gedichte können besonderer Einleitung, besonderen Schlusses ent-
raten. Für Beginn mit dem Kern schlage ich das mhd. „Anegenge" vor,
für Ende nach Ablauf des Kerngedankens „Abegenge". Betrachtet man
die ersten Worte des Beginns und die letzten des Ausgangs nur vom
sprachstilistischen Standpunkt aus, also ohne Rücksicht auf den Inhalt,
so gebrauchen wir die Bezeichnungen „Einsatz" und „Ausklang". Der
Oberbegriff für Einleitung, Anegenge und Einsatz sei „Beginn", der
für Schluß, Abegenge und Ausklang sei Ende oder Ausgang.
* •
Das Anegenge kann in schlichtem Beginn mit irgend einem Teil
des Kernstoffes bestehen. So in Gegensatzgedichten (Goethe, „An Be-
linden"), in Gleichnisgedichten und in den Gleichlaufgedichten, die auf
Angabe des Nenners verzichten, wie in Storms „Weiße Rosen" I.
Begriffsklar ist das Anegenge, wenn sofort der Gegenstand, das
Thema des Gedichts genannt wird. Dann geht der Dichter ohne Um-
schweif aufs Ziel los, schlicht wie in C. F. Meyers Gedicht „Nacht-
geräusche" („Melde mir die Nachtgeräüsche, Muse") oder markig wie
in Meyers Gedicht „Fülle" („Genug ist nicht genug!"). Des Anegenges
mit Themanennung bedienen sich die Gleichnisgedichte gerne (Lersch,
„Die große Schmiede": „Heute ist die ganze Stellung eine große Kessel-
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXVI. 3
Von
Julius Wiegand
Es handelt sich bei dieser Untersuchung von Beginn und Ende lyri-
scher Gedichte um eine erste und vorläufige Bestandsaufnahme. Die Zahl
der Möglichkeiten erweist sich als überraschend groß; und wenn das
ganze Gebiet inventarisiert werden soll, läßt sich die Aneinanderreihung
von Einzelheiten nicht vermeiden. Die künstlerische Wirkung desselben
Brauches ist oft von Fall zu Fall verschieden. Wert und Wirkung der
Erscheinungen können daher nur gestreift werden. Es ist wohl vorteil-
hafter, sie von den Dichterpersönlichkeiten aus zu betrachten.
An Fachwörtern sind bloß Einleitung und Schluß vorhanden.
Aber Gedichte können besonderer Einleitung, besonderen Schlusses ent-
raten. Für Beginn mit dem Kern schlage ich das mhd. „Anegenge" vor,
für Ende nach Ablauf des Kerngedankens „Abegenge". Betrachtet man
die ersten Worte des Beginns und die letzten des Ausgangs nur vom
sprachstilistischen Standpunkt aus, also ohne Rücksicht auf den Inhalt,
so gebrauchen wir die Bezeichnungen „Einsatz" und „Ausklang". Der
Oberbegriff für Einleitung, Anegenge und Einsatz sei „Beginn", der
für Schluß, Abegenge und Ausklang sei Ende oder Ausgang.
* •
Das Anegenge kann in schlichtem Beginn mit irgend einem Teil
des Kernstoffes bestehen. So in Gegensatzgedichten (Goethe, „An Be-
linden"), in Gleichnisgedichten und in den Gleichlaufgedichten, die auf
Angabe des Nenners verzichten, wie in Storms „Weiße Rosen" I.
Begriffsklar ist das Anegenge, wenn sofort der Gegenstand, das
Thema des Gedichts genannt wird. Dann geht der Dichter ohne Um-
schweif aufs Ziel los, schlicht wie in C. F. Meyers Gedicht „Nacht-
geräusche" („Melde mir die Nachtgeräüsche, Muse") oder markig wie
in Meyers Gedicht „Fülle" („Genug ist nicht genug!"). Des Anegenges
mit Themanennung bedienen sich die Gleichnisgedichte gerne (Lersch,
„Die große Schmiede": „Heute ist die ganze Stellung eine große Kessel-
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXVI. 3