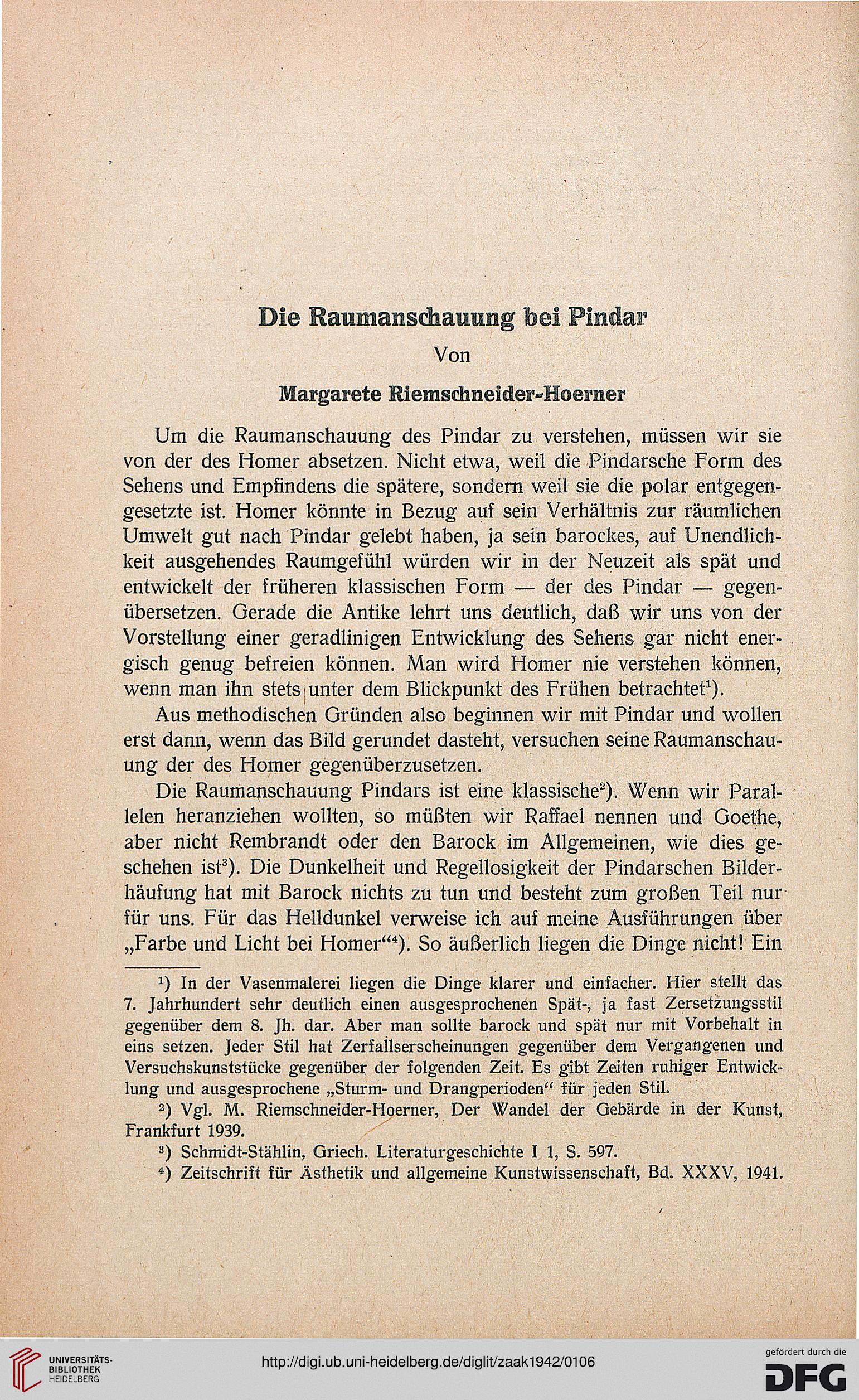Die Raumanschauung bei Pindar
Von
Margarete Riemschneider-Hoerner
Um die Raumanschauung des Pindar zu verstehen, müssen wir sie
von der des Homer absetzen. Nicht etwa, weil die Pindarsche Form des
Sehens und Empfindens die spätere, sondern weil sie die polar entgegen-
gesetzte ist. Homer könnte in Bezug auf sein Verhältnis zur räumlichen
Umwelt gut nach Pindar gelebt haben, ja sein barockes, auf Unendlich-
keit ausgehendes Raumgefühl würden wir in der Neuzeit als spät und
entwickelt der früheren klassischen Form — der des Pindar — gegen-
übersetzen. Gerade die Antike lehrt uns deutlich, daß wir uns von der
Vorstellung einer geradlinigen Entwicklung des Sehens gar nicht ener-
gisch genug befreien können. Man wird Homer nie verstehen können,
wenn man ihn stets unter dem Blickpunkt des Frühen betrachtet1).
Aus methodischen Gründen also beginnen wir mit Pindar und wollen
erst dann, wenn das Bild gerundet dasteht, versuchen seine Raumanschau-
ung der des Homer gegenüberzusetzen.
Die Raumanschauung Pindars ist eine klassische2). Wenn wir Paral-
lelen heranziehen wollten, so müßten wir Raffael nennen und Goethe,
aber nicht Rembrandt oder den Barock im Allgemeinen, wie dies ge-
schehen ist3). Die Dunkelheit und Regellosigkeit der Pindarschen Bilder-
häufung hat mit Barock nichts zu tun und besteht zum großen Teil nur
für uns. Für das Helldunkel verweise ich auf meine Ausführungen über
„Farbe und Licht bei Homer"4). So äußerlich liegen die Dinge nicht! Ein
x) In der Vasenmalerei liegen die Dinge klarer und einfacher. Hier stellt das
7. Jahrhundert sehr deutlich einen ausgesprochenen Spät-, ja fast Zersetzungsstil
gegenüber dem 8. Jh. dar. Aber man sollte barock und spät nur mit Vorbehalt in
eins setzen. Jeder Stil hat ZerfaÜserscheinungen gegenüber dem Vergangenen und
Versuchskunststücke gegenüber der folgenden Zeit. Es gibt Zeiten ruhiger Entwick-
lung und ausgesprochene „Sturm- und Drangperioden" für jeden Stil.
2) Vgl. M. Riemschneider-Hoerner, Der Wandel der Gebärde in der Kunst,
Frankfurt 1939.
3) Schmidt-Stählin, Qriech. Literaturgeschichte I 1, S. 597.
4) Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Bd. XXXV, 1941.
Von
Margarete Riemschneider-Hoerner
Um die Raumanschauung des Pindar zu verstehen, müssen wir sie
von der des Homer absetzen. Nicht etwa, weil die Pindarsche Form des
Sehens und Empfindens die spätere, sondern weil sie die polar entgegen-
gesetzte ist. Homer könnte in Bezug auf sein Verhältnis zur räumlichen
Umwelt gut nach Pindar gelebt haben, ja sein barockes, auf Unendlich-
keit ausgehendes Raumgefühl würden wir in der Neuzeit als spät und
entwickelt der früheren klassischen Form — der des Pindar — gegen-
übersetzen. Gerade die Antike lehrt uns deutlich, daß wir uns von der
Vorstellung einer geradlinigen Entwicklung des Sehens gar nicht ener-
gisch genug befreien können. Man wird Homer nie verstehen können,
wenn man ihn stets unter dem Blickpunkt des Frühen betrachtet1).
Aus methodischen Gründen also beginnen wir mit Pindar und wollen
erst dann, wenn das Bild gerundet dasteht, versuchen seine Raumanschau-
ung der des Homer gegenüberzusetzen.
Die Raumanschauung Pindars ist eine klassische2). Wenn wir Paral-
lelen heranziehen wollten, so müßten wir Raffael nennen und Goethe,
aber nicht Rembrandt oder den Barock im Allgemeinen, wie dies ge-
schehen ist3). Die Dunkelheit und Regellosigkeit der Pindarschen Bilder-
häufung hat mit Barock nichts zu tun und besteht zum großen Teil nur
für uns. Für das Helldunkel verweise ich auf meine Ausführungen über
„Farbe und Licht bei Homer"4). So äußerlich liegen die Dinge nicht! Ein
x) In der Vasenmalerei liegen die Dinge klarer und einfacher. Hier stellt das
7. Jahrhundert sehr deutlich einen ausgesprochenen Spät-, ja fast Zersetzungsstil
gegenüber dem 8. Jh. dar. Aber man sollte barock und spät nur mit Vorbehalt in
eins setzen. Jeder Stil hat ZerfaÜserscheinungen gegenüber dem Vergangenen und
Versuchskunststücke gegenüber der folgenden Zeit. Es gibt Zeiten ruhiger Entwick-
lung und ausgesprochene „Sturm- und Drangperioden" für jeden Stil.
2) Vgl. M. Riemschneider-Hoerner, Der Wandel der Gebärde in der Kunst,
Frankfurt 1939.
3) Schmidt-Stählin, Qriech. Literaturgeschichte I 1, S. 597.
4) Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Bd. XXXV, 1941.