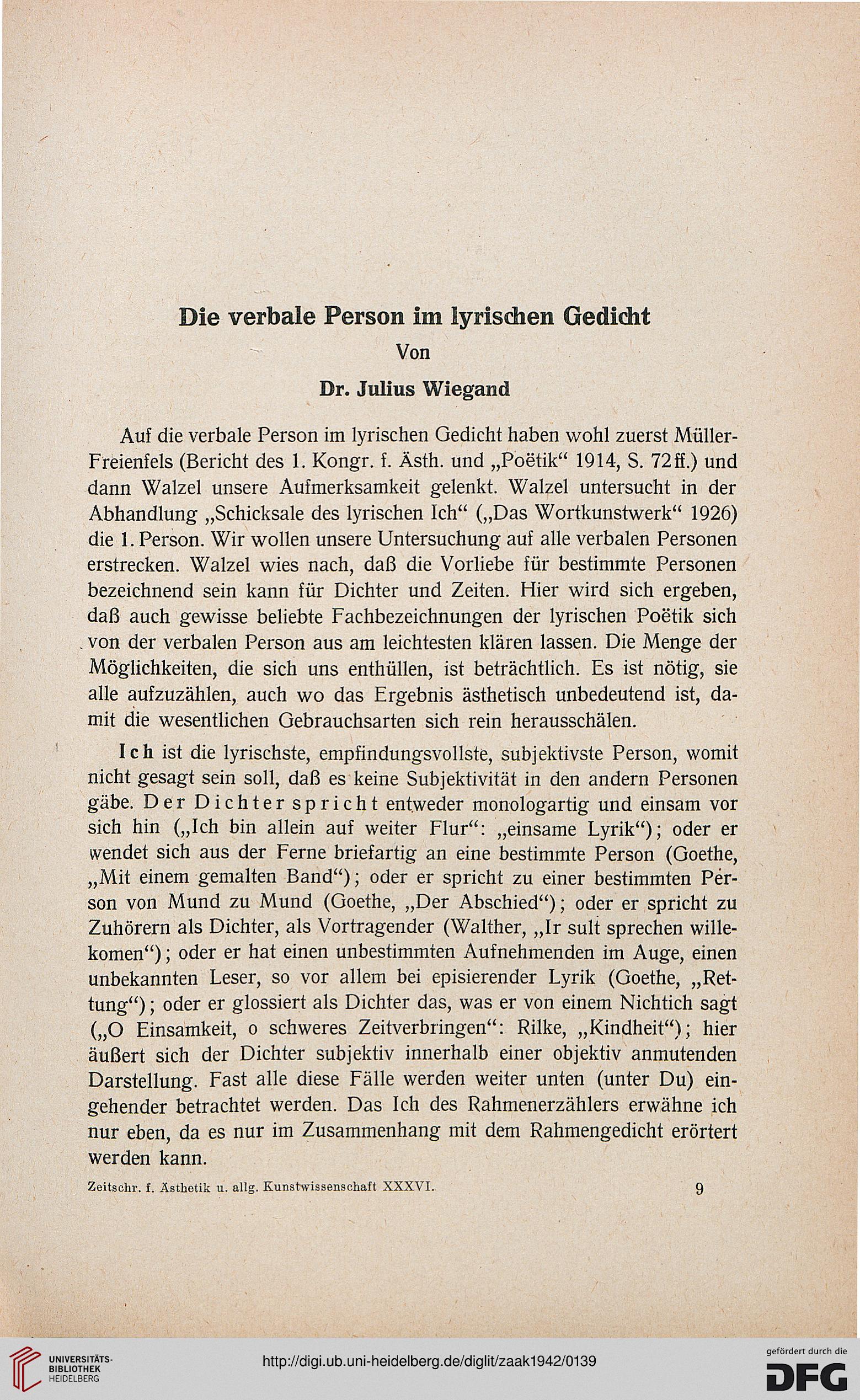Die verbale Person im lyrischen Gedicht
Von
Dr. Julius Wiegand
Auf die verbale Person im lyrischen Gedicht haben wohl zuerst Müller-
Freienfels (Bericht des 1. Kongr. f. Ästh. und „Poetik" 1914, S. 72 ff.) und
dann Walzel unsere Aufmerksamkeit gelenkt. Walzel untersucht in der
Abhandlung „Schicksale des lyrischen Ich" („Das Wortkunstwerk" 1926)
die 1. Person. Wir wollen unsere Untersuchung auf alle verbalen Personen
erstrecken. Walzel wies nach, daß die Vorliebe für bestimmte Personen
bezeichnend sein kann für Dichter und Zeiten. Hier wird sich ergeben,
daß auch gewisse beliebte Fachbezeichnungen der lyrischen Poetik sich
. von der verbalen Person aus am leichtesten klären lassen. Die Menge der
Möglichkeiten, die sich uns enthüllen, ist beträchtlich. Es ist nötig, sie
alle aufzuzählen, auch wo das Ergebnis ästhetisch unbedeutend ist, da-
mit die wesentlichen Gebrauchsarten sich rein herausschälen.
Ich ist die lyrischste, empfindungsvollste, subjektivste Person, womit
nicht gesagt sein soll, daß es keine Subjektivität in den andern Personen
gäbe. Der Dichter spricht entweder monologartig und einsam vor
sich hin („Ich bin allein auf weiter Flur": „einsame Lyrik"); oder er
wendet sich aus der Ferne briefartig an eine bestimmte Person (Goethe,
„Mit einem gemalten Band"); oder er spricht zu einer bestimmten Per-
son von Mund zu Mund (Goethe, „Der Abschied"); oder er spricht zu
Zuhörern als Dichter, als Vortragender (Walther, „Ir sult sprechen wille-
komen"); oder er hat einen unbestimmten Aufnehmenden im Auge, einen
unbekannten Leser, so vor allem bei episierender Lyrik (Goethe, „Ret-
tung") ; oder er glossiert als Dichter das, was er von einem Nichtich sagt
(„O Einsamkeit, o schweres Zeitverbringen": Rilke, „Kindheit"); hier
äußert sich der Dichter subjektiv innerhalb einer objektiv anmutenden
Darstellung. Fast alle diese Fälle werden weiter unten (unter Du) ein-
gehender betrachtet werden. Das Ich des Rahmenerzählers erwähne ich
nur eben, da es nur im Zusammenhang mit dem Rahmengedicht erörtert
werden kann.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXVI.
9
Von
Dr. Julius Wiegand
Auf die verbale Person im lyrischen Gedicht haben wohl zuerst Müller-
Freienfels (Bericht des 1. Kongr. f. Ästh. und „Poetik" 1914, S. 72 ff.) und
dann Walzel unsere Aufmerksamkeit gelenkt. Walzel untersucht in der
Abhandlung „Schicksale des lyrischen Ich" („Das Wortkunstwerk" 1926)
die 1. Person. Wir wollen unsere Untersuchung auf alle verbalen Personen
erstrecken. Walzel wies nach, daß die Vorliebe für bestimmte Personen
bezeichnend sein kann für Dichter und Zeiten. Hier wird sich ergeben,
daß auch gewisse beliebte Fachbezeichnungen der lyrischen Poetik sich
. von der verbalen Person aus am leichtesten klären lassen. Die Menge der
Möglichkeiten, die sich uns enthüllen, ist beträchtlich. Es ist nötig, sie
alle aufzuzählen, auch wo das Ergebnis ästhetisch unbedeutend ist, da-
mit die wesentlichen Gebrauchsarten sich rein herausschälen.
Ich ist die lyrischste, empfindungsvollste, subjektivste Person, womit
nicht gesagt sein soll, daß es keine Subjektivität in den andern Personen
gäbe. Der Dichter spricht entweder monologartig und einsam vor
sich hin („Ich bin allein auf weiter Flur": „einsame Lyrik"); oder er
wendet sich aus der Ferne briefartig an eine bestimmte Person (Goethe,
„Mit einem gemalten Band"); oder er spricht zu einer bestimmten Per-
son von Mund zu Mund (Goethe, „Der Abschied"); oder er spricht zu
Zuhörern als Dichter, als Vortragender (Walther, „Ir sult sprechen wille-
komen"); oder er hat einen unbestimmten Aufnehmenden im Auge, einen
unbekannten Leser, so vor allem bei episierender Lyrik (Goethe, „Ret-
tung") ; oder er glossiert als Dichter das, was er von einem Nichtich sagt
(„O Einsamkeit, o schweres Zeitverbringen": Rilke, „Kindheit"); hier
äußert sich der Dichter subjektiv innerhalb einer objektiv anmutenden
Darstellung. Fast alle diese Fälle werden weiter unten (unter Du) ein-
gehender betrachtet werden. Das Ich des Rahmenerzählers erwähne ich
nur eben, da es nur im Zusammenhang mit dem Rahmengedicht erörtert
werden kann.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXVI.
9