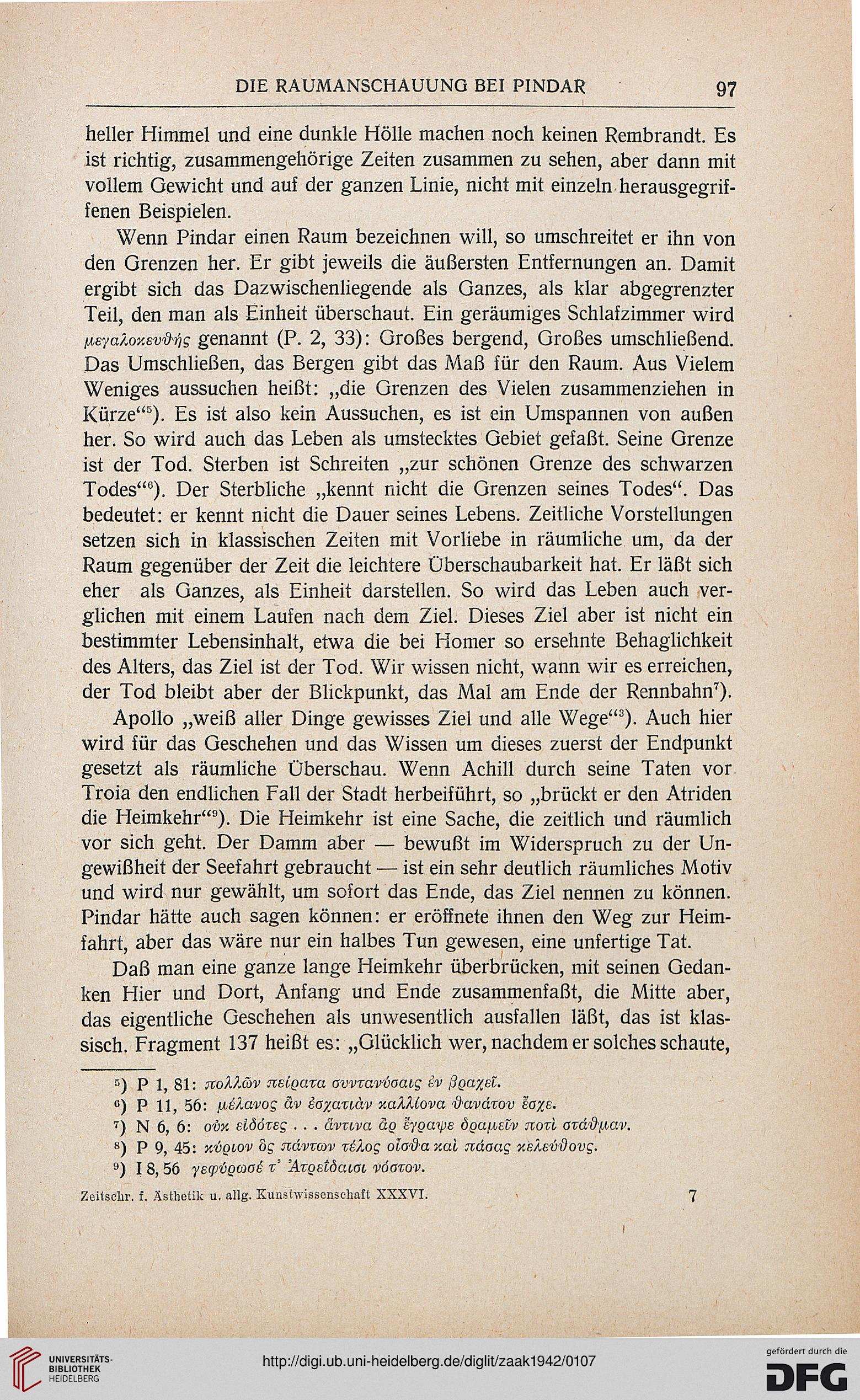DIE RAUMANSCHAUUNG BEI PINDAR
97
heller Himmel und eine dunkle Hölle machen noch keinen Rembrandt. Es
ist richtig, zusammengehörige Zeiten zusammen zu sehen, aber dann mit
vollem Gewicht und auf der ganzen Linie, nicht mit einzeln herausgegrif-
fenen Beispielen.
Wenn Pindar einen Raum bezeichnen will, so umschreitet er ihn von
den Grenzen her. Er gibt jeweils die äußersten Entfernungen an. Damit
ergibt sich das Dazwischenliegende als Ganzes, als klar abgegrenzter
Teil, den man als Einheit überschaut. Ein geräumiges Schlafzimmer wird
iieya/MKEwdfis genannt (P. 2, 33): Großes bergend, Großes umschließend.
Das Umschließen, das Bergen gibt das Maß für den Raum. Aus Vielem
Weniges aussuchen heißt: „die Grenzen des Vielen zusammenziehen in
Kürze"5). Es ist also kein Aussuchen, es ist ein Umspannen von außen
her. So wird auch das Leben als umstecktes Gebiet gefaßt. Seine Grenze
ist der Tod. Sterben ist Schreiten „zur schönen Grenze des schwarzen
Todes"0). Der Sterbliche „kennt nicht die Grenzen seines Todes". Das
bedeutet: er kennt nicht die Dauer seines Lebens. Zeitliche Vorstellungen
setzen sich in klassischen Zeiten mit Vorliebe in räumliche um, da der
Raum gegenüber der Zeit die leichtere Überschaubarkeit hat. Er läßt sich
eher als Ganzes, als Einheit darstellen. So wird das Leben auch ver-
glichen mit einem Laufen nach dem Ziel. Dieses Ziel aber ist nicht ein
bestimmter Lebensinhalt, etwa die bei Homer so ersehnte Behaglichkeit
des Alters, das Ziel ist der Tod. Wir wissen nicht, wann wir es erreichen,
der Tod bleibt aber der Blickpunkt, das Mal am Ende der Rennbahn7).
Apollo „weiß aller Dinge gewisses Ziel und alle Wege"3). Auch hier
wird für das Geschehen und das Wissen um dieses zuerst der Endpunkt
gesetzt als räumliche Überschau. Wenn Achill durch seine Taten vor
Troia den endlichen Fall der Stadt herbeiführt, so „brückt er den Atriden
die Heimkehr"9). Die Heimkehr ist eine Sache, die zeitlich und räumlich
vor sich geht. Der Damm aber — bewußt im Widerspruch zu der Un-
gewißheit der Seefahrt gebraucht — ist ein sehr deutlich räumliches Motiv
und wird nur gewählt, um sofort das Ende, das Ziel nennen zu können.
Pindar hätte auch sagen können: er eröffnete ihnen den Weg zur Heim-
fahrt, aber das wäre nur ein halbes Tun gewesen, eine unfertige Tat.
Daß man eine ganze lange Heimkehr überbrücken, mit seinen Gedan-
ken Hier und Dort, Anfang und Ende zusammenfaßt, die Mitte aber,
das eigentliche Geschehen als unwesentlich ausfallen läßt, das ist klas-
sisch. Fragment 137 heißt es: „Glücklich wer, nachdem er solches schaute,
P 1, 81: noXX&v neigaza avvzavvoaig iv ßga%et.
c) P 11, 56: fii/.avog äv ioyuziäv y.a/Mova 'd-aväzov £0%e.
7) N 6, 6: o-bv. eiöözeg . . . ävziva äg 'iygaipe ögaj.ieiv nozi ozcLftfiav.
8) P 9, 45: xvgiov ög ndvzav zi'Aog ola-day.al näaag •As/.ev-Oovg.
9) I 8, 56 yecpvgaae v 'Azgdöcuai, vöazov.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXVI. 7
97
heller Himmel und eine dunkle Hölle machen noch keinen Rembrandt. Es
ist richtig, zusammengehörige Zeiten zusammen zu sehen, aber dann mit
vollem Gewicht und auf der ganzen Linie, nicht mit einzeln herausgegrif-
fenen Beispielen.
Wenn Pindar einen Raum bezeichnen will, so umschreitet er ihn von
den Grenzen her. Er gibt jeweils die äußersten Entfernungen an. Damit
ergibt sich das Dazwischenliegende als Ganzes, als klar abgegrenzter
Teil, den man als Einheit überschaut. Ein geräumiges Schlafzimmer wird
iieya/MKEwdfis genannt (P. 2, 33): Großes bergend, Großes umschließend.
Das Umschließen, das Bergen gibt das Maß für den Raum. Aus Vielem
Weniges aussuchen heißt: „die Grenzen des Vielen zusammenziehen in
Kürze"5). Es ist also kein Aussuchen, es ist ein Umspannen von außen
her. So wird auch das Leben als umstecktes Gebiet gefaßt. Seine Grenze
ist der Tod. Sterben ist Schreiten „zur schönen Grenze des schwarzen
Todes"0). Der Sterbliche „kennt nicht die Grenzen seines Todes". Das
bedeutet: er kennt nicht die Dauer seines Lebens. Zeitliche Vorstellungen
setzen sich in klassischen Zeiten mit Vorliebe in räumliche um, da der
Raum gegenüber der Zeit die leichtere Überschaubarkeit hat. Er läßt sich
eher als Ganzes, als Einheit darstellen. So wird das Leben auch ver-
glichen mit einem Laufen nach dem Ziel. Dieses Ziel aber ist nicht ein
bestimmter Lebensinhalt, etwa die bei Homer so ersehnte Behaglichkeit
des Alters, das Ziel ist der Tod. Wir wissen nicht, wann wir es erreichen,
der Tod bleibt aber der Blickpunkt, das Mal am Ende der Rennbahn7).
Apollo „weiß aller Dinge gewisses Ziel und alle Wege"3). Auch hier
wird für das Geschehen und das Wissen um dieses zuerst der Endpunkt
gesetzt als räumliche Überschau. Wenn Achill durch seine Taten vor
Troia den endlichen Fall der Stadt herbeiführt, so „brückt er den Atriden
die Heimkehr"9). Die Heimkehr ist eine Sache, die zeitlich und räumlich
vor sich geht. Der Damm aber — bewußt im Widerspruch zu der Un-
gewißheit der Seefahrt gebraucht — ist ein sehr deutlich räumliches Motiv
und wird nur gewählt, um sofort das Ende, das Ziel nennen zu können.
Pindar hätte auch sagen können: er eröffnete ihnen den Weg zur Heim-
fahrt, aber das wäre nur ein halbes Tun gewesen, eine unfertige Tat.
Daß man eine ganze lange Heimkehr überbrücken, mit seinen Gedan-
ken Hier und Dort, Anfang und Ende zusammenfaßt, die Mitte aber,
das eigentliche Geschehen als unwesentlich ausfallen läßt, das ist klas-
sisch. Fragment 137 heißt es: „Glücklich wer, nachdem er solches schaute,
P 1, 81: noXX&v neigaza avvzavvoaig iv ßga%et.
c) P 11, 56: fii/.avog äv ioyuziäv y.a/Mova 'd-aväzov £0%e.
7) N 6, 6: o-bv. eiöözeg . . . ävziva äg 'iygaipe ögaj.ieiv nozi ozcLftfiav.
8) P 9, 45: xvgiov ög ndvzav zi'Aog ola-day.al näaag •As/.ev-Oovg.
9) I 8, 56 yecpvgaae v 'Azgdöcuai, vöazov.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXVI. 7