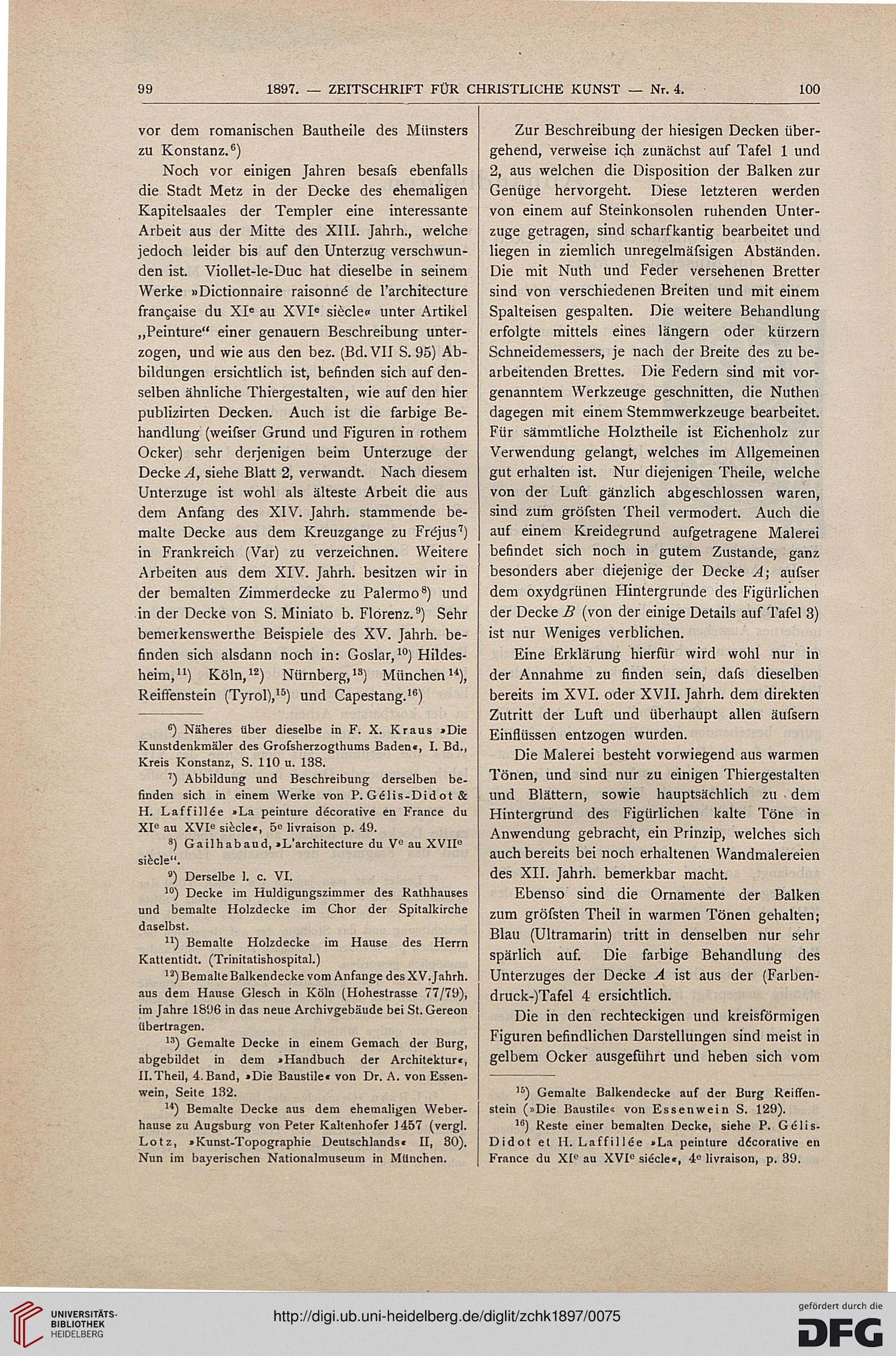99
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
100
vor dem romanischen Bautheile des Münsters
zu Konstanz.6)
Noch vor einigen Jahren besafs ebenfalls
die Stadt Metz in der Decke des ehemaligen
Kapitelsaales der Templer eine interessante
Arbeit aus der Mitte des XIII. Jahrh., welche
jedoch leider bis auf den Unterzug verschwun-
den ist. Viollet-le-Duc hat dieselbe in seinem
Werke »Dictionnaire raisonne" de l'architecture
francaise du XIe au XVIe siecle« unter Artikel
„Peinture" einer genauem Beschreibung unter-
zogen, und wie aus den bez. (Bd. VII S. 95) Ab-
bildungen ersichtlich ist, befinden sich auf den-
selben ähnliche Thiergestalten, wie auf den hier
publizirten Decken. Auch ist die farbige Be-
handlung (weifser Grund und Figuren in rothem
Ocker) sehr derjenigen beim Unterzuge der
Decke A, siehe Blatt 2, verwandt. Nach diesem
Unterzuge ist wohl als älteste Arbeit die aus
dem Anfang des XIV. Jahrh. stammende be-
malte Decke aus dem Kreuzgange zu Frejus7)
in Frankreich (Var) zu verzeichnen. Weitere
Arbeiten aus dem XIV. Jahrh. besitzen wir in
der bemalten Zimmerdecke zu Palermo8) und
in der Decke von S. Miniato b. Florenz.9) Sehr
bemerkenswerthe Beispiele des XV. Jahrh. be-
finden sich alsdann noch in: Goslar,10) Hildes-
heim,11) Köln,12) Nürnberg,18) München14),
Reiffenstein (Tyrol),15) und Capestang.16)
°) Näheres über dieselbe in F. X. Kraus »Die
Kunstdenkmäler des Grofsherzogthums Baden«, I. Bd.,
Kreis Konstanz, S. 110 u. 138.
7) Abbildung und Beschreibung derselben be-
finden sich in einem Werke von P. Gelis-Didot &
H. Laffillee »La peinture decorative en France du
XIe au XVI" siecle«, 5° livraison p. 49.
8) Gailhabaud, »L'architecture du V° au XVII0
siecle".
9) Derselbe 1. c. VI.
10) Decke im Huldigungszimmer des Rathhauses
und bemalte Holzdecke im Chor der Spitalkirche
daselbst.
n) Bemalte Holzdecke im Hause des Herrn
Kattentidt. (Trinitatishospital.)
!3) Bemalte Balkendecke vom Anfange desXV.Jahrh.
aus dem Hause Glesch in Köln (Hohestrasse 77/79),
im Jahre 1896 in das neue Archivgebäude bei St. Gereon
übertragen.
13) Gemalte Decke in einem Gemach der Burg,
abgebildet in dem »Handbuch der Architektur«,
II.Theil, 4.Band, »Die Baustile« von Dr. A. von Essen-
wein, Seite 132.
14) Bemalte Decke aus dem ehemaligen Weber-
hause zu Augsburg von Peter Kaltenhofer 1457 (vergl.
Lotz, »Kunst-Topographie Deutschlands« II, 30).
Nun im bayerischen Nationalmuseum in München.
Zur Beschreibung der hiesigen Decken über-
gehend, verweise ich zunächst auf Tafel 1 und
2, aus welchen die Disposition der Balken zur
Genüge hervorgeht. Diese letzteren werden
von einem auf Steinkonsolen ruhenden Unter-
zuge getragen, sind scharfkantig bearbeitet und
liegen in ziemlich unregelmäfsigen Abständen.
Die mit Nuth und Feder versehenen Bretter
sind von verschiedenen Breiten und mit einem
Spalteisen gespalten. Die weitere Behandlung
erfolgte mittels eines längern oder kürzern
Schneidemessers, je nach der Breite des zu be-
arbeitenden Brettes. Die Federn sind mit vor-
genanntem Werkzeuge geschnitten, die Nuthen
dagegen mit einem Stemmwerkzeuge bearbeitet.
Für sämmtliche Holztheile ist Eichenholz zur
Verwendung gelangt, welches im Allgemeinen
gut erhalten ist. Nur diejenigen Theile, welche
von der Luft gänzlich abgeschlossen waren,
sind zum gröfsten Theil vermodert. Auch die
auf einem Kreidegrund aufgetragene Malerei
befindet sich noch in gutem Zustande, ganz
besonders aber diejenige der Decke A; aufser
dem oxydgrünen Hintergrunde des Figürlichen
der Decke B (von der einige Details auf Tafel 3)
ist nur Weniges verblichen.
Eine Erklärung hierfür wird wohl nur in
der Annahme zu finden sein, dafs dieselben
bereits im XVI. oder XVII. Jahrh. dem direkten
Zutritt der Luft und überhaupt allen äufsern
Einflüssen entzogen wurden.
Die Malerei besteht vorwiegend aus warmen
Tönen, und sind nur zu einigen Thiergestalten
und Blättern, sowie hauptsächlich zu dem
Hintergrund des Figürlichen kalte Töne in
Anwendung gebracht, ein Prinzip, welches sich
auch bereits bei noch erhaltenen Wandmalereien
des XII. Jahrh. bemerkbar macht.
Ebenso sind die Ornamente der Balken
zum gröfsten Theil in warmen Tönen gehalten;
Blau (Ultramarin) tritt in denselben nur sehr
spärlich auf. Die farbige Behandlung des
Unterzuges der Decke A ist aus der (Farben-
druck-)Tafel 4 ersichtlich.
Die in den rechteckigen und kreisförmigen
Figuren befindlichen Darstellungen sind meist in
gelbem Ocker ausgeführt und heben sich vom
,5) Gemalte Balkendecke auf der Burg ReifTen-
stein (»Die Baustile« von Essenwein S. 129).
16) Reste einer bemalten Decke, siehe P. Gelis-
Didot et II. Laffille"e »La peinture decorative en
France du XI0 au XVI0 siecle«, 4° livraison, p. 39.
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
100
vor dem romanischen Bautheile des Münsters
zu Konstanz.6)
Noch vor einigen Jahren besafs ebenfalls
die Stadt Metz in der Decke des ehemaligen
Kapitelsaales der Templer eine interessante
Arbeit aus der Mitte des XIII. Jahrh., welche
jedoch leider bis auf den Unterzug verschwun-
den ist. Viollet-le-Duc hat dieselbe in seinem
Werke »Dictionnaire raisonne" de l'architecture
francaise du XIe au XVIe siecle« unter Artikel
„Peinture" einer genauem Beschreibung unter-
zogen, und wie aus den bez. (Bd. VII S. 95) Ab-
bildungen ersichtlich ist, befinden sich auf den-
selben ähnliche Thiergestalten, wie auf den hier
publizirten Decken. Auch ist die farbige Be-
handlung (weifser Grund und Figuren in rothem
Ocker) sehr derjenigen beim Unterzuge der
Decke A, siehe Blatt 2, verwandt. Nach diesem
Unterzuge ist wohl als älteste Arbeit die aus
dem Anfang des XIV. Jahrh. stammende be-
malte Decke aus dem Kreuzgange zu Frejus7)
in Frankreich (Var) zu verzeichnen. Weitere
Arbeiten aus dem XIV. Jahrh. besitzen wir in
der bemalten Zimmerdecke zu Palermo8) und
in der Decke von S. Miniato b. Florenz.9) Sehr
bemerkenswerthe Beispiele des XV. Jahrh. be-
finden sich alsdann noch in: Goslar,10) Hildes-
heim,11) Köln,12) Nürnberg,18) München14),
Reiffenstein (Tyrol),15) und Capestang.16)
°) Näheres über dieselbe in F. X. Kraus »Die
Kunstdenkmäler des Grofsherzogthums Baden«, I. Bd.,
Kreis Konstanz, S. 110 u. 138.
7) Abbildung und Beschreibung derselben be-
finden sich in einem Werke von P. Gelis-Didot &
H. Laffillee »La peinture decorative en France du
XIe au XVI" siecle«, 5° livraison p. 49.
8) Gailhabaud, »L'architecture du V° au XVII0
siecle".
9) Derselbe 1. c. VI.
10) Decke im Huldigungszimmer des Rathhauses
und bemalte Holzdecke im Chor der Spitalkirche
daselbst.
n) Bemalte Holzdecke im Hause des Herrn
Kattentidt. (Trinitatishospital.)
!3) Bemalte Balkendecke vom Anfange desXV.Jahrh.
aus dem Hause Glesch in Köln (Hohestrasse 77/79),
im Jahre 1896 in das neue Archivgebäude bei St. Gereon
übertragen.
13) Gemalte Decke in einem Gemach der Burg,
abgebildet in dem »Handbuch der Architektur«,
II.Theil, 4.Band, »Die Baustile« von Dr. A. von Essen-
wein, Seite 132.
14) Bemalte Decke aus dem ehemaligen Weber-
hause zu Augsburg von Peter Kaltenhofer 1457 (vergl.
Lotz, »Kunst-Topographie Deutschlands« II, 30).
Nun im bayerischen Nationalmuseum in München.
Zur Beschreibung der hiesigen Decken über-
gehend, verweise ich zunächst auf Tafel 1 und
2, aus welchen die Disposition der Balken zur
Genüge hervorgeht. Diese letzteren werden
von einem auf Steinkonsolen ruhenden Unter-
zuge getragen, sind scharfkantig bearbeitet und
liegen in ziemlich unregelmäfsigen Abständen.
Die mit Nuth und Feder versehenen Bretter
sind von verschiedenen Breiten und mit einem
Spalteisen gespalten. Die weitere Behandlung
erfolgte mittels eines längern oder kürzern
Schneidemessers, je nach der Breite des zu be-
arbeitenden Brettes. Die Federn sind mit vor-
genanntem Werkzeuge geschnitten, die Nuthen
dagegen mit einem Stemmwerkzeuge bearbeitet.
Für sämmtliche Holztheile ist Eichenholz zur
Verwendung gelangt, welches im Allgemeinen
gut erhalten ist. Nur diejenigen Theile, welche
von der Luft gänzlich abgeschlossen waren,
sind zum gröfsten Theil vermodert. Auch die
auf einem Kreidegrund aufgetragene Malerei
befindet sich noch in gutem Zustande, ganz
besonders aber diejenige der Decke A; aufser
dem oxydgrünen Hintergrunde des Figürlichen
der Decke B (von der einige Details auf Tafel 3)
ist nur Weniges verblichen.
Eine Erklärung hierfür wird wohl nur in
der Annahme zu finden sein, dafs dieselben
bereits im XVI. oder XVII. Jahrh. dem direkten
Zutritt der Luft und überhaupt allen äufsern
Einflüssen entzogen wurden.
Die Malerei besteht vorwiegend aus warmen
Tönen, und sind nur zu einigen Thiergestalten
und Blättern, sowie hauptsächlich zu dem
Hintergrund des Figürlichen kalte Töne in
Anwendung gebracht, ein Prinzip, welches sich
auch bereits bei noch erhaltenen Wandmalereien
des XII. Jahrh. bemerkbar macht.
Ebenso sind die Ornamente der Balken
zum gröfsten Theil in warmen Tönen gehalten;
Blau (Ultramarin) tritt in denselben nur sehr
spärlich auf. Die farbige Behandlung des
Unterzuges der Decke A ist aus der (Farben-
druck-)Tafel 4 ersichtlich.
Die in den rechteckigen und kreisförmigen
Figuren befindlichen Darstellungen sind meist in
gelbem Ocker ausgeführt und heben sich vom
,5) Gemalte Balkendecke auf der Burg ReifTen-
stein (»Die Baustile« von Essenwein S. 129).
16) Reste einer bemalten Decke, siehe P. Gelis-
Didot et II. Laffille"e »La peinture decorative en
France du XI0 au XVI0 siecle«, 4° livraison, p. 39.