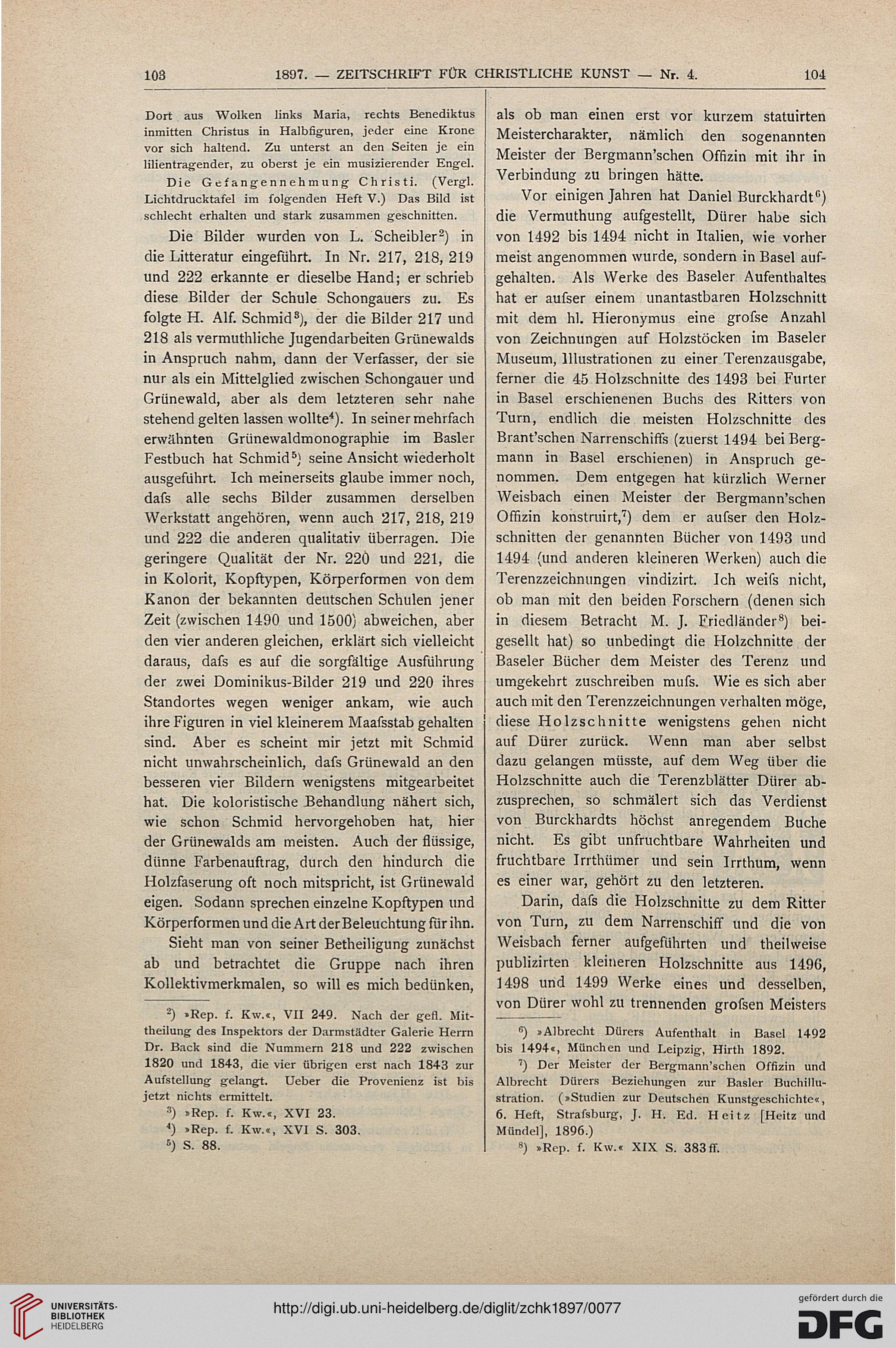103
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST _ Nr. 4.
104
Dort aus Wolken links Maria, rechts Benediktus
inmitten Christus in Halbfiguren, jeder eine Krone
vor sich haltend. Zu unterst an den Seiten je ein
lilientragender, zu oberst je ein musizierender Engel.
Die Gerangennehmung Christi. (Vergl.
Lichtdrucktafel im folgenden Heft V.) Das Bild ist
schlecht erhalten und stark zusammen geschnitten.
Die Bilder wurden von L. Scheibler2) in
die Litteratur eingeführt. In Nr. 217, 218, 219
und 222 erkannte er dieselbe Hand; er schrieb
diese Bilder der Schule Schongauers zu. Es
folgte H. Alf. Schmid8), der die Bilder 217 und
218 als vermuthliche Jugendarbeiten Grünewalds
in Anspruch nahm, dann der Verfasser, der sie
nur als ein Mittelglied zwischen Schongauer und
Grünewald, aber als dem letzteren sehr nahe
stehend gelten lassen wollte4). In seiner mehrfach
erwähnten Grünewaldmonographie im Basler
Festbuch hat Schmid5) seine Ansicht wiederholt
ausgeführt. Ich meinerseits glaube immer noch,
dafs alle sechs Bilder zusammen derselben
Werkstatt angehören, wenn auch 217, 218, 219
und 222 die anderen qualitativ überragen. Die
geringere Qualität der Nr. 220 und 221, die
in Kolorit, Kopftypen, Körperformen von dem
Kanon der bekannten deutschen Schulen jener
Zeit (zwischen 1490 und 1500) abweichen, aber
den vier anderen gleichen, erklärt sich vielleicht
daraus, dafs es auf die sorgfältige Ausführung
der zwei Dominikus-Bilder 219 und 220 ihres
Standortes wegen weniger ankam, wie auch
ihre Figuren in viel kleinerem Maafsstab gehalten
sind. Aber es scheint mir jetzt mit Schmid
nicht unwahrscheinlich, dafs Grünewald an den
besseren vier Bildern wenigstens mitgearbeitet
hat. Die koloristische Behandlung nähert sich,
wie schon Schmid hervorgehoben hat, hier
der Grünewalds am meisten. Auch der flüssige,
dünne Farbenauftrag, durch den hindurch die
Holzfaserung oft noch mitspricht, ist Grünewald
eigen. Sodann sprechen einzelne Kopftypen und
Körperformen und die Art derBeleuchtung für ihn.
Sieht man von seiner Betheiligung zunächst
ab und betrachtet die Gruppe nach ihren
Kollektivmerkmalen, so will es mich bedünken,
2) »Rep. f. Kw.c, VII 249. Nach der gefi. Mit-
theilung des Inspektors der Darmstädter Galerie Herrn
Dr. Back sind die Nummern 218 und 222 zwischen
1820 und 1843, die vier übrigen erst nach 1843 zur
Aufstellung gelangt. Ueber die Provenienz ist bis
jetzt nichts ermittelt.
*) »Rep. f. Kw.., XVI 23.
4) >Rep. f. Kw.«, XVI S. 303.
6) S. 88.
als ob man einen erst vor kurzem statuirten
Meistercharakter, nämlich den sogenannten
Meister der Bergmann'schen Offizin mit ihr in
Verbindung zu bringen hätte.
Vor einigen Jahren hat Daniel Burckhardt")
die Vermuthung aufgestellt, Dürer habe sich
von 1492 bis 1494 nicht in Italien, wie vorher
meist angenommen wurde, sondern in Basel auf-
gehalten. Als Werke des Baseler Aufenthaltes
hat er aufser einem unantastbaren Holzschnitt
mit dem hl. Hieronymus eine grofse Anzahl
von Zeichnungen auf Holzstöcken im Baseler
Museum, Illustrationen zu einer Terenzausgabe,
ferner die 45 Holzschnitte des 1493 bei Furter
in Basel erschienenen Buchs des Ritters von
Turn, endlich die meisten Holzschnitte des
Brant'schen Narrenschiffs (zuerst 1494 bei Berg-
mann in Basel erschienen) in Anspruch ge-
nommen. Dem entgegen hat kürzlich Werner
Weisbach einen Meister der Bergmann'schen
Offizin konstruirt,7) dem er aufser den Holz-
schnitten der genannten Bücher von 1493 und
1494 (und anderen kleineren Werken) auch die
Terenzzeichnungen vindizirt. Ich weifs nicht,
ob man mit den beiden Forschern (denen sich
in diesem Betracht M. J. Friedländer8) bei-
gesellt hat) so unbedingt die Holzchnitte der
Baseler Bücher dem Meister des Terenz und
umgekehrt zuschreiben mufs. Wie es sich aber
auch mit den Terenzzeichnungen verhalten möge,
diese Holzschnitte wenigstens gehen nicht
auf Dürer zurück. Wenn man aber selbst
dazu gelangen müsste, auf dem Weg über die
Holzschnitte auch die Terenzblätter Dürer ab-
zusprechen, so schmälert sich das Verdienst
von Burckhardts höchst anregendem Buche
nicht. Es gibt unfruchtbare Wahrheiten und
fruchtbare Irrthürner und sein Irrfhum, wenn
es einer war, gehört zu den letzteren.
Darin, dafs die Holzschnitte zu dem Ritter
von Turn, zu dem Narrenschiff und die von
Weisbach ferner aufgeführten und theilweise
publizirten kleineren Holzschnitte aus 1496,
1498 und 1499 Werke eines und desselben,
von Dürer wohl zu trennenden grofsen Meisters
c) »Albrecht Dürers Aufenthalt in Basel 1492
bis 1494«, München und Leipzig, Hirth 1892.
7) Der Meister der Bergmann'schen Offizin und
Albrecht Dürers Beziehungen zur Basler Buchillu-
stration. (»Studien zur Deutschen Kunstgeschichte«,
6. Heft, Strafsburg, J. H. Ed. Heitz [Heitz und
Mündel], 1896.)
8) »Rep. f. Kw.« XIX S. 383ff.
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST _ Nr. 4.
104
Dort aus Wolken links Maria, rechts Benediktus
inmitten Christus in Halbfiguren, jeder eine Krone
vor sich haltend. Zu unterst an den Seiten je ein
lilientragender, zu oberst je ein musizierender Engel.
Die Gerangennehmung Christi. (Vergl.
Lichtdrucktafel im folgenden Heft V.) Das Bild ist
schlecht erhalten und stark zusammen geschnitten.
Die Bilder wurden von L. Scheibler2) in
die Litteratur eingeführt. In Nr. 217, 218, 219
und 222 erkannte er dieselbe Hand; er schrieb
diese Bilder der Schule Schongauers zu. Es
folgte H. Alf. Schmid8), der die Bilder 217 und
218 als vermuthliche Jugendarbeiten Grünewalds
in Anspruch nahm, dann der Verfasser, der sie
nur als ein Mittelglied zwischen Schongauer und
Grünewald, aber als dem letzteren sehr nahe
stehend gelten lassen wollte4). In seiner mehrfach
erwähnten Grünewaldmonographie im Basler
Festbuch hat Schmid5) seine Ansicht wiederholt
ausgeführt. Ich meinerseits glaube immer noch,
dafs alle sechs Bilder zusammen derselben
Werkstatt angehören, wenn auch 217, 218, 219
und 222 die anderen qualitativ überragen. Die
geringere Qualität der Nr. 220 und 221, die
in Kolorit, Kopftypen, Körperformen von dem
Kanon der bekannten deutschen Schulen jener
Zeit (zwischen 1490 und 1500) abweichen, aber
den vier anderen gleichen, erklärt sich vielleicht
daraus, dafs es auf die sorgfältige Ausführung
der zwei Dominikus-Bilder 219 und 220 ihres
Standortes wegen weniger ankam, wie auch
ihre Figuren in viel kleinerem Maafsstab gehalten
sind. Aber es scheint mir jetzt mit Schmid
nicht unwahrscheinlich, dafs Grünewald an den
besseren vier Bildern wenigstens mitgearbeitet
hat. Die koloristische Behandlung nähert sich,
wie schon Schmid hervorgehoben hat, hier
der Grünewalds am meisten. Auch der flüssige,
dünne Farbenauftrag, durch den hindurch die
Holzfaserung oft noch mitspricht, ist Grünewald
eigen. Sodann sprechen einzelne Kopftypen und
Körperformen und die Art derBeleuchtung für ihn.
Sieht man von seiner Betheiligung zunächst
ab und betrachtet die Gruppe nach ihren
Kollektivmerkmalen, so will es mich bedünken,
2) »Rep. f. Kw.c, VII 249. Nach der gefi. Mit-
theilung des Inspektors der Darmstädter Galerie Herrn
Dr. Back sind die Nummern 218 und 222 zwischen
1820 und 1843, die vier übrigen erst nach 1843 zur
Aufstellung gelangt. Ueber die Provenienz ist bis
jetzt nichts ermittelt.
*) »Rep. f. Kw.., XVI 23.
4) >Rep. f. Kw.«, XVI S. 303.
6) S. 88.
als ob man einen erst vor kurzem statuirten
Meistercharakter, nämlich den sogenannten
Meister der Bergmann'schen Offizin mit ihr in
Verbindung zu bringen hätte.
Vor einigen Jahren hat Daniel Burckhardt")
die Vermuthung aufgestellt, Dürer habe sich
von 1492 bis 1494 nicht in Italien, wie vorher
meist angenommen wurde, sondern in Basel auf-
gehalten. Als Werke des Baseler Aufenthaltes
hat er aufser einem unantastbaren Holzschnitt
mit dem hl. Hieronymus eine grofse Anzahl
von Zeichnungen auf Holzstöcken im Baseler
Museum, Illustrationen zu einer Terenzausgabe,
ferner die 45 Holzschnitte des 1493 bei Furter
in Basel erschienenen Buchs des Ritters von
Turn, endlich die meisten Holzschnitte des
Brant'schen Narrenschiffs (zuerst 1494 bei Berg-
mann in Basel erschienen) in Anspruch ge-
nommen. Dem entgegen hat kürzlich Werner
Weisbach einen Meister der Bergmann'schen
Offizin konstruirt,7) dem er aufser den Holz-
schnitten der genannten Bücher von 1493 und
1494 (und anderen kleineren Werken) auch die
Terenzzeichnungen vindizirt. Ich weifs nicht,
ob man mit den beiden Forschern (denen sich
in diesem Betracht M. J. Friedländer8) bei-
gesellt hat) so unbedingt die Holzchnitte der
Baseler Bücher dem Meister des Terenz und
umgekehrt zuschreiben mufs. Wie es sich aber
auch mit den Terenzzeichnungen verhalten möge,
diese Holzschnitte wenigstens gehen nicht
auf Dürer zurück. Wenn man aber selbst
dazu gelangen müsste, auf dem Weg über die
Holzschnitte auch die Terenzblätter Dürer ab-
zusprechen, so schmälert sich das Verdienst
von Burckhardts höchst anregendem Buche
nicht. Es gibt unfruchtbare Wahrheiten und
fruchtbare Irrthürner und sein Irrfhum, wenn
es einer war, gehört zu den letzteren.
Darin, dafs die Holzschnitte zu dem Ritter
von Turn, zu dem Narrenschiff und die von
Weisbach ferner aufgeführten und theilweise
publizirten kleineren Holzschnitte aus 1496,
1498 und 1499 Werke eines und desselben,
von Dürer wohl zu trennenden grofsen Meisters
c) »Albrecht Dürers Aufenthalt in Basel 1492
bis 1494«, München und Leipzig, Hirth 1892.
7) Der Meister der Bergmann'schen Offizin und
Albrecht Dürers Beziehungen zur Basler Buchillu-
stration. (»Studien zur Deutschen Kunstgeschichte«,
6. Heft, Strafsburg, J. H. Ed. Heitz [Heitz und
Mündel], 1896.)
8) »Rep. f. Kw.« XIX S. 383ff.