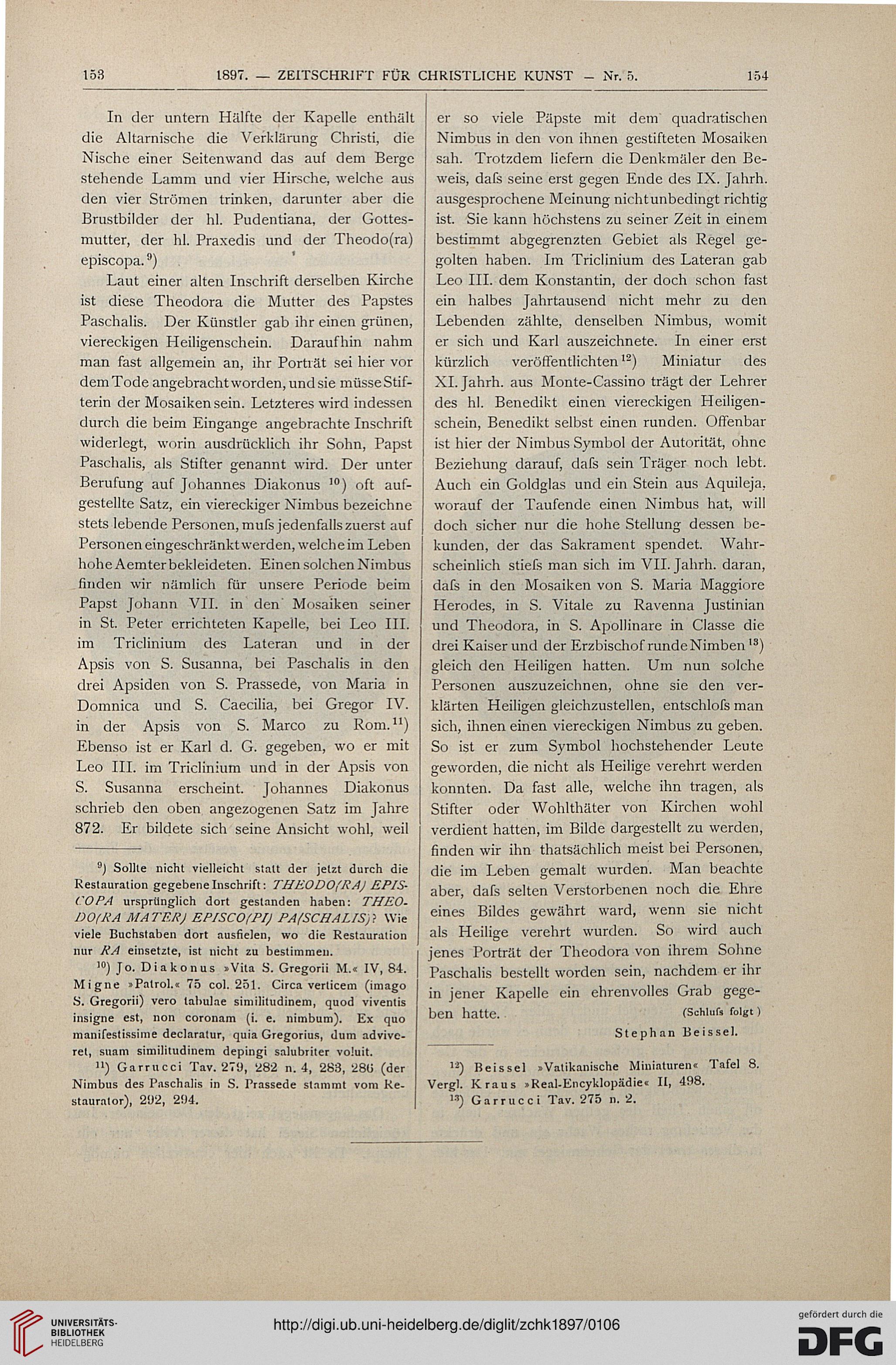153
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 5.
154
In der untern Hälfte der Kapelle enthält
die Altarnische die Verklärung Christi, die
Nische einer Seitenwand das auf dem Berge
stehende Lamm und vier Hirsche, welche aus
den vier Strömen trinken, darunter aber die
Brustbilder der hl. Pudentiana, der Gottes-
mutter, der hl. Praxedis und der Theodo(ra)
episcopa.9)
Laut einer alten Inschrift derselben Kirche
ist diese Theodora die Mutter des Papstes
Paschalis. Der Künstler gab ihr einen grünen,
viereckigen Heiligenschein. Daraufhin nahm
man fast allgemein an, ihr Porträt sei hier vor
dem Tode angebracht worden, und sie müsse Stif-
terin der Mosaiken sein. Letzteres wird indessen
durch die beim Eingange angebrachte Inschrift
widerlegt, worin ausdrücklich ihr Sohn, Papst
Paschalis, als Stifter genannt wird. Der unter
Berufung auf Johannes Diakonus 10) oft auf-
gestellte Satz, ein viereckiger Nimbus bezeichne
stets lebende Personen, mufs jedenfalls zuerst auf
Personen eingeschränkt werden, welche im Leben
hoheAemterbekleideten. EinensolchenNimbus
finden wir nämlich für unsere Periode beim
Papst Johann VII. in den' Mosaiken seiner
in St. Peter errichteten Kapeile, bei Leo III.
im Triclinium des Lateran und in der
Apsis von S. Susanna, bei Paschalis in den
drei Apsiden von S. Prassede, von Maria in
Domnica und S. Caecilia, bei Gregor IV.
in der Apsis von S. Marco zu Rom.11)
Ebenso ist er Karl d. G. gegeben, wo er mit
Leo III. im Triclinium und in der Apsis von
S. Susanna erscheint. Johannes Diakonus
schrieb den oben angezogenen Satz im Jahre
872. Er bildete sich seine Ansicht wohl, weil
9J Sollte nicht vielleicht statt der jetzt durch die
Restauration gegebene Inschrift: THEODO(RA) EPIS-
COPA ursprünglich dort gestanden haben: THEO-
DO(KA MATER) EPISCO(PI) PAfSCHALIS)} Wie
viele Buchstaben dort ausfielen, wo die Restauration
nur RA einsetzte, ist nicht zu bestimmen.
,0) Jo. Diakonus »Vita S. Gregorii M.« IV, 84.
Migne »Patrol.« 75 col. 251. Circa verticem (imago
S. Gregorii) vero tabulae similitudinem, quod viventis
insigne est, non coronam (i. e. nimbum). Ex quo
manifestissime declaratur, quia Gregorius, dum advive-
ret, suam similitudinem depingi salubriter voluit.
») Garrucci Tav. 279, 282 n. 4, 283, 28G (der
Nimbus des Paschalis in S. Prassede stammt vom Re-
staurator), 292, 294.
er so viele Päpste mit dem quadratischen
Nimbus in den von ihnen gestifteten Mosaiken
sah. Trotzdem liefern die Denkmäler den Be-
weis, dafs seine erst gegen Ende des IX. Jahrh.
ausgesprochene Meinung nicht unbedingt richtig
ist. Sie kann höchstens zu seiner Zeit in einem
bestimmt abgegrenzten Gebiet als Regel ge-
golten haben. Im Triclinium des Lateran gab
Leo III. dem Konstantin, der doch schon fast
ein halbes Jahrtausend nicht mehr zu den
Lebenden zählte, denselben Nimbus, womit
er sich und Karl auszeichnete. In einer erst
kürzlich veröffentlichten12) Miniatur des
XL Jahrh. aus Monte-Cassino trägt der Lehrer
des hl. Benedikt einen viereckigen Heiligen-
schein, Benedikt selbst einen runden. Offenbar
ist hier der Nimbus Symbol der Autorität, ohne
Beziehung darauf, dafs sein Träger noch lebt.
Auch ein Goldglas und ein Stein aus Aquileja,
worauf der Taufende einen Nimbus hat, will
doch sicher nur die hohe Stellung dessen be-
kunden, der das Sakrament spendet. Wahr-
scheinlich stiefs man sich im VII. Jahrh. daran,
dafs in den Mosaiken von S. Maria Maggiore
Herodes, in S. Vitale zu Ravenna Justinian
und Theodora, in S. Apollinare in Classe die
drei Kaiser und der Erzbischof runde Nimben13)
gleich den Heiligen hatten. Um nun solche
Personen auszuzeichnen, ohne sie den ver-
klärten Heiligen gleichzustellen, entschlofs man
sich, ihnen einen viereckigen Nimbus zu geben.
So ist er zum Symbol hochstehender Leute
geworden, die nicht als Heilige verehrt werden
konnten. Da fast alle, welche ihn tragen, als
Stifter oder Wohlthäter von Kirchen wohl
verdient hatten, im Bilde dargestellt zu werden,
finden wir ihn thatsächlich meist bei Personen,
die im Leben gemalt wurden. Man beachte
aber, dafs selten Verstorbenen noch die Ehre
eines Bildes gewährt ward, wenn sie nicht
als Heilige verehrt wurden. So wird auch
jenes Porträt der Theodora von ihrem Sohne
Paschalis bestellt worden sein, nachdem er ihr
in jener Kapelle ein ehrenvolles Grab gege-
ben hatte.. (Schlufs folgt)
Stephan Beisse].
u) Beissel »Vatikanische Miniaturen« Tafel 8.
Vergl. Kraus »Real-Encyklopädie« II, 498.
") Garrucci Tav. 275 n. 2.
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 5.
154
In der untern Hälfte der Kapelle enthält
die Altarnische die Verklärung Christi, die
Nische einer Seitenwand das auf dem Berge
stehende Lamm und vier Hirsche, welche aus
den vier Strömen trinken, darunter aber die
Brustbilder der hl. Pudentiana, der Gottes-
mutter, der hl. Praxedis und der Theodo(ra)
episcopa.9)
Laut einer alten Inschrift derselben Kirche
ist diese Theodora die Mutter des Papstes
Paschalis. Der Künstler gab ihr einen grünen,
viereckigen Heiligenschein. Daraufhin nahm
man fast allgemein an, ihr Porträt sei hier vor
dem Tode angebracht worden, und sie müsse Stif-
terin der Mosaiken sein. Letzteres wird indessen
durch die beim Eingange angebrachte Inschrift
widerlegt, worin ausdrücklich ihr Sohn, Papst
Paschalis, als Stifter genannt wird. Der unter
Berufung auf Johannes Diakonus 10) oft auf-
gestellte Satz, ein viereckiger Nimbus bezeichne
stets lebende Personen, mufs jedenfalls zuerst auf
Personen eingeschränkt werden, welche im Leben
hoheAemterbekleideten. EinensolchenNimbus
finden wir nämlich für unsere Periode beim
Papst Johann VII. in den' Mosaiken seiner
in St. Peter errichteten Kapeile, bei Leo III.
im Triclinium des Lateran und in der
Apsis von S. Susanna, bei Paschalis in den
drei Apsiden von S. Prassede, von Maria in
Domnica und S. Caecilia, bei Gregor IV.
in der Apsis von S. Marco zu Rom.11)
Ebenso ist er Karl d. G. gegeben, wo er mit
Leo III. im Triclinium und in der Apsis von
S. Susanna erscheint. Johannes Diakonus
schrieb den oben angezogenen Satz im Jahre
872. Er bildete sich seine Ansicht wohl, weil
9J Sollte nicht vielleicht statt der jetzt durch die
Restauration gegebene Inschrift: THEODO(RA) EPIS-
COPA ursprünglich dort gestanden haben: THEO-
DO(KA MATER) EPISCO(PI) PAfSCHALIS)} Wie
viele Buchstaben dort ausfielen, wo die Restauration
nur RA einsetzte, ist nicht zu bestimmen.
,0) Jo. Diakonus »Vita S. Gregorii M.« IV, 84.
Migne »Patrol.« 75 col. 251. Circa verticem (imago
S. Gregorii) vero tabulae similitudinem, quod viventis
insigne est, non coronam (i. e. nimbum). Ex quo
manifestissime declaratur, quia Gregorius, dum advive-
ret, suam similitudinem depingi salubriter voluit.
») Garrucci Tav. 279, 282 n. 4, 283, 28G (der
Nimbus des Paschalis in S. Prassede stammt vom Re-
staurator), 292, 294.
er so viele Päpste mit dem quadratischen
Nimbus in den von ihnen gestifteten Mosaiken
sah. Trotzdem liefern die Denkmäler den Be-
weis, dafs seine erst gegen Ende des IX. Jahrh.
ausgesprochene Meinung nicht unbedingt richtig
ist. Sie kann höchstens zu seiner Zeit in einem
bestimmt abgegrenzten Gebiet als Regel ge-
golten haben. Im Triclinium des Lateran gab
Leo III. dem Konstantin, der doch schon fast
ein halbes Jahrtausend nicht mehr zu den
Lebenden zählte, denselben Nimbus, womit
er sich und Karl auszeichnete. In einer erst
kürzlich veröffentlichten12) Miniatur des
XL Jahrh. aus Monte-Cassino trägt der Lehrer
des hl. Benedikt einen viereckigen Heiligen-
schein, Benedikt selbst einen runden. Offenbar
ist hier der Nimbus Symbol der Autorität, ohne
Beziehung darauf, dafs sein Träger noch lebt.
Auch ein Goldglas und ein Stein aus Aquileja,
worauf der Taufende einen Nimbus hat, will
doch sicher nur die hohe Stellung dessen be-
kunden, der das Sakrament spendet. Wahr-
scheinlich stiefs man sich im VII. Jahrh. daran,
dafs in den Mosaiken von S. Maria Maggiore
Herodes, in S. Vitale zu Ravenna Justinian
und Theodora, in S. Apollinare in Classe die
drei Kaiser und der Erzbischof runde Nimben13)
gleich den Heiligen hatten. Um nun solche
Personen auszuzeichnen, ohne sie den ver-
klärten Heiligen gleichzustellen, entschlofs man
sich, ihnen einen viereckigen Nimbus zu geben.
So ist er zum Symbol hochstehender Leute
geworden, die nicht als Heilige verehrt werden
konnten. Da fast alle, welche ihn tragen, als
Stifter oder Wohlthäter von Kirchen wohl
verdient hatten, im Bilde dargestellt zu werden,
finden wir ihn thatsächlich meist bei Personen,
die im Leben gemalt wurden. Man beachte
aber, dafs selten Verstorbenen noch die Ehre
eines Bildes gewährt ward, wenn sie nicht
als Heilige verehrt wurden. So wird auch
jenes Porträt der Theodora von ihrem Sohne
Paschalis bestellt worden sein, nachdem er ihr
in jener Kapelle ein ehrenvolles Grab gege-
ben hatte.. (Schlufs folgt)
Stephan Beisse].
u) Beissel »Vatikanische Miniaturen« Tafel 8.
Vergl. Kraus »Real-Encyklopädie« II, 498.
") Garrucci Tav. 275 n. 2.