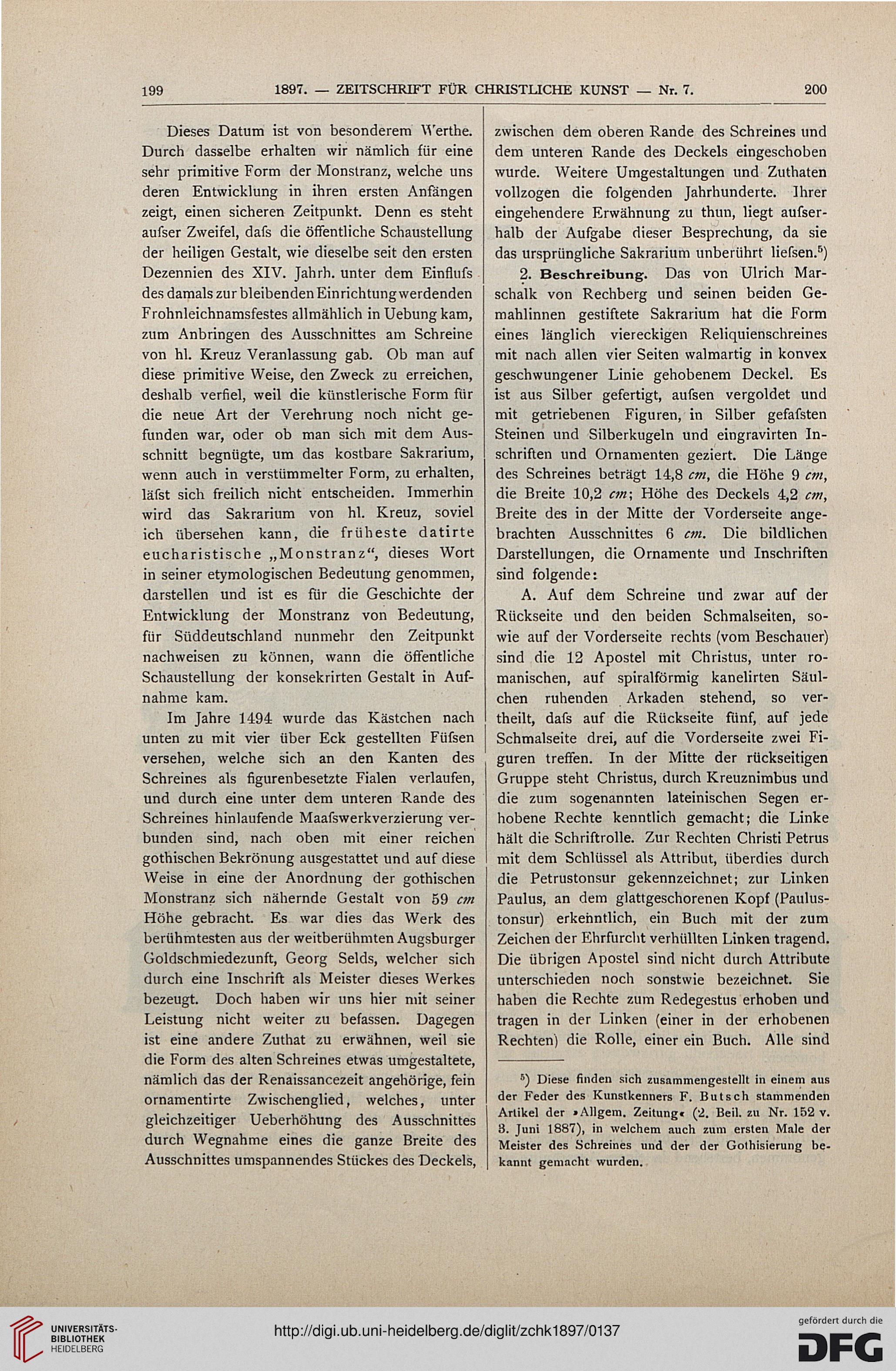199
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
200
Dieses Datum ist von besonderem Werthe.
Durch dasselbe erhalten wir nämlich für eine
sehr primitive Form der Monstranz, welche uns
deren Entwicklung in ihren ersten Anfängen
zeigt, einen sicheren Zeitpunkt. Denn es steht
aufser Zweifel, dafs die öffentliche Schaustellung
der heiligen Gestalt, wie dieselbe seit den ersten
Dezennien des XIV. Jahrh. unter dem Einflufs
des damals zur bleibenden Einrichtung werdenden
Frohnleichnamsfestes allmählich in Uebung kam,
zum Anbringen des Ausschnittes am Schreine
von hl. Kreuz Veranlassung gab. Ob man auf
diese primitive Weise, den Zweck zu erreichen,
deshalb verfiel, weil die künstlerische Form für
die neue Art der Verehrung noch nicht ge-
funden war, oder ob man sich mit dem Aus-
schnitt begnügte, um das kostbare Sakrarium,
wenn auch in verstümmelter Form, zu erhalten,
läfst sich freilich nicht entscheiden. Immerhin
wird das Sakrarium von hl. Kreuz, soviel
ich übersehen kann, die früheste datirte
eucharistische „Monstranz", dieses Wort
in seiner etymologischen Bedeutung genommen,
darstellen und ist es für die Geschichte der
Entwicklung der Monstranz von Bedeutung,
für Süddeutschland nunmehr den Zeitpunkt
nachweisen zu können, wann die öffentliche
Schaustellung der konsekrirten Gestalt in Auf-
nahme kam.
Im Jahre 1494 wurde das Kästchen nach
unten zu mit vier über Eck gestellten Füfsen
versehen, welche sich an den Kanten des
Schreines als figurenbesetzte Fialen verlaufen,
und durch eine unter dem unteren Rande des
Schreines hinlaufende Maafswerkverzierung ver-
bunden sind, nach oben mit einer reichen
gothischen Bekrönung ausgestattet und auf diese
Weise in eine der Anordnung der gothischen
Monstranz sich nähernde Gestalt von 59 cm
Höhe gebracht. Es war dies das Werk des
berühmtesten aus der weitberühmten Augsburger
Goldschmiedezunft, Georg Selds, welcher sich
durch eine Inschrift als Meister dieses Werkes
bezeugt. Doch haben wir uns hier mit seiner
Leistung nicht weiter zu befassen. Dagegen
ist eine andere Zuthat zu erwähnen, weil sie
die Form des alten Schreines etwas umgestaltete,
nämlich das der Renaissancezeit angehörige, fein
ornamentirte Zwischenglied, welches, unter
gleichzeitiger Ueberhöhung des Ausschnittes
durch Wegnahme eines die ganze Breite des
Ausschnittes umspannendes Stückes des Deckels,
zwischen dem oberen Rande des Schreines und
dem unteren Rande des Deckels eingeschoben
wurde. Weitere Umgestaltungen und Zuthaten
vollzogen die folgenden Jahrhunderte. Ihrer
eingehendere Erwähnung zu thun, liegt aufser-
halb der Aufgabe dieser Besprechung, da sie
das ursprüngliche Sakrarium unberührt liefsen.5)
2. Beschreibung. Das von Ulrich Mar-
schalk von Rechberg und seinen beiden Ge-
mahlinnen gestiftete Sakrarium hat die Form
eines länglich viereckigen Reliquienschreines
mit nach allen vier Seiten walmartig in konvex
geschwungener Linie gehobenem Deckel. Es
ist aus Silber gefertigt, aufsen vergoldet und
mit getriebenen Figuren, in Silber gefafsten
Steinen und Silberkugeln und eingravirten In-
schriften und Ornamenten geziert. Die Länge
des Schreines beträgt 14,8 cm, die Höhe 9 cm,
die Breite 10,2 cm; Höhe des Deckels 4,2 cm,
Breite des in der Mitte der Vorderseite ange-
brachten Ausschnittes 6 cm. Die bildlichen
Darstellungen, die Ornamente und Inschriften
sind folgende:
A. Auf dem Schreine und zwar auf der
Rückseite und den beiden Schmalseiten, so-
wie auf der Vorderseite rechts (vom Beschauer)
sind die 12 Apostel mit Christus, unter ro-
manischen, auf spiralförmig kanelirten Säul-
chen ruhenden Arkaden stehend, so ver-
theilt, dafs auf die Rückseite fünf, auf jede
Schmalseite drei, auf die Vorderseite zwei Fi-
guren treffen. In der Mitte der rückseitigen
Gruppe steht Christus, durch Kreuznimbus und
die zum sogenannten lateinischen Segen er-
hobene Rechte kenntlich gemacht; die Linke
hält die Schriftrolle. Zur Rechten Christi Petrus
mit dem Schlüssel als Attribut, überdies durch
die Petrustonsur gekennzeichnet; zur Linken
Paulus, an dem glattgeschorenen Kopf (Paulus-
tonsur) erkenntlich, ein Buch mit der zum
Zeichen der Ehrfurcht verhüllten Linken tragend.
Die übrigen Apostel sind nicht durch Attribute
unterschieden noch sonstwie bezeichnet. Sie
haben die Rechte zum Redegestus erhoben und
tragen in der Linken (einer in der erhobenen
Rechten) die Rolle, einer ein Buch. Alle sind
5) Diese finden sich zusammengestellt in einem aus
der Feder des Kunstkenners F. Butsch stammenden
Artikel der «Allgem. Zeitung« (2. Beil. zu Nr. 152 v.
3. Juni 1887), in welchem auch zum ersten Male der
Meister des Schreines und der der Gothisierung be-
kannt gemacht wurden.
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
200
Dieses Datum ist von besonderem Werthe.
Durch dasselbe erhalten wir nämlich für eine
sehr primitive Form der Monstranz, welche uns
deren Entwicklung in ihren ersten Anfängen
zeigt, einen sicheren Zeitpunkt. Denn es steht
aufser Zweifel, dafs die öffentliche Schaustellung
der heiligen Gestalt, wie dieselbe seit den ersten
Dezennien des XIV. Jahrh. unter dem Einflufs
des damals zur bleibenden Einrichtung werdenden
Frohnleichnamsfestes allmählich in Uebung kam,
zum Anbringen des Ausschnittes am Schreine
von hl. Kreuz Veranlassung gab. Ob man auf
diese primitive Weise, den Zweck zu erreichen,
deshalb verfiel, weil die künstlerische Form für
die neue Art der Verehrung noch nicht ge-
funden war, oder ob man sich mit dem Aus-
schnitt begnügte, um das kostbare Sakrarium,
wenn auch in verstümmelter Form, zu erhalten,
läfst sich freilich nicht entscheiden. Immerhin
wird das Sakrarium von hl. Kreuz, soviel
ich übersehen kann, die früheste datirte
eucharistische „Monstranz", dieses Wort
in seiner etymologischen Bedeutung genommen,
darstellen und ist es für die Geschichte der
Entwicklung der Monstranz von Bedeutung,
für Süddeutschland nunmehr den Zeitpunkt
nachweisen zu können, wann die öffentliche
Schaustellung der konsekrirten Gestalt in Auf-
nahme kam.
Im Jahre 1494 wurde das Kästchen nach
unten zu mit vier über Eck gestellten Füfsen
versehen, welche sich an den Kanten des
Schreines als figurenbesetzte Fialen verlaufen,
und durch eine unter dem unteren Rande des
Schreines hinlaufende Maafswerkverzierung ver-
bunden sind, nach oben mit einer reichen
gothischen Bekrönung ausgestattet und auf diese
Weise in eine der Anordnung der gothischen
Monstranz sich nähernde Gestalt von 59 cm
Höhe gebracht. Es war dies das Werk des
berühmtesten aus der weitberühmten Augsburger
Goldschmiedezunft, Georg Selds, welcher sich
durch eine Inschrift als Meister dieses Werkes
bezeugt. Doch haben wir uns hier mit seiner
Leistung nicht weiter zu befassen. Dagegen
ist eine andere Zuthat zu erwähnen, weil sie
die Form des alten Schreines etwas umgestaltete,
nämlich das der Renaissancezeit angehörige, fein
ornamentirte Zwischenglied, welches, unter
gleichzeitiger Ueberhöhung des Ausschnittes
durch Wegnahme eines die ganze Breite des
Ausschnittes umspannendes Stückes des Deckels,
zwischen dem oberen Rande des Schreines und
dem unteren Rande des Deckels eingeschoben
wurde. Weitere Umgestaltungen und Zuthaten
vollzogen die folgenden Jahrhunderte. Ihrer
eingehendere Erwähnung zu thun, liegt aufser-
halb der Aufgabe dieser Besprechung, da sie
das ursprüngliche Sakrarium unberührt liefsen.5)
2. Beschreibung. Das von Ulrich Mar-
schalk von Rechberg und seinen beiden Ge-
mahlinnen gestiftete Sakrarium hat die Form
eines länglich viereckigen Reliquienschreines
mit nach allen vier Seiten walmartig in konvex
geschwungener Linie gehobenem Deckel. Es
ist aus Silber gefertigt, aufsen vergoldet und
mit getriebenen Figuren, in Silber gefafsten
Steinen und Silberkugeln und eingravirten In-
schriften und Ornamenten geziert. Die Länge
des Schreines beträgt 14,8 cm, die Höhe 9 cm,
die Breite 10,2 cm; Höhe des Deckels 4,2 cm,
Breite des in der Mitte der Vorderseite ange-
brachten Ausschnittes 6 cm. Die bildlichen
Darstellungen, die Ornamente und Inschriften
sind folgende:
A. Auf dem Schreine und zwar auf der
Rückseite und den beiden Schmalseiten, so-
wie auf der Vorderseite rechts (vom Beschauer)
sind die 12 Apostel mit Christus, unter ro-
manischen, auf spiralförmig kanelirten Säul-
chen ruhenden Arkaden stehend, so ver-
theilt, dafs auf die Rückseite fünf, auf jede
Schmalseite drei, auf die Vorderseite zwei Fi-
guren treffen. In der Mitte der rückseitigen
Gruppe steht Christus, durch Kreuznimbus und
die zum sogenannten lateinischen Segen er-
hobene Rechte kenntlich gemacht; die Linke
hält die Schriftrolle. Zur Rechten Christi Petrus
mit dem Schlüssel als Attribut, überdies durch
die Petrustonsur gekennzeichnet; zur Linken
Paulus, an dem glattgeschorenen Kopf (Paulus-
tonsur) erkenntlich, ein Buch mit der zum
Zeichen der Ehrfurcht verhüllten Linken tragend.
Die übrigen Apostel sind nicht durch Attribute
unterschieden noch sonstwie bezeichnet. Sie
haben die Rechte zum Redegestus erhoben und
tragen in der Linken (einer in der erhobenen
Rechten) die Rolle, einer ein Buch. Alle sind
5) Diese finden sich zusammengestellt in einem aus
der Feder des Kunstkenners F. Butsch stammenden
Artikel der «Allgem. Zeitung« (2. Beil. zu Nr. 152 v.
3. Juni 1887), in welchem auch zum ersten Male der
Meister des Schreines und der der Gothisierung be-
kannt gemacht wurden.