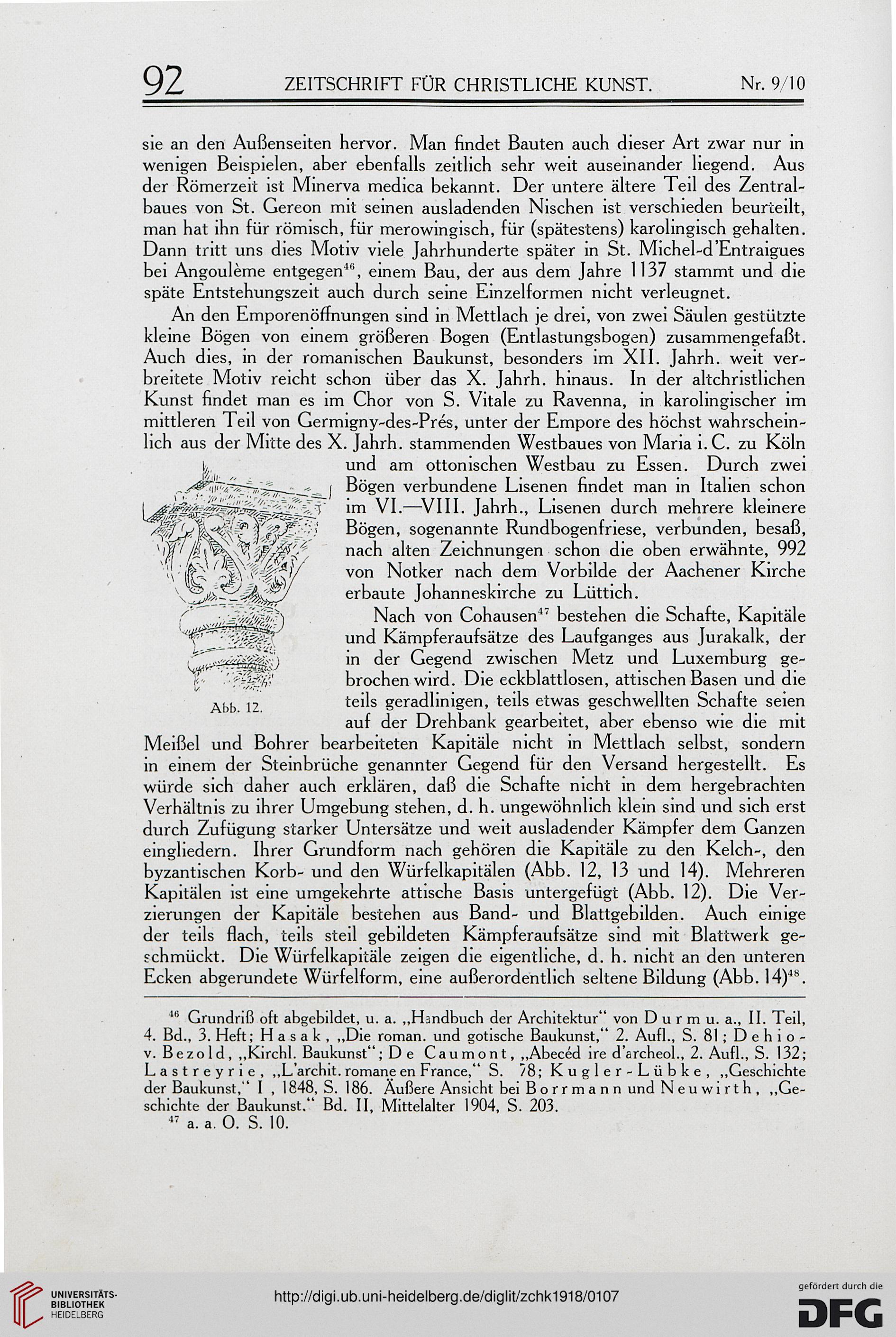92
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 9/10
sie an den Außenseiten hervor. Man findet Bauten auch dieser Art zwar nur in
wenigen Beispielen, aber ebenfalls zeitlich sehr weit auseinander liegend. Aus
der Römerzeit ist Minerva medica bekannt. Der untere ältere Teil des Zentral-
baues von St. Gereon mit seinen ausladenden Nischen ist verschieden beurteilt,
man hat ihn für römisch, für merowingisch, für (spätestens) karohngisch gehalten.
Dann tritt uns dies Motiv viele Jahrhunderte später in St. Michel-d'Entraigues
bei Angouleme entgegen1", einem Bau, der aus dem Jahre 1137 stammt und die
späte Entstehungszeit auch durch seine Einzelformen nicht verleugnet.
An den Emporenöffnungen sind in Mettlach je drei, von zwei Säulen gestützte
kleine Bögen von einem größeren Bogen (Entlastungsbogen) zusammengefaßt.
Auch dies, in der romanischen Baukunst, besonders im XII. Jahrh. weit ver-
breitete Motiv reicht schon über das X. Jahrh. hinaus. In der altchristlichen
Kunst findet man es im Chor von S. Vitale zu Ravenna, in karolingischer im
mittleren Teil von Germigny-des-Pres, unter der Empore des höchst wahrschein-
lich aus der Mitte des X. Jahrh. stammenden Westbaues von Maria i.C. zu Köln
und am ottonischen Westbau zu Essen. Durch zwei
Bögen verbundene Lisenen findet man in Italien schon
im VI.—VIII. Jahrh., Lisenen durch mehrere kleinere
Bögen, sogenannte Rundbogenfriese, verbunden, besaß,
nach alten Zeichnungen schon die oben erwähnte, 992
von Notker nach dem Vorbilde der Aachener Kirche
erbaute Johanneskirche zu Lüttich.
Nach von Cohausen17 bestehen die Schafte, Kapitale
und Kämpferaufsätze des Laufganges aus Jurakalk, der
^^.^igg^j in der Gegend zwischen Metz und Luxemburg ge-
■'•fzjjjß» brochenwird. Die eckblattlosen, attischen Basen und die
Ahb |2 teils geradlinigen, teils etwas geschwellten Schafte seien
auf der Drehbank gearbeitet, aber ebenso wie die mit
Meißel und Bohrer bearbeiteten Kapitale nicht in Mettlach selbst, sondern
in einem der Steinbrüche genannter Gegend für den Versand hergestellt. Es
würde sich daher auch erklären, daß die Schafte nicht in dem hergebrachten
Verhältnis zu ihrer Umgebung stehen, d. h. ungewöhnlich klein sind und sich erst
durch Zufügung starker Untersätze und weit ausladender Kämpfer dem Ganzen
eingliedern. Ihrer Grundform nach gehören die Kapitale zu den Kelch-, den
byzantischen Korb- und den Würfelkapitälen (Abb. 12, 13 und 14). Mehreren
Kapitalen ist eine umgekehrte attische Basis untergefügc (Abb. 12). Die Ver-
zierungen der Kapitale bestehen aus Band- und Blattgebilden. Auch einige
der teils flach, teils steil gebildeten Kämpferaufsätze sind mit Blattwerk ge-
schmückt. Die Würfelkapitäle zeigen die eigentliche, d. h. nicht an den unteren
Ecken abgerundete Würfelform, eine außerordentlich seltene Bildung (Abb. 14)ls.
"' Grundriß oft abgebildet, u. a. „Handbuch der Architektur" von D u r m u. a., II. Teil,
4. Bd., 3. Heft; Hasak, „Die roman. und gotische Baukunst," 2. Aufl., S. 81 ; D e h i o -
v. Bezo ld, „Kirchl. Baukunst"; De Caumont, „Abeced ire d'archeol., 2. Aufl., S. 132;
Lastreyrie, „L'archit. romaneen France," S. 78;Kugler-Lübke, „Geschichte
der Baukunst," I , 1848, S. 186. Äußere Ansicht bei B o r r m a n n und N e u wi rt h , „Ge-
schichte der Baukunst." Bd. II, Mittelalter 1904, S. 203.
17 a. a. 0. S. 10.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 9/10
sie an den Außenseiten hervor. Man findet Bauten auch dieser Art zwar nur in
wenigen Beispielen, aber ebenfalls zeitlich sehr weit auseinander liegend. Aus
der Römerzeit ist Minerva medica bekannt. Der untere ältere Teil des Zentral-
baues von St. Gereon mit seinen ausladenden Nischen ist verschieden beurteilt,
man hat ihn für römisch, für merowingisch, für (spätestens) karohngisch gehalten.
Dann tritt uns dies Motiv viele Jahrhunderte später in St. Michel-d'Entraigues
bei Angouleme entgegen1", einem Bau, der aus dem Jahre 1137 stammt und die
späte Entstehungszeit auch durch seine Einzelformen nicht verleugnet.
An den Emporenöffnungen sind in Mettlach je drei, von zwei Säulen gestützte
kleine Bögen von einem größeren Bogen (Entlastungsbogen) zusammengefaßt.
Auch dies, in der romanischen Baukunst, besonders im XII. Jahrh. weit ver-
breitete Motiv reicht schon über das X. Jahrh. hinaus. In der altchristlichen
Kunst findet man es im Chor von S. Vitale zu Ravenna, in karolingischer im
mittleren Teil von Germigny-des-Pres, unter der Empore des höchst wahrschein-
lich aus der Mitte des X. Jahrh. stammenden Westbaues von Maria i.C. zu Köln
und am ottonischen Westbau zu Essen. Durch zwei
Bögen verbundene Lisenen findet man in Italien schon
im VI.—VIII. Jahrh., Lisenen durch mehrere kleinere
Bögen, sogenannte Rundbogenfriese, verbunden, besaß,
nach alten Zeichnungen schon die oben erwähnte, 992
von Notker nach dem Vorbilde der Aachener Kirche
erbaute Johanneskirche zu Lüttich.
Nach von Cohausen17 bestehen die Schafte, Kapitale
und Kämpferaufsätze des Laufganges aus Jurakalk, der
^^.^igg^j in der Gegend zwischen Metz und Luxemburg ge-
■'•fzjjjß» brochenwird. Die eckblattlosen, attischen Basen und die
Ahb |2 teils geradlinigen, teils etwas geschwellten Schafte seien
auf der Drehbank gearbeitet, aber ebenso wie die mit
Meißel und Bohrer bearbeiteten Kapitale nicht in Mettlach selbst, sondern
in einem der Steinbrüche genannter Gegend für den Versand hergestellt. Es
würde sich daher auch erklären, daß die Schafte nicht in dem hergebrachten
Verhältnis zu ihrer Umgebung stehen, d. h. ungewöhnlich klein sind und sich erst
durch Zufügung starker Untersätze und weit ausladender Kämpfer dem Ganzen
eingliedern. Ihrer Grundform nach gehören die Kapitale zu den Kelch-, den
byzantischen Korb- und den Würfelkapitälen (Abb. 12, 13 und 14). Mehreren
Kapitalen ist eine umgekehrte attische Basis untergefügc (Abb. 12). Die Ver-
zierungen der Kapitale bestehen aus Band- und Blattgebilden. Auch einige
der teils flach, teils steil gebildeten Kämpferaufsätze sind mit Blattwerk ge-
schmückt. Die Würfelkapitäle zeigen die eigentliche, d. h. nicht an den unteren
Ecken abgerundete Würfelform, eine außerordentlich seltene Bildung (Abb. 14)ls.
"' Grundriß oft abgebildet, u. a. „Handbuch der Architektur" von D u r m u. a., II. Teil,
4. Bd., 3. Heft; Hasak, „Die roman. und gotische Baukunst," 2. Aufl., S. 81 ; D e h i o -
v. Bezo ld, „Kirchl. Baukunst"; De Caumont, „Abeced ire d'archeol., 2. Aufl., S. 132;
Lastreyrie, „L'archit. romaneen France," S. 78;Kugler-Lübke, „Geschichte
der Baukunst," I , 1848, S. 186. Äußere Ansicht bei B o r r m a n n und N e u wi rt h , „Ge-
schichte der Baukunst." Bd. II, Mittelalter 1904, S. 203.
17 a. a. 0. S. 10.