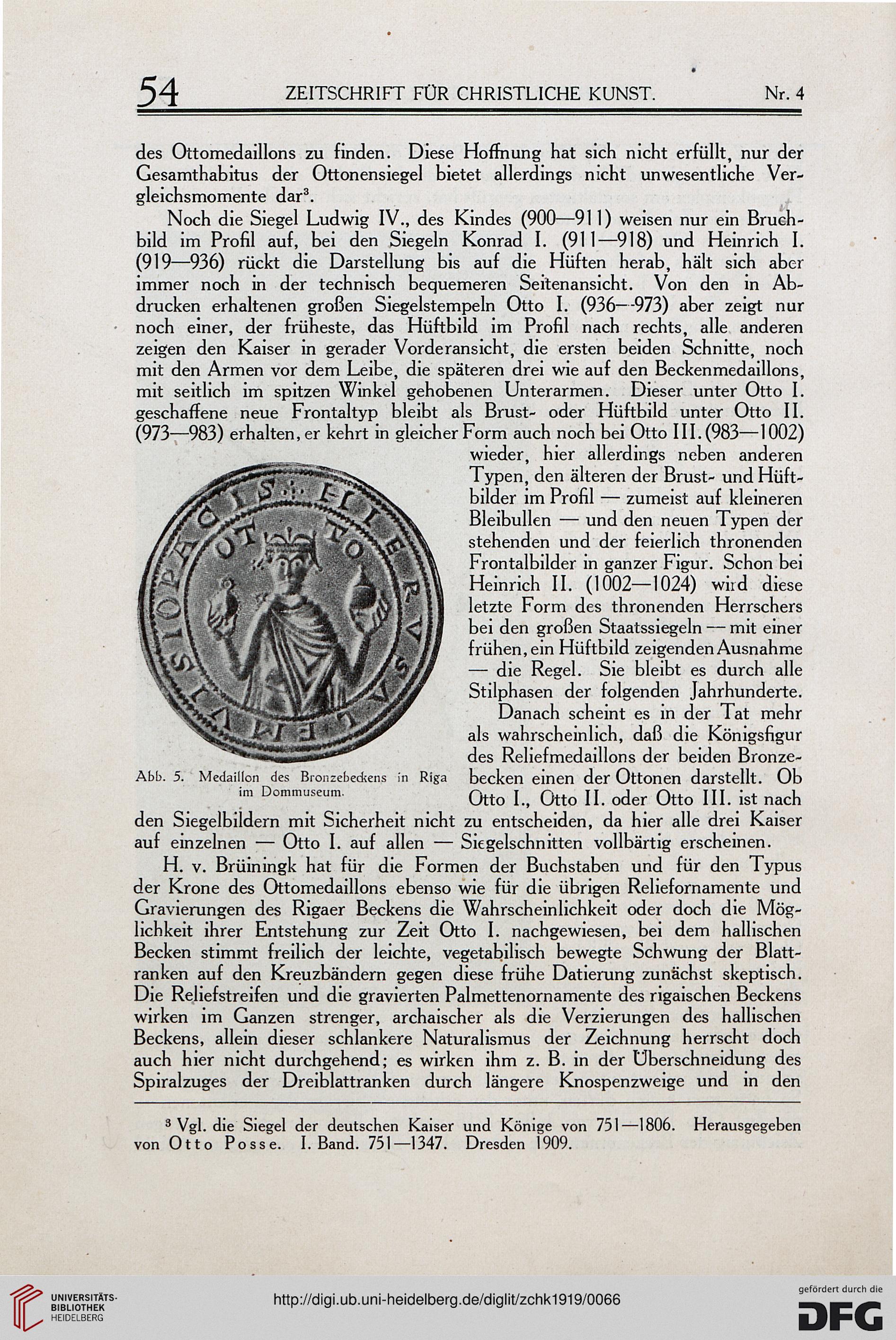54
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 4
des Ottomedaillons zu finden. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, nur der
Gesamthabitus der Ottonensiegel bietet allerdings nicht unwesentliche Ver-
gleichsmomente dar3.
Noch die Siegel Ludwig IV., des Kindes (900—91 1) weisen nur ein Bruch-
bild im Profil auf, bei den Siegeln Konrad I. (911—918) und Heinrich I.
(919—936) rückt die Darstellung bis auf die Hüften herab, hält sich aber
immer noch in der technisch bequemeren Seitenansicht. Von den in Ab-
drucken erhaltenen großen Siegelstempeln Otto I. (936—973) aber zeigt nur
noch einer, der früheste, das Hüftbild im Profil nach rechts, alle anderen
zeigen den Kaiser in gerader Vorderansicht, die ersten beiden Schnitte, noch
mit den Armen vor dem Leibe, die späteren drei wie auf den Beckenmedaillons,
mit seitlich im spitzen Winkel gehobenen Unterarmen. Dieser unter Otto I.
geschaffene neue Frontaltyp bleibt als Brust- oder Hüftbild unter Otto II.
(973—983) erhalten, er kehrt in gleicher Form auch noch bei Otto 111.(983—1002)
wieder, hier allerdings neben anderen
Typen, den älteren der Brust- und Hüft-
bilder im Profil — zumeist auf kleineren
Bleibullen — und den neuen Typen der
stehenden und der feierlich thronenden
Frontalbilder in ganzer Figur. Schon bei
Heinrich II. (1002—1024) wird diese
letzte Form des thronenden Herrschers
bei den großen Staatssiegeln — mit einer
frühen, ein Hüftbild zeigenden Ausnahme
— die Regel. Sie bleibt es durch alle
Stilphasen der folgenden Jahrhunderte.
Danach scheint es in der Tat mehr
als wahrscheinlich, daß die Königsfigur
des Reliefmedaillons der beiden Bronze-
becken einen der Ottonen darstellt. Ob
Otto I., Otto II. oder Otto III. ist nach
den Siegelbildern mit Sicherheit nicht zu entscheiden, da hier alle drei Kaiser
auf einzelnen — Otto I. auf allen — Siegelschnitten vollbärtig erscheinen.
H. v. Brüiningk hat für die Formen der Buchstaben und für den Typus
der Krone des Ottomedaillons ebenso wie für die übrigen Reliefornamente und
Gravierungen des Rigaer Beckens die Wahrscheinlichkeit oder doch die Mög-
lichkeit ihrer Entstehung zur Zeit Otto I. nachgewiesen, bei dem halhschen
Becken stimmt freilich der leichte, vegetabilisch bewegte Schwung der Blatt-
ranken auf den Kreuzbändern gegen diese frühe Datierung zunächst skeptisch.
Die Reliefstreifen und die gravierten Palmettenornamente des rigaischen Beckens
wirken im Ganzen strenger, archaischer als die Verzierungen des hallischen
Beckens, allein dieser schlankere Naturalismus der Zeichnung herrscht doch
auch hier nicht durchgehend; es wirken ihm z. B. in der Überschneidung des
Spiralzuges der Dreiblattranken durch längere Knospenzweige und in den
Abb. 5.
Medaillon des Bronzebecteis
im Dommuseum.
in Riga
3 Vgl. die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751—1806. Herausgegeben
von Otto Posse. I.Band. 751—1347. Dresden 1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 4
des Ottomedaillons zu finden. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, nur der
Gesamthabitus der Ottonensiegel bietet allerdings nicht unwesentliche Ver-
gleichsmomente dar3.
Noch die Siegel Ludwig IV., des Kindes (900—91 1) weisen nur ein Bruch-
bild im Profil auf, bei den Siegeln Konrad I. (911—918) und Heinrich I.
(919—936) rückt die Darstellung bis auf die Hüften herab, hält sich aber
immer noch in der technisch bequemeren Seitenansicht. Von den in Ab-
drucken erhaltenen großen Siegelstempeln Otto I. (936—973) aber zeigt nur
noch einer, der früheste, das Hüftbild im Profil nach rechts, alle anderen
zeigen den Kaiser in gerader Vorderansicht, die ersten beiden Schnitte, noch
mit den Armen vor dem Leibe, die späteren drei wie auf den Beckenmedaillons,
mit seitlich im spitzen Winkel gehobenen Unterarmen. Dieser unter Otto I.
geschaffene neue Frontaltyp bleibt als Brust- oder Hüftbild unter Otto II.
(973—983) erhalten, er kehrt in gleicher Form auch noch bei Otto 111.(983—1002)
wieder, hier allerdings neben anderen
Typen, den älteren der Brust- und Hüft-
bilder im Profil — zumeist auf kleineren
Bleibullen — und den neuen Typen der
stehenden und der feierlich thronenden
Frontalbilder in ganzer Figur. Schon bei
Heinrich II. (1002—1024) wird diese
letzte Form des thronenden Herrschers
bei den großen Staatssiegeln — mit einer
frühen, ein Hüftbild zeigenden Ausnahme
— die Regel. Sie bleibt es durch alle
Stilphasen der folgenden Jahrhunderte.
Danach scheint es in der Tat mehr
als wahrscheinlich, daß die Königsfigur
des Reliefmedaillons der beiden Bronze-
becken einen der Ottonen darstellt. Ob
Otto I., Otto II. oder Otto III. ist nach
den Siegelbildern mit Sicherheit nicht zu entscheiden, da hier alle drei Kaiser
auf einzelnen — Otto I. auf allen — Siegelschnitten vollbärtig erscheinen.
H. v. Brüiningk hat für die Formen der Buchstaben und für den Typus
der Krone des Ottomedaillons ebenso wie für die übrigen Reliefornamente und
Gravierungen des Rigaer Beckens die Wahrscheinlichkeit oder doch die Mög-
lichkeit ihrer Entstehung zur Zeit Otto I. nachgewiesen, bei dem halhschen
Becken stimmt freilich der leichte, vegetabilisch bewegte Schwung der Blatt-
ranken auf den Kreuzbändern gegen diese frühe Datierung zunächst skeptisch.
Die Reliefstreifen und die gravierten Palmettenornamente des rigaischen Beckens
wirken im Ganzen strenger, archaischer als die Verzierungen des hallischen
Beckens, allein dieser schlankere Naturalismus der Zeichnung herrscht doch
auch hier nicht durchgehend; es wirken ihm z. B. in der Überschneidung des
Spiralzuges der Dreiblattranken durch längere Knospenzweige und in den
Abb. 5.
Medaillon des Bronzebecteis
im Dommuseum.
in Riga
3 Vgl. die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751—1806. Herausgegeben
von Otto Posse. I.Band. 751—1347. Dresden 1909.