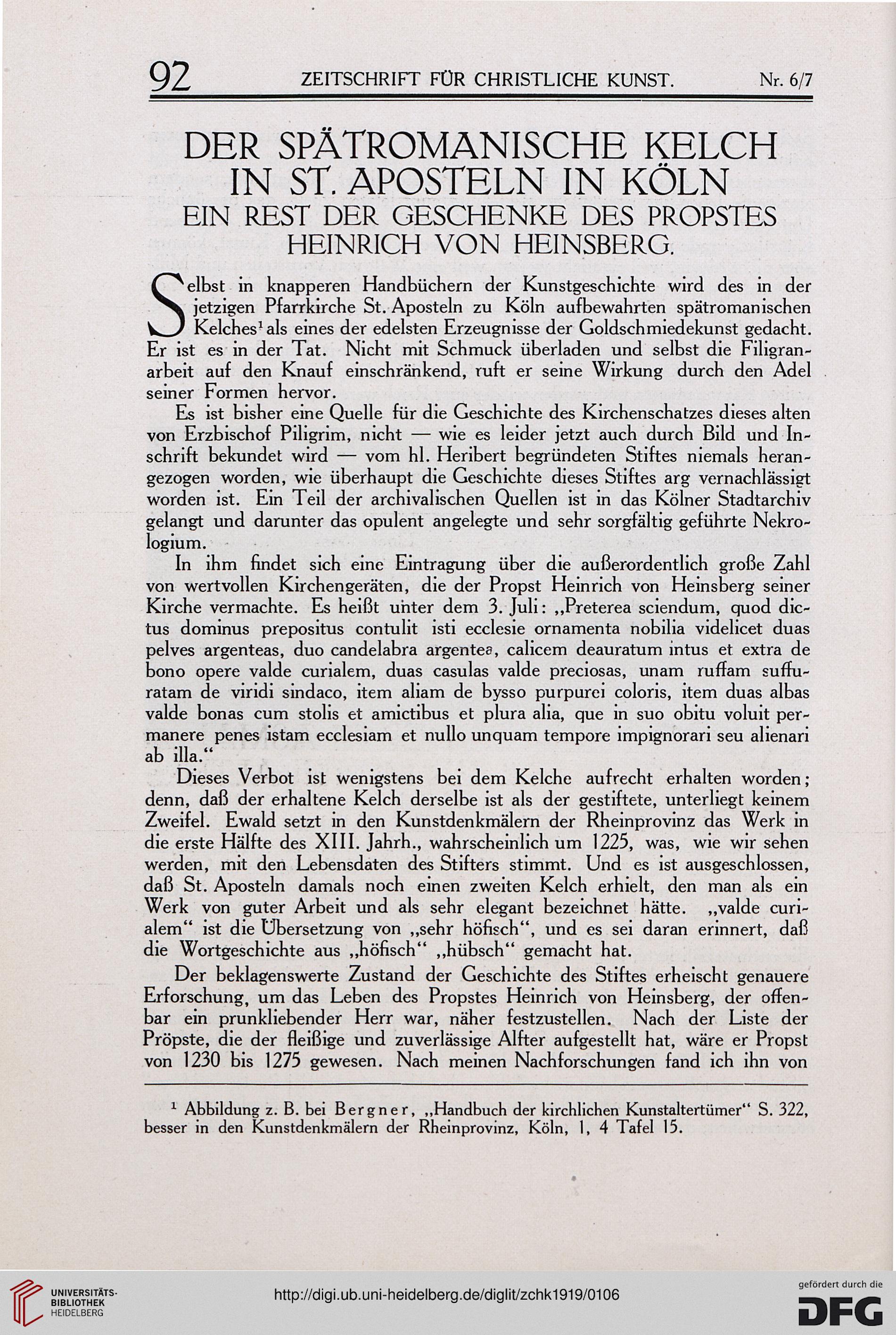92
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 6/7
DER SPÄTROMANISCHE KELCH
IN ST. APOSTELN IN KÖLN
EIN REST DER GESCHENKE DES PROPSTES
HEINRICH VON HEINSBERG.
Selbsb in knapperen Handbüchern der Kunstgeschichte wird des in der
jetzigen Pfarrkirche St. Aposteln zu Köln aufbewahrten spätromanischen
Kelches1 als eines der edelsten Erzeugnisse der Goldschmiedekunst gedacht.
Er ist es in der Tat. Nicht mit Schmuck überladen und selbst die Filigran-
arbeit auf den Knauf einschränkend, ruft er seine Wirkung durch den Adel
seiner Formen hervor.
Es ist bisher eine Quelle für die Geschichte des Kirchenschatzes dieses alten
von Erzbischof Piligrim, nicht — wie es leider jetzt auch durch Bild und In-
schrift bekundet wird — vom hl. Heribert begründeten Stiftes niemals heran-
gezogen worden, wie überhaupt die Geschichte dieses Stiftes arg vernachlässigt
worden ist. Ein Teil der archivalischen Quellen ist in das Kölner Stadtarchiv
gelangt und darunter das opulent angelegte und sehr sorgfältig geführte Nekro-
logium.
In ihm findet sich eine Eintragung über die außerordentlich große Zahl
von wertvollen Kirchengeräten, die der Propst Heinrich von Heinsberg seiner
Kirche vermachte. Es heißt unter dem 3. Juli: „Preterea sciendum, quod dic-
tus dominus prepositus contulit isti ecclesie ornamenta nobilia videlicet duas
pelves argenteas, duo candelabra argentea, cahcem deauratum intus et extra de
bono opere valde curialem, duas casulas valde preciosas, unam ruffam suffu-
ratam de vindi sindaco, item aliam de bysso purpurei Colons, item duas albas
valde bonas cum stolis et amictibus et plura aha, que in suo obitu voluit per-
manere penes istam ecclesiam et nullo unquam tempore impignorari seu ahenari
ab lila."
Dieses Verbot ist wenigstens bei dem Kelche aufrecht erhalten worden ;
denn, daß der erhaltene Kelch derselbe ist als der gestiftete, unterliegt keinem
Zweifel. Ewald setzt in den Kunstdenkmälern der Rheinprovinz das Werk in
die erste Hälfte des XIII. Jahrh., wahrscheinlich um 1225, was, wie wir sehen
werden, mit den Lebensdaten des Stifters stimmt. Und es ist ausgeschlossen,
daß St. Aposteln damals noch einen zweiten Kelch erhielt, den man als ein
Werk von guter Arbeit und als sehr elegant bezeichnet hätte, „valde curi-
alem" ist die Übersetzung von „sehr höfisch", und es sei daran erinnert, daß
die Wortgeschichte aus „höfisch" „hübsch" gemacht hat.
Der beklagenswerte Zustand der Geschichte des Stiftes erheischt genauere
Erforschung, um das Leben des Propstes Heinrich von Heinsberg, der offen-
bar ein prunkliebender Herr war, näher festzustellen. Nach der Liste der
Pröpste, die der fleißige und zuverlässige Alfter aufgestellt hat, wäre er Propst
von 1230 bis 1275 gewesen. Nach meinen Nachforschungen fand ich ihn von
1 Abbildung z. B. bei Bergner, „Handbuch der kirchlichen Kunstaltertümer" S. 322,
besser in den Kunstdenkmälern der Rheinprovinz, Köln, 1, 4 Tafel 15.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 6/7
DER SPÄTROMANISCHE KELCH
IN ST. APOSTELN IN KÖLN
EIN REST DER GESCHENKE DES PROPSTES
HEINRICH VON HEINSBERG.
Selbsb in knapperen Handbüchern der Kunstgeschichte wird des in der
jetzigen Pfarrkirche St. Aposteln zu Köln aufbewahrten spätromanischen
Kelches1 als eines der edelsten Erzeugnisse der Goldschmiedekunst gedacht.
Er ist es in der Tat. Nicht mit Schmuck überladen und selbst die Filigran-
arbeit auf den Knauf einschränkend, ruft er seine Wirkung durch den Adel
seiner Formen hervor.
Es ist bisher eine Quelle für die Geschichte des Kirchenschatzes dieses alten
von Erzbischof Piligrim, nicht — wie es leider jetzt auch durch Bild und In-
schrift bekundet wird — vom hl. Heribert begründeten Stiftes niemals heran-
gezogen worden, wie überhaupt die Geschichte dieses Stiftes arg vernachlässigt
worden ist. Ein Teil der archivalischen Quellen ist in das Kölner Stadtarchiv
gelangt und darunter das opulent angelegte und sehr sorgfältig geführte Nekro-
logium.
In ihm findet sich eine Eintragung über die außerordentlich große Zahl
von wertvollen Kirchengeräten, die der Propst Heinrich von Heinsberg seiner
Kirche vermachte. Es heißt unter dem 3. Juli: „Preterea sciendum, quod dic-
tus dominus prepositus contulit isti ecclesie ornamenta nobilia videlicet duas
pelves argenteas, duo candelabra argentea, cahcem deauratum intus et extra de
bono opere valde curialem, duas casulas valde preciosas, unam ruffam suffu-
ratam de vindi sindaco, item aliam de bysso purpurei Colons, item duas albas
valde bonas cum stolis et amictibus et plura aha, que in suo obitu voluit per-
manere penes istam ecclesiam et nullo unquam tempore impignorari seu ahenari
ab lila."
Dieses Verbot ist wenigstens bei dem Kelche aufrecht erhalten worden ;
denn, daß der erhaltene Kelch derselbe ist als der gestiftete, unterliegt keinem
Zweifel. Ewald setzt in den Kunstdenkmälern der Rheinprovinz das Werk in
die erste Hälfte des XIII. Jahrh., wahrscheinlich um 1225, was, wie wir sehen
werden, mit den Lebensdaten des Stifters stimmt. Und es ist ausgeschlossen,
daß St. Aposteln damals noch einen zweiten Kelch erhielt, den man als ein
Werk von guter Arbeit und als sehr elegant bezeichnet hätte, „valde curi-
alem" ist die Übersetzung von „sehr höfisch", und es sei daran erinnert, daß
die Wortgeschichte aus „höfisch" „hübsch" gemacht hat.
Der beklagenswerte Zustand der Geschichte des Stiftes erheischt genauere
Erforschung, um das Leben des Propstes Heinrich von Heinsberg, der offen-
bar ein prunkliebender Herr war, näher festzustellen. Nach der Liste der
Pröpste, die der fleißige und zuverlässige Alfter aufgestellt hat, wäre er Propst
von 1230 bis 1275 gewesen. Nach meinen Nachforschungen fand ich ihn von
1 Abbildung z. B. bei Bergner, „Handbuch der kirchlichen Kunstaltertümer" S. 322,
besser in den Kunstdenkmälern der Rheinprovinz, Köln, 1, 4 Tafel 15.