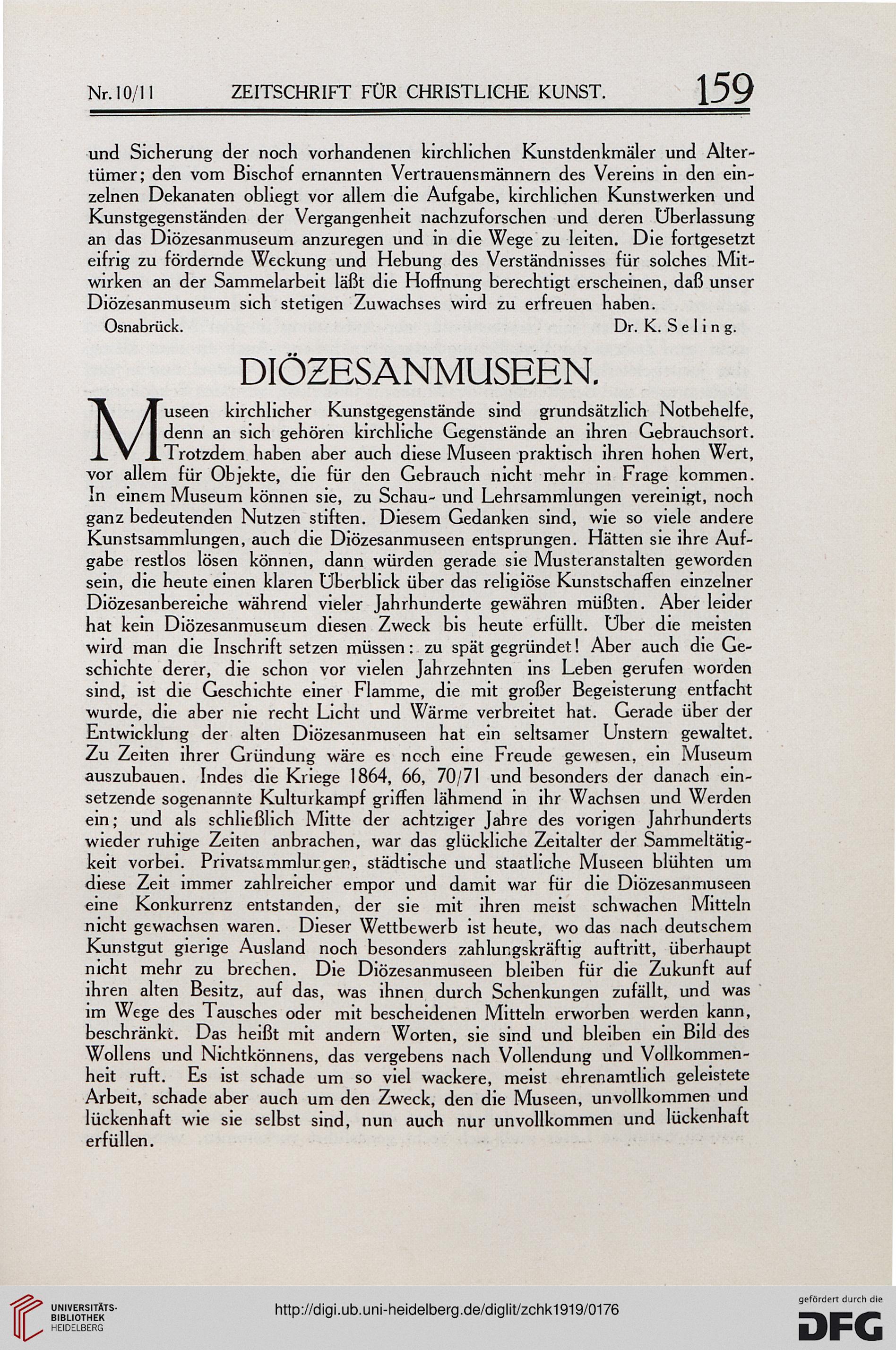Nr. 10/11
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. 159
und Sicherung der noch vorhandenen kirchlichen Kunstdenkmäler und Alter-
tümer; den vom Bischof ernannten Vertrauensmännern des Vereins in den ein-
zelnen Dekanaten obliegt vor allem die Aufgabe, kirchlichen Kunstwerken und
Kunstgegenständen der Vergangenheit nachzuforschen und deren Überlassung
an das Diözesanmuseum anzuregen und in die Wege zu leiten. Die fortgesetzt
eifrig zu fördernde Weckung und Hebung des Verständnisses für solches Mit-
wirken an der Sammelarbeit läßt die Hoffnung berechtigt erscheinen, daß unser
Diözesanmuseum sich stetigen Zuwachses wird zu erfreuen haben.
Osnabrück. Dr. K. S e 1 i n g.
DIÖZESANMUSEEN.
Museen kirchlicher Kunstgegenstände sind grundsätzlich Notbehelfe,
denn an sich gehören kirchliche Gegenstände an ihren Gebrauchsort.
Trotzdem haben aber auch diese Museen praktisch ihren hohen Wert,
vor allem für Objekte, die für den Gebrauch nicht mehr in Frage kommen.
in einem Museum können sie, zu Schau- und Lehrsammlungen vereinigt, noch
ganz bedeutenden Nutzen stiften. Diesem Gedanken sind, wie so viele andere
Kunstsammlungen, auch die Diözesanmuseen entsprungen. Hätten sie ihre Auf-
gabe restlos lösen können, dann würden gerade sie Musteranstalten geworden
sein, die heute einen klaren Überblick über das religiöse Kunstschaffen einzelner
Diözesanbereiche während vieler Jahrhunderte gewähren müßten. Aber leider
hat kein Diözesanmuseum diesen Zweck bis heute erfüllt. Über die meisten
wird man die Inschrift setzen müssen: zu spät gegründet! Aber auch die Ge-
schichte derer, die schon vor vielen Jahrzehnten ins Leben gerufen worden
sind, ist die Geschichte einer Flamme, die mit großer Begeisterung entfacht
wurde, die aber nie recht Licht und Wärme verbreitet hat. Gerade über der
Entwicklung der alten Diözesanmuseen hat ein seltsamer Unstern gewaltet.
Zu Zeiten ihrer Gründung wäre es noch eine Freude gewesen, ein Museum
auszubauen. Indes die Kriege 1864, 66, 70/71 und besonders der danach ein-
setzende sogenannte Kulturkampf griffen lähmend in ihr Wachsen und Werden
ein; und als schließlich Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
wieder ruhige Zeiten anbrachen, war das glückliche Zeitalter der Sammeltätig-
keit vorbei. Privatstmirilurgen, städtische und staatliche Museen blühten um
diese Zeit immer zahlreicher empor und damit war für die Diözesanmuseen
eine Konkurrenz entstanden, der sie mit ihren meist schwachen Mitteln
nicht gewachsen waren. Dieser Wettbewerb ist heute, wo das nach deutschem
Kunstgut gierige Ausland noch besonders zahlungskräftig auftritt, überhaupt
nicht mehr zu brechen. Die Diözesanmuseen bleiben für die Zukunft auf
ihren alten Besitz, auf das, was ihnen durch Schenkungen zufällt, und was
im Wege des Tausches oder mit bescheidenen Mitteln erworben werden kann,
beschränkt. Das heißt mit andern Worten, sie sind und bleiben ein Bild des
Wollens und Nichtkönnens, das vergebens nach Vollendung und Vollkommen-
heit ruft. Es ist schade um so viel wackere, meist ehrenamtlich geleistete
Arbeit, schade aber auch um den Zweck, den die Museen, unvollkommen und
lückenhaft wie sie selbst sind, nun auch nur unvollkommen und lückenhaft
erfüllen.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. 159
und Sicherung der noch vorhandenen kirchlichen Kunstdenkmäler und Alter-
tümer; den vom Bischof ernannten Vertrauensmännern des Vereins in den ein-
zelnen Dekanaten obliegt vor allem die Aufgabe, kirchlichen Kunstwerken und
Kunstgegenständen der Vergangenheit nachzuforschen und deren Überlassung
an das Diözesanmuseum anzuregen und in die Wege zu leiten. Die fortgesetzt
eifrig zu fördernde Weckung und Hebung des Verständnisses für solches Mit-
wirken an der Sammelarbeit läßt die Hoffnung berechtigt erscheinen, daß unser
Diözesanmuseum sich stetigen Zuwachses wird zu erfreuen haben.
Osnabrück. Dr. K. S e 1 i n g.
DIÖZESANMUSEEN.
Museen kirchlicher Kunstgegenstände sind grundsätzlich Notbehelfe,
denn an sich gehören kirchliche Gegenstände an ihren Gebrauchsort.
Trotzdem haben aber auch diese Museen praktisch ihren hohen Wert,
vor allem für Objekte, die für den Gebrauch nicht mehr in Frage kommen.
in einem Museum können sie, zu Schau- und Lehrsammlungen vereinigt, noch
ganz bedeutenden Nutzen stiften. Diesem Gedanken sind, wie so viele andere
Kunstsammlungen, auch die Diözesanmuseen entsprungen. Hätten sie ihre Auf-
gabe restlos lösen können, dann würden gerade sie Musteranstalten geworden
sein, die heute einen klaren Überblick über das religiöse Kunstschaffen einzelner
Diözesanbereiche während vieler Jahrhunderte gewähren müßten. Aber leider
hat kein Diözesanmuseum diesen Zweck bis heute erfüllt. Über die meisten
wird man die Inschrift setzen müssen: zu spät gegründet! Aber auch die Ge-
schichte derer, die schon vor vielen Jahrzehnten ins Leben gerufen worden
sind, ist die Geschichte einer Flamme, die mit großer Begeisterung entfacht
wurde, die aber nie recht Licht und Wärme verbreitet hat. Gerade über der
Entwicklung der alten Diözesanmuseen hat ein seltsamer Unstern gewaltet.
Zu Zeiten ihrer Gründung wäre es noch eine Freude gewesen, ein Museum
auszubauen. Indes die Kriege 1864, 66, 70/71 und besonders der danach ein-
setzende sogenannte Kulturkampf griffen lähmend in ihr Wachsen und Werden
ein; und als schließlich Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
wieder ruhige Zeiten anbrachen, war das glückliche Zeitalter der Sammeltätig-
keit vorbei. Privatstmirilurgen, städtische und staatliche Museen blühten um
diese Zeit immer zahlreicher empor und damit war für die Diözesanmuseen
eine Konkurrenz entstanden, der sie mit ihren meist schwachen Mitteln
nicht gewachsen waren. Dieser Wettbewerb ist heute, wo das nach deutschem
Kunstgut gierige Ausland noch besonders zahlungskräftig auftritt, überhaupt
nicht mehr zu brechen. Die Diözesanmuseen bleiben für die Zukunft auf
ihren alten Besitz, auf das, was ihnen durch Schenkungen zufällt, und was
im Wege des Tausches oder mit bescheidenen Mitteln erworben werden kann,
beschränkt. Das heißt mit andern Worten, sie sind und bleiben ein Bild des
Wollens und Nichtkönnens, das vergebens nach Vollendung und Vollkommen-
heit ruft. Es ist schade um so viel wackere, meist ehrenamtlich geleistete
Arbeit, schade aber auch um den Zweck, den die Museen, unvollkommen und
lückenhaft wie sie selbst sind, nun auch nur unvollkommen und lückenhaft
erfüllen.