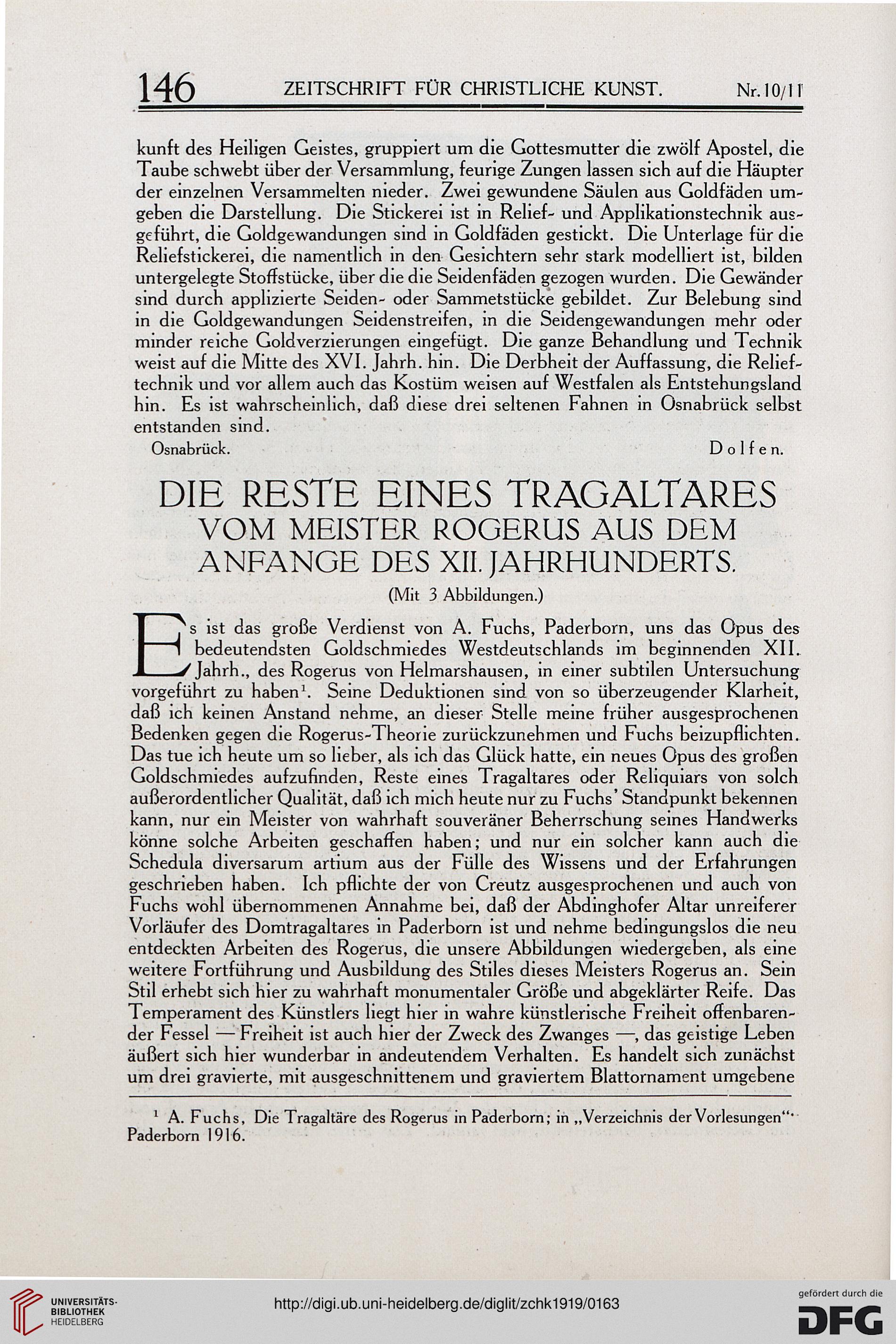146
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 10/11
kunft des Heiligen Geistes, gruppiert um die Gottesmutter die zwölf Apostel, die
Taube schwebt über der Versammlung, feurige Zungen lassen sich auf die Häupter
der einzelnen Versammelten nieder. Zwei gewundene Säulen aus Goldfäden um-
geben die Darstellung. Die Stickerei ist in Relief- und Applikationstechnik aus-
geführt, die Goldgewandungen sind in Goldfäden gestickt. Die Unterlage für die
Rehefstickerei, die namentlich in den Gesichtern sehr stark modelliert ist, bilden
untergelegte Stoffstücke, über die die Seidenfäden gezogen wurden. Die Gewänder
sind durch applizierte Seiden- oder Sammetstücke gebildet. Zur Belebung sind
in die Goldgewandungen Seidenstreifen, in die Seidengewandungen mehr oder
minder reiche Goldverzierungen eingefügt. Die ganze Behandlung und Technik
weist auf die Mitte des XVI. Jahrh. hin. Die Derbheit der Auffassung, die Relief-
technik und vor allem auch das Kostüm weisen auf Westfalen als Entstehungsland
hin. Es ist wahrscheinlich, daß diese drei seltenen Fahnen in Osnabrück selbst
entstanden sind.
Osnabrück. D o 1 f e n.
DIE RESTE EINES TRAGALTARES
VOM MEISTER ROGERUS AUS DEM
ANFANGE DES XII. JAHRHUNDERTS.
(Mit 3 Abbildungen.)
Es ist das große Verdienst von A. Fuchs, Paderborn, uns das Opus des
bedeutendsten Goldschmiedes Westdeutschlands im beginnenden XII.
Jahrh., des Rogerus von Heimarshausen, in einer subtilen Untersuchung
vorgeführt zu haben1. Seine Deduktionen sind von so überzeugender Klarheit,
daß ich keinen Anstand nehme, an dieser Stelle meine früher ausgesprochenen
Bedenken gegen die Rogerus-Theone zurückzunehmen und Fuchs beizupflichten.
Das tue ich heute um so lieber, als ich das Glück hatte, ein neues Opus des großen
Goldschmiedes aufzufinden, Reste eines Tragaltares oder Reliquiars von solch
außerordentlicher Qualität, daß ich mich heute nur zu Fuchs' Standpunkt bekennen
kann, nur ein Meister von wahrhaft souveräner Beherrschung seines Handwerks
könne solche Arbeiten geschaffen haben; und nur ein solcher kann auch die
Schedula diversarum artium aus der Fülle des Wissens und der Erfahrungen
geschrieben haben. Ich pflichte der von Creutz ausgesprochenen und auch von
Fuchs wohl übernommenen Annahme bei, daß der Abdinghofer Altar unreiferer
Vorläufer des Domtragaltares in Paderborn ist und nehme bedingungslos die neu
entdeckten Arbeiten des Rogerus, die unsere Abbildungen wiedergeben, als eine
weitere Fortführung und Ausbildung des Stiles dieses Meisters Rogerus an. Sein
Stil erhebt sich hier zu wahrhaft monumentaler Größe und abgeklärter Reife. Das
Temperament des Künstlers liegt hier in wahre künstlerische Freiheit offenbaren-
der Fessel — Freiheit ist auch hier der Zweck des Zwanges —, das geistige Leben
äußert sich hier wunderbar in andeutendem Verhalten. Es handelt sich zunächst
um drei gravierte, mit ausgeschnittenem und graviertem Blattornament umgebene
1 A. Fuchs, Die Tragaltäre des Rogerus in Paderborn; in „Verzeichnis der Vorlesungen"*
Paderborn 1916.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 10/11
kunft des Heiligen Geistes, gruppiert um die Gottesmutter die zwölf Apostel, die
Taube schwebt über der Versammlung, feurige Zungen lassen sich auf die Häupter
der einzelnen Versammelten nieder. Zwei gewundene Säulen aus Goldfäden um-
geben die Darstellung. Die Stickerei ist in Relief- und Applikationstechnik aus-
geführt, die Goldgewandungen sind in Goldfäden gestickt. Die Unterlage für die
Rehefstickerei, die namentlich in den Gesichtern sehr stark modelliert ist, bilden
untergelegte Stoffstücke, über die die Seidenfäden gezogen wurden. Die Gewänder
sind durch applizierte Seiden- oder Sammetstücke gebildet. Zur Belebung sind
in die Goldgewandungen Seidenstreifen, in die Seidengewandungen mehr oder
minder reiche Goldverzierungen eingefügt. Die ganze Behandlung und Technik
weist auf die Mitte des XVI. Jahrh. hin. Die Derbheit der Auffassung, die Relief-
technik und vor allem auch das Kostüm weisen auf Westfalen als Entstehungsland
hin. Es ist wahrscheinlich, daß diese drei seltenen Fahnen in Osnabrück selbst
entstanden sind.
Osnabrück. D o 1 f e n.
DIE RESTE EINES TRAGALTARES
VOM MEISTER ROGERUS AUS DEM
ANFANGE DES XII. JAHRHUNDERTS.
(Mit 3 Abbildungen.)
Es ist das große Verdienst von A. Fuchs, Paderborn, uns das Opus des
bedeutendsten Goldschmiedes Westdeutschlands im beginnenden XII.
Jahrh., des Rogerus von Heimarshausen, in einer subtilen Untersuchung
vorgeführt zu haben1. Seine Deduktionen sind von so überzeugender Klarheit,
daß ich keinen Anstand nehme, an dieser Stelle meine früher ausgesprochenen
Bedenken gegen die Rogerus-Theone zurückzunehmen und Fuchs beizupflichten.
Das tue ich heute um so lieber, als ich das Glück hatte, ein neues Opus des großen
Goldschmiedes aufzufinden, Reste eines Tragaltares oder Reliquiars von solch
außerordentlicher Qualität, daß ich mich heute nur zu Fuchs' Standpunkt bekennen
kann, nur ein Meister von wahrhaft souveräner Beherrschung seines Handwerks
könne solche Arbeiten geschaffen haben; und nur ein solcher kann auch die
Schedula diversarum artium aus der Fülle des Wissens und der Erfahrungen
geschrieben haben. Ich pflichte der von Creutz ausgesprochenen und auch von
Fuchs wohl übernommenen Annahme bei, daß der Abdinghofer Altar unreiferer
Vorläufer des Domtragaltares in Paderborn ist und nehme bedingungslos die neu
entdeckten Arbeiten des Rogerus, die unsere Abbildungen wiedergeben, als eine
weitere Fortführung und Ausbildung des Stiles dieses Meisters Rogerus an. Sein
Stil erhebt sich hier zu wahrhaft monumentaler Größe und abgeklärter Reife. Das
Temperament des Künstlers liegt hier in wahre künstlerische Freiheit offenbaren-
der Fessel — Freiheit ist auch hier der Zweck des Zwanges —, das geistige Leben
äußert sich hier wunderbar in andeutendem Verhalten. Es handelt sich zunächst
um drei gravierte, mit ausgeschnittenem und graviertem Blattornament umgebene
1 A. Fuchs, Die Tragaltäre des Rogerus in Paderborn; in „Verzeichnis der Vorlesungen"*
Paderborn 1916.