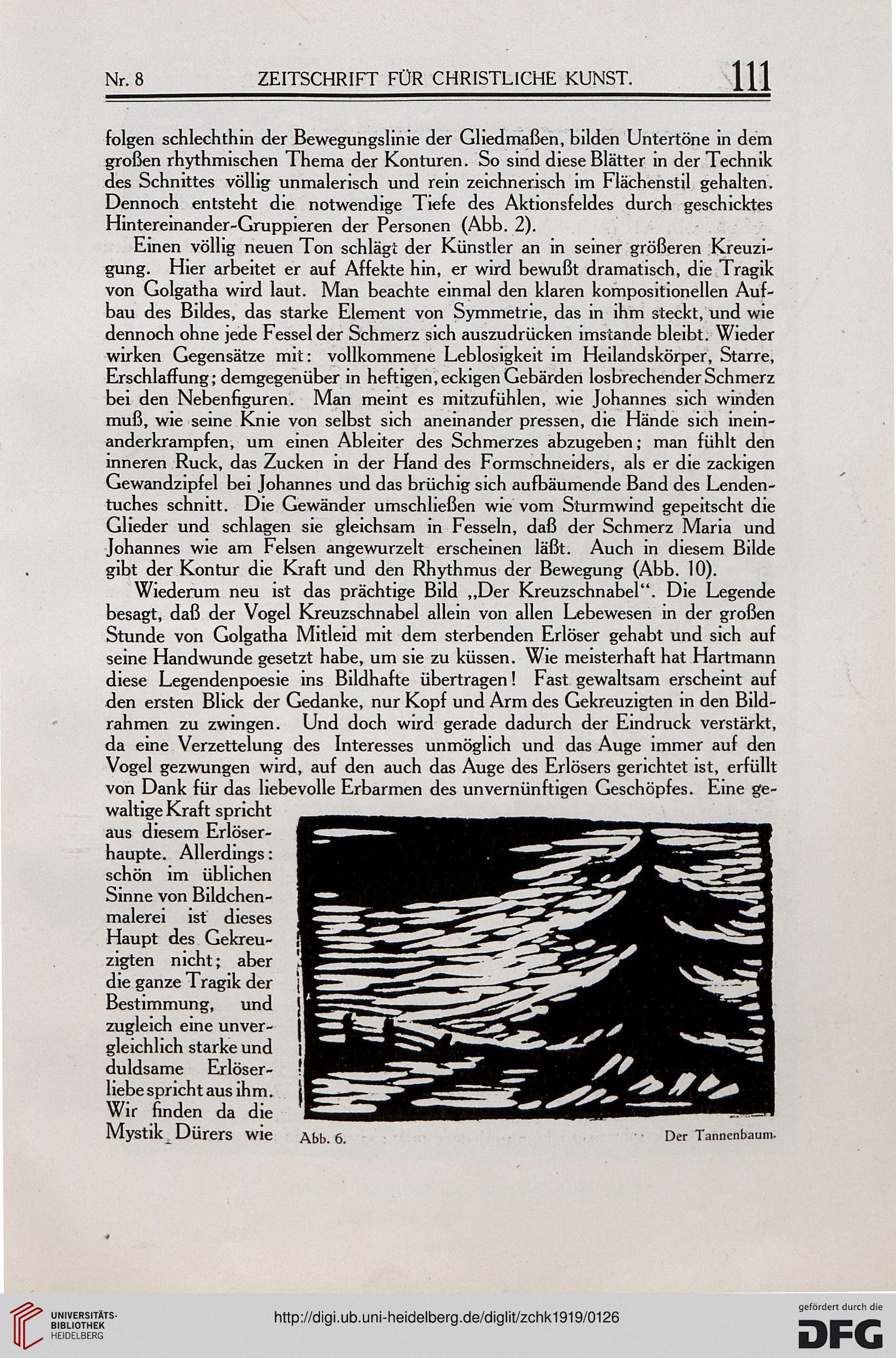Nr. 8
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
111
folgen schlechthin der Bewegungslinie der Gliedmaßen, bilden Untertöne in dem
großen rhythmischen Thema der Konturen. So sind diese Blätter in der Technik
des Schnittes völlig unmalerisch und rein zeichnerisch im Flächenstil gehalten.
Dennoch entsteht die notwendige Tiefe des Aktionsfeldes durch geschicktes
Hintereinander-Gruppieren der Personen (Abb. 2).
Einen völlig neuen Ton schlägt der Künstler an in seiner größeren Kreuzi-
gung. Hier arbeitet er auf Affekte hin, er wird bewußt dramatisch, die Tragik
von Golgatha wird laut. Man beachte einmal den klaren kompositioneilen Auf-
bau des Bildes, das starke Element von Symmetrie, das in ihm steckt, und wie
dennoch ohne jede Fessel der Schmerz sich auszudrücken imstande bleibt. Wieder
wirken Gegensätze mit: vollkommene Leblosigkeit im Heilandskörper, Starre,
Erschlaffung; demgegenüber in heftigen, eckigen Gebärden losbrechender Schmerz
bei den Nebenfiguren. Man meint es mitzufühlen, wie Johannes sich winden
muß, wie seine Knie von selbst sich aneinander pressen, die Hände sich inein-
ander krampfen, um einen Abieiter des Schmerzes abzugeben; man fühlt den
inneren Ruck, das Zucken in der Hand des Formschneiders, als er die zackigen
Gewandzipfel bei Johannes und das brüchig sich aufbäumende Band des Lenden-
tuches schnitt. Die Gewänder umschließen wie vom Sturmwind gepeitscht die
Glieder und schlagen sie gleichsam in Fesseln, daß der Schmerz Maria und
Johannes wie am Felsen angewurzelt erscheinen läßt. Auch in diesem Bilde
gibt der Kontur die Kraft und den Rhythmus der Bewegung (Abb. 10).
Wiederum neu ist das prächtige Bild „Der Kreuzschnabel". Die Legende
besagt, daß der Vogel Kreuzschnabel allein von allen Lebewesen in der großen
Stunde von Golgatha Mitleid mit dem sterbenden Erlöser gehabt und sich auf
seine Handwunde gesetzt habe, um sie zu küssen. Wie meisterhaft hat Hartmann
diese Legendenpoesie ins Bildhafte übertragen! Fast gewaltsam erscheint auf
den ersten Blick der Gedanke, nur Kopf und Arm des Gekreuzigten in den Bild-
rahmen zu zwingen. Und doch wird gerade dadurch der Eindruck verstärkt,
da eine Verzettelung des Interesses unmöglich und das Auge immer auf den
Vogel gezwungen wird, auf den auch das Auge des Erlösers gerichtet ist, erfüllt
von Dank für das liebevolle Erbarmen des unvernünftigen Geschöpfes. Eine ge-
waltige Kraft spricht
aus diesem Erlöser-
haupte. Allerdings:
schön im üblichen
Sinne von Bildchen-
malerei ist dieses
Haupt des Gekreu-
zigten nicht; aber
die ganze Tragik der
Bestimmung, und
zugleich eine unver-
gleichlich starke und
duldsame Erlöser-
liebe spricht aus ihm.
Wir finden da die
Mystik Dürers wie Abb. 6. Der Tannenbaum.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
111
folgen schlechthin der Bewegungslinie der Gliedmaßen, bilden Untertöne in dem
großen rhythmischen Thema der Konturen. So sind diese Blätter in der Technik
des Schnittes völlig unmalerisch und rein zeichnerisch im Flächenstil gehalten.
Dennoch entsteht die notwendige Tiefe des Aktionsfeldes durch geschicktes
Hintereinander-Gruppieren der Personen (Abb. 2).
Einen völlig neuen Ton schlägt der Künstler an in seiner größeren Kreuzi-
gung. Hier arbeitet er auf Affekte hin, er wird bewußt dramatisch, die Tragik
von Golgatha wird laut. Man beachte einmal den klaren kompositioneilen Auf-
bau des Bildes, das starke Element von Symmetrie, das in ihm steckt, und wie
dennoch ohne jede Fessel der Schmerz sich auszudrücken imstande bleibt. Wieder
wirken Gegensätze mit: vollkommene Leblosigkeit im Heilandskörper, Starre,
Erschlaffung; demgegenüber in heftigen, eckigen Gebärden losbrechender Schmerz
bei den Nebenfiguren. Man meint es mitzufühlen, wie Johannes sich winden
muß, wie seine Knie von selbst sich aneinander pressen, die Hände sich inein-
ander krampfen, um einen Abieiter des Schmerzes abzugeben; man fühlt den
inneren Ruck, das Zucken in der Hand des Formschneiders, als er die zackigen
Gewandzipfel bei Johannes und das brüchig sich aufbäumende Band des Lenden-
tuches schnitt. Die Gewänder umschließen wie vom Sturmwind gepeitscht die
Glieder und schlagen sie gleichsam in Fesseln, daß der Schmerz Maria und
Johannes wie am Felsen angewurzelt erscheinen läßt. Auch in diesem Bilde
gibt der Kontur die Kraft und den Rhythmus der Bewegung (Abb. 10).
Wiederum neu ist das prächtige Bild „Der Kreuzschnabel". Die Legende
besagt, daß der Vogel Kreuzschnabel allein von allen Lebewesen in der großen
Stunde von Golgatha Mitleid mit dem sterbenden Erlöser gehabt und sich auf
seine Handwunde gesetzt habe, um sie zu küssen. Wie meisterhaft hat Hartmann
diese Legendenpoesie ins Bildhafte übertragen! Fast gewaltsam erscheint auf
den ersten Blick der Gedanke, nur Kopf und Arm des Gekreuzigten in den Bild-
rahmen zu zwingen. Und doch wird gerade dadurch der Eindruck verstärkt,
da eine Verzettelung des Interesses unmöglich und das Auge immer auf den
Vogel gezwungen wird, auf den auch das Auge des Erlösers gerichtet ist, erfüllt
von Dank für das liebevolle Erbarmen des unvernünftigen Geschöpfes. Eine ge-
waltige Kraft spricht
aus diesem Erlöser-
haupte. Allerdings:
schön im üblichen
Sinne von Bildchen-
malerei ist dieses
Haupt des Gekreu-
zigten nicht; aber
die ganze Tragik der
Bestimmung, und
zugleich eine unver-
gleichlich starke und
duldsame Erlöser-
liebe spricht aus ihm.
Wir finden da die
Mystik Dürers wie Abb. 6. Der Tannenbaum.