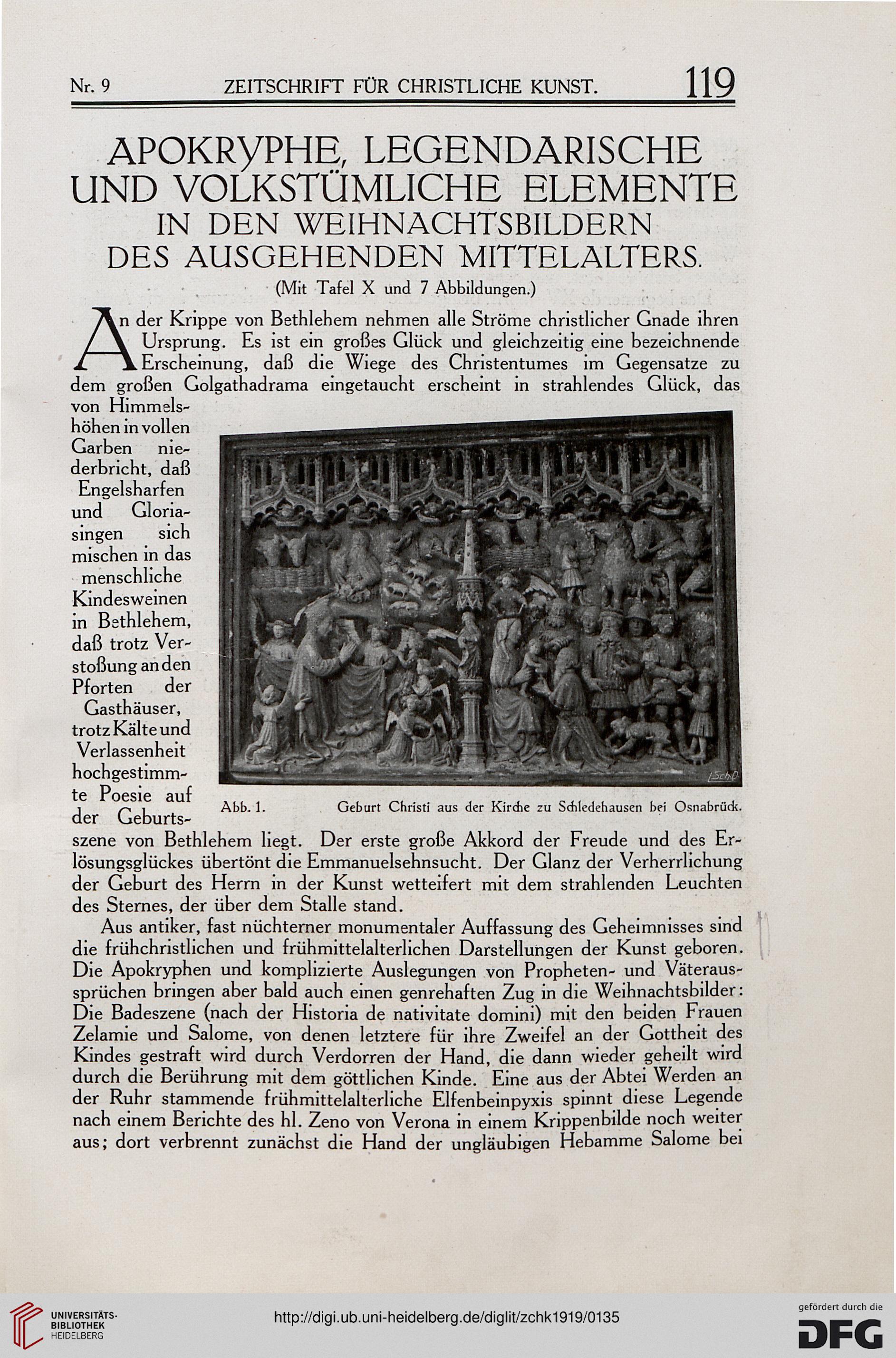Nr. 9
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
119
APOKRYPHE, LEGENDARISCHE
UND VOLKSTÜMLICHE ELEMENTE
IN DEN WEIHNACHTSBILDERN
DES AUSGEHENDEN MITTELALTERS.
(Mit Tafel X und 7 Abbildungen.)
/\n der Krippe von Bethlehem nehmen alle Ströme christlicher Gnade ihren
/ \ Ursprung. Es ist ein großes Glück und gleichzeitig eine bezeichnende
X V Erscheinung, daß die Wiege des Chnstentumes im Gegensatze zu
dem großen Golgathadrama eingetaucht erscheint in strahlendes Glück, das
von Himmels-
höhen in vollen
Garben nie-
derbricht, daß
Engelsharfen
und Gloria-
singen sich
mischen in das
menschliche
Kindesweinen
in Bethlehem,
daß trotz Ver-
stoßung an den
Pforten der
Gasthäuser,
trotz Kälte und
Verlassenheit
hochgestimm-
te Poesie auf
der Geburts-
szene von Bethlehem liegt. Der erste große Akkord der Freude und des Er-
lösungsglückes übertönt die Emmanuelsehnsucht. Der Glanz der Verherrlichung
der Geburt des Herrn in der Kunst wetteifert mit dem strahlenden Leuchten
des Sternes, der über dem Stalle stand.
Aus antiker, fast nüchterner monumentaler Auffassung des Geheimnisses sind
die frühchristlichen und frühmittelalterlichen Darstellungen der Kunst geboren.
Die Apokryphen und komplizierte Auslegungen von Propheten- und Väteraus-
sprüchen bringen aber bald auch einen genrehaften Zug in die Weihnachtsbilder:
Die Badeszene (nach der Historia de nativitate domini) mit den beiden Frauen
Zelamie und Salome, von denen letztere für ihre Zweifel an der Gottheit des
Kindes gestraft wird durch Verdorren der Hand, die dann wieder geheilt wird
durch die Berührung mit dem göttlichen Kinde. Eine aus der Abtei Werden an
der Ruhr stammende frühmittelalterliche Elfenbeinpyxis spinnt diese Legende
nach einem Berichte des hl. Zeno von Verona in einem Krippenbilde noch weiter
aus; dort verbrennt zunächst die Hand der ungläubigen Hebamme Salome bei
Abb. 1.
Geburt Christi aus der Kirche zu Schiedehausen bei Osnabrück.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
119
APOKRYPHE, LEGENDARISCHE
UND VOLKSTÜMLICHE ELEMENTE
IN DEN WEIHNACHTSBILDERN
DES AUSGEHENDEN MITTELALTERS.
(Mit Tafel X und 7 Abbildungen.)
/\n der Krippe von Bethlehem nehmen alle Ströme christlicher Gnade ihren
/ \ Ursprung. Es ist ein großes Glück und gleichzeitig eine bezeichnende
X V Erscheinung, daß die Wiege des Chnstentumes im Gegensatze zu
dem großen Golgathadrama eingetaucht erscheint in strahlendes Glück, das
von Himmels-
höhen in vollen
Garben nie-
derbricht, daß
Engelsharfen
und Gloria-
singen sich
mischen in das
menschliche
Kindesweinen
in Bethlehem,
daß trotz Ver-
stoßung an den
Pforten der
Gasthäuser,
trotz Kälte und
Verlassenheit
hochgestimm-
te Poesie auf
der Geburts-
szene von Bethlehem liegt. Der erste große Akkord der Freude und des Er-
lösungsglückes übertönt die Emmanuelsehnsucht. Der Glanz der Verherrlichung
der Geburt des Herrn in der Kunst wetteifert mit dem strahlenden Leuchten
des Sternes, der über dem Stalle stand.
Aus antiker, fast nüchterner monumentaler Auffassung des Geheimnisses sind
die frühchristlichen und frühmittelalterlichen Darstellungen der Kunst geboren.
Die Apokryphen und komplizierte Auslegungen von Propheten- und Väteraus-
sprüchen bringen aber bald auch einen genrehaften Zug in die Weihnachtsbilder:
Die Badeszene (nach der Historia de nativitate domini) mit den beiden Frauen
Zelamie und Salome, von denen letztere für ihre Zweifel an der Gottheit des
Kindes gestraft wird durch Verdorren der Hand, die dann wieder geheilt wird
durch die Berührung mit dem göttlichen Kinde. Eine aus der Abtei Werden an
der Ruhr stammende frühmittelalterliche Elfenbeinpyxis spinnt diese Legende
nach einem Berichte des hl. Zeno von Verona in einem Krippenbilde noch weiter
aus; dort verbrennt zunächst die Hand der ungläubigen Hebamme Salome bei
Abb. 1.
Geburt Christi aus der Kirche zu Schiedehausen bei Osnabrück.