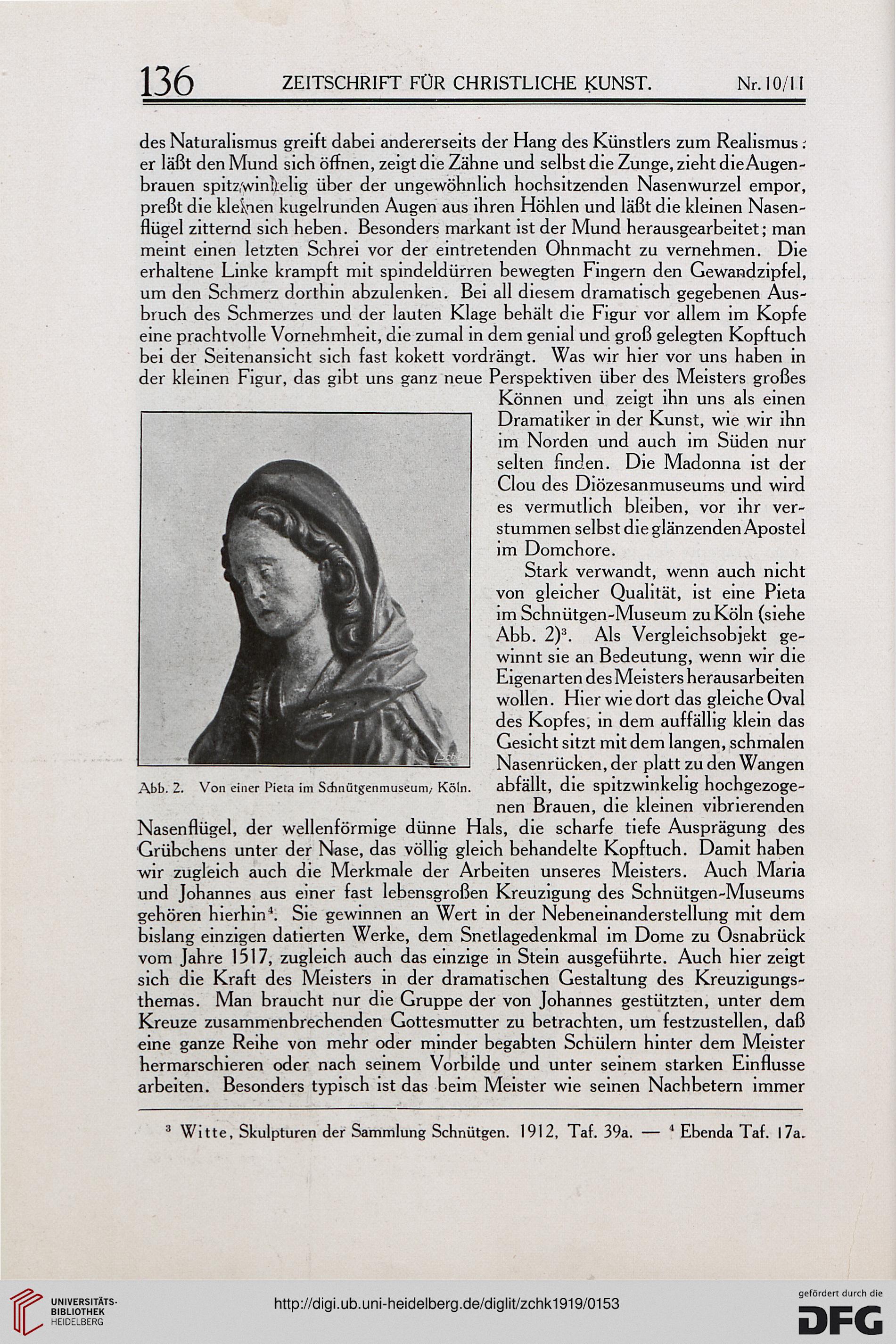136
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 10/1
des Naturalismus greift dabei andererseits der Hang des Künstlers zum Realismus:
er läßt den Mund sich öffnen, zeigt die Zähne und selbst die Zunge, zieht die Augen-
brauen spitz.winltehg über der ungewöhnlich hochsitzenden Nasenwurzel empor,
preßt die kleben kugelrunden Augen aus ihren Höhlen und läßt die kleinen Nasen-
flügel zitternd sich heben. Besonders markant ist der Mund herausgearbeitet; man
meint einen letzten Schrei vor der eintretenden Ohnmacht zu vernehmen. Die
erhaltene Linke krampft mit spindeldürren bewegten Fingern den Gewandzipfel,
um den Schmerz dorthin abzulenken. Bei all diesem dramatisch gegebenen Aus-
bruch des Schmerzes und der lauten Klage behält die Figur vor allem im Kopfe
eine prachtvolle Vornehmheit, die zumal in dem genial und groß gelegten Kopftuch
bei der Seitenansicht sich fast kokett vordrängt. Was wir hier vor uns haben in
der kleinen Figur, das gibt uns ganz neue Perspektiven über des Meisters großes
Können und zeigt ihn uns als einen
Dramatiker in der Kunst, wie wir ihn
im Norden und auch im Süden nur
selten finden. Die Madonna ist der
Clou des Diözesanmuseums und wird
es vermutlich bleiben, vor ihr ver-
stummen selbst die glänzenden Apostel
im Domchore.
Stark verwandt, wenn auch nicht
von gleicher Qualität, ist eine Pieta
im Schnütgen-Museum zu Köln (siehe
Abb. 2)3. Als Vergleichsobjekt ge-
winnt sie an Bedeutung, wenn wir die
Eigenarten des Meisters herausarbeiten
wollen. Hier wie dort das gleiche Oval
des Kopfes, in dem auffällig klein das
Gesicht sitzt mit dem langen, schmalen
Nasenrücken, der platt zu den Wangen
abfällt, die spitzwinkelig hochgezoge-
nen Brauen, die kleinen vibrierenden
Nasenflügel, der wellenförmige dünne Hals, die scharfe tiefe Ausprägung des
Grübchens unter der Nase, das völlig gleich behandelte Kopftuch. Damit haben
wir zugleich auch die Merkmale der Arbeiten unseres Meisters. Auch Maria
und Johannes aus einer fast lebensgroßen Kreuzigung des Schnütgen-Museums
gehören hierhin4. Sie gewinnen an Wert in der Nebeneinanderstellung mit dem
bislang einzigen datierten Werke, dem Snetlagedenkmal im Dome zu Osnabrück
vom Jahre 1517, zugleich auch das einzige in Stein ausgeführte. Auch hier zeigt
sich die Kraft des Meisters in der dramatischen Gestaltung des Kreuzigungs-
themas. Man braucht nur die Gruppe der von Johannes gestützten, unter dem
Kreuze zusammenbrechenden Gottesmutter zu betrachten, um festzustellen, daß
eine ganze Reihe von mehr oder minder begabten Schülern hinter dem Meister
hermarschieren oder nach seinem Vorbilde und unter seinem starken Einflüsse
arbeiten. Besonders typisch ist das beim Meister wie seinen Nachbetern immer
Abb. 2. Von einer Pieta im Sdinütgenmuseum,- Köln.
3 Witte, Skulpturen der Sammlung Schnütgen. 1912, Taf. 39a. — 4 Ebenda Taf. 17a.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 10/1
des Naturalismus greift dabei andererseits der Hang des Künstlers zum Realismus:
er läßt den Mund sich öffnen, zeigt die Zähne und selbst die Zunge, zieht die Augen-
brauen spitz.winltehg über der ungewöhnlich hochsitzenden Nasenwurzel empor,
preßt die kleben kugelrunden Augen aus ihren Höhlen und läßt die kleinen Nasen-
flügel zitternd sich heben. Besonders markant ist der Mund herausgearbeitet; man
meint einen letzten Schrei vor der eintretenden Ohnmacht zu vernehmen. Die
erhaltene Linke krampft mit spindeldürren bewegten Fingern den Gewandzipfel,
um den Schmerz dorthin abzulenken. Bei all diesem dramatisch gegebenen Aus-
bruch des Schmerzes und der lauten Klage behält die Figur vor allem im Kopfe
eine prachtvolle Vornehmheit, die zumal in dem genial und groß gelegten Kopftuch
bei der Seitenansicht sich fast kokett vordrängt. Was wir hier vor uns haben in
der kleinen Figur, das gibt uns ganz neue Perspektiven über des Meisters großes
Können und zeigt ihn uns als einen
Dramatiker in der Kunst, wie wir ihn
im Norden und auch im Süden nur
selten finden. Die Madonna ist der
Clou des Diözesanmuseums und wird
es vermutlich bleiben, vor ihr ver-
stummen selbst die glänzenden Apostel
im Domchore.
Stark verwandt, wenn auch nicht
von gleicher Qualität, ist eine Pieta
im Schnütgen-Museum zu Köln (siehe
Abb. 2)3. Als Vergleichsobjekt ge-
winnt sie an Bedeutung, wenn wir die
Eigenarten des Meisters herausarbeiten
wollen. Hier wie dort das gleiche Oval
des Kopfes, in dem auffällig klein das
Gesicht sitzt mit dem langen, schmalen
Nasenrücken, der platt zu den Wangen
abfällt, die spitzwinkelig hochgezoge-
nen Brauen, die kleinen vibrierenden
Nasenflügel, der wellenförmige dünne Hals, die scharfe tiefe Ausprägung des
Grübchens unter der Nase, das völlig gleich behandelte Kopftuch. Damit haben
wir zugleich auch die Merkmale der Arbeiten unseres Meisters. Auch Maria
und Johannes aus einer fast lebensgroßen Kreuzigung des Schnütgen-Museums
gehören hierhin4. Sie gewinnen an Wert in der Nebeneinanderstellung mit dem
bislang einzigen datierten Werke, dem Snetlagedenkmal im Dome zu Osnabrück
vom Jahre 1517, zugleich auch das einzige in Stein ausgeführte. Auch hier zeigt
sich die Kraft des Meisters in der dramatischen Gestaltung des Kreuzigungs-
themas. Man braucht nur die Gruppe der von Johannes gestützten, unter dem
Kreuze zusammenbrechenden Gottesmutter zu betrachten, um festzustellen, daß
eine ganze Reihe von mehr oder minder begabten Schülern hinter dem Meister
hermarschieren oder nach seinem Vorbilde und unter seinem starken Einflüsse
arbeiten. Besonders typisch ist das beim Meister wie seinen Nachbetern immer
Abb. 2. Von einer Pieta im Sdinütgenmuseum,- Köln.
3 Witte, Skulpturen der Sammlung Schnütgen. 1912, Taf. 39a. — 4 Ebenda Taf. 17a.