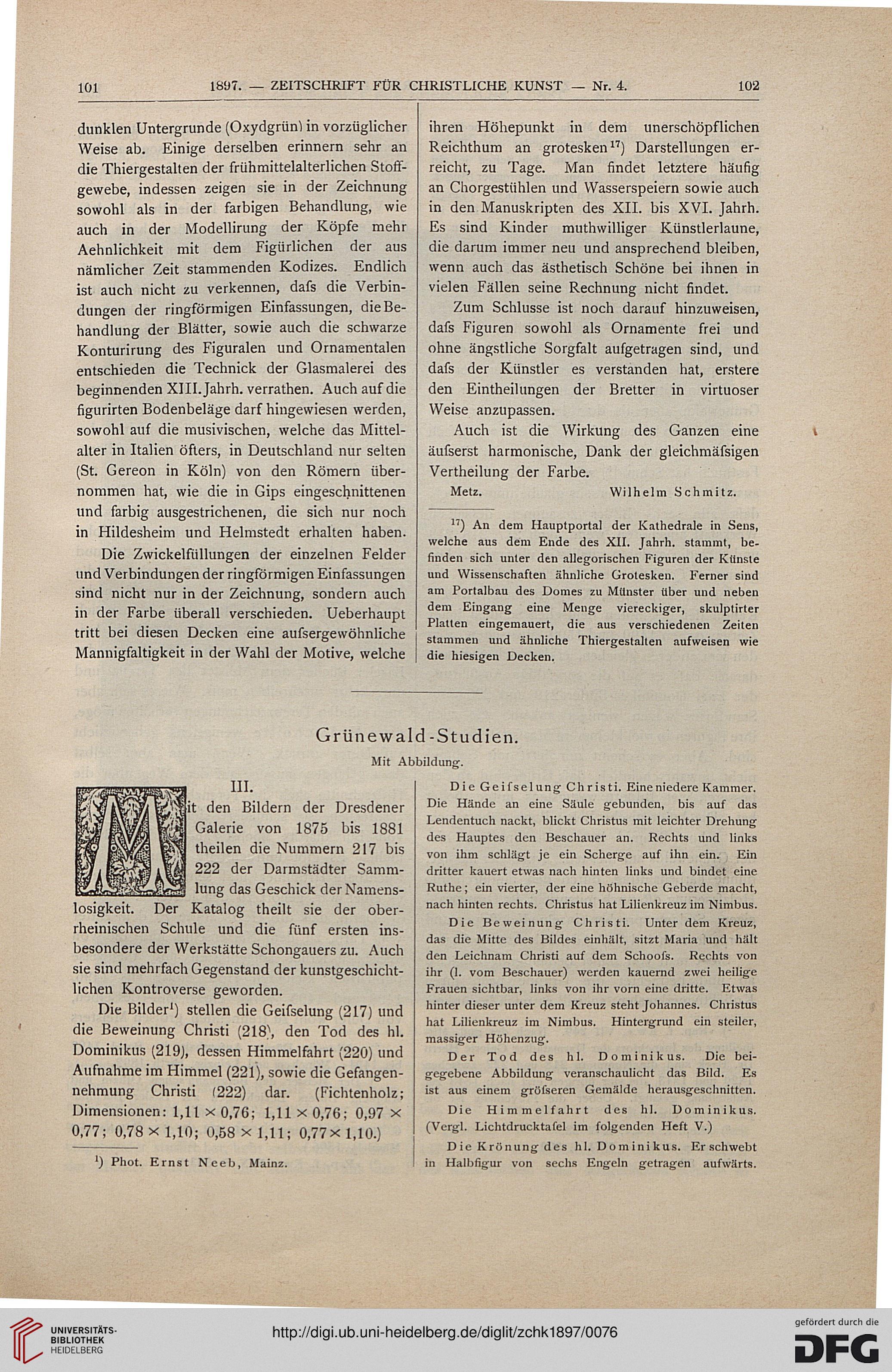101
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
102
dunklen Untergrunde (Oxydgrün) in vorzüglicher
Weise ab. Einige derselben erinnern sehr an
die Thiergestalten der frühmittelalterlichen Stoff-
gewebe, indessen zeigen sie in der Zeichnung
sowohl als in der farbigen Behandlung, wie
auch in der Modellirung der Köpfe mehr
Aehnlichkeit mit dem Figürlichen der aus
nämlicher Zeit stammenden Kodizes. Endlich
ist auch nicht zu verkennen, dafs die Verbin-
dungen der ringförmigen Einfassungen, die Be-
handlung der Blätter, sowie auch die schwarze
Konturirung des Figuralen und Ornamentalen
entschieden die Technick der Glasmalerei des
beginnenden XHI.Jahrh. verrathen. Auch auf die
figurirten Bodenbeläge darf hingewiesen werden,
sowohl auf die musivischen, welche das Mittel-
alter in Italien öfters, in Deutschland nur selten
(St. Gereon in Köln) von den Römern über-
nommen hat, wie die in Gips eingeschnittenen
und farbig ausgestrichenen, die sich nur noch
in Hildesheim und Helmstedt erhalten haben.
Die Zwickelfüllungen der einzelnen Felder
und Verbindungen der ringförmigen Einfassungen
sind nicht nur in der Zeichnung, sondern auch
in der Farbe überall verschieden. Ueberhaupt
tritt bei diesen Decken eine aufsergewöhnliche
Mannigfaltigkeit in der Wahl der Motive, welche
ihren Höhepunkt in dem unerschöpflichen
Reichthum an grotesken17) Darstellungen er-
reicht, zu Tage. Man findet letztere häufig
an Chorgestühlen und Wasserspeiern sowie auch
in den Manuskripten des XII. bis XVI. Jahrh.
Es sind Kinder muthwilliger Künstlerlaune,
die darum immer neu und ansprechend bleiben,
wenn auch das ästhetisch Schöne bei ihnen in
vielen Fällen seine Rechnung nicht findet.
Zum Schlüsse ist noch darauf hinzuweisen,
dafs Figuren sowohl als Ornamente frei und
ohne ängstliche Sorgfalt aufgetragen sind, und
dafs der Künstler es verstanden hat, erstere
den Eintheilungen der Bretter in virtuoser
Weise anzupassen.
Auch ist die Wirkung des Ganzen eine
äufserst harmonische, Dank der gleichmäfsigen
Vertheilung der Farbe.
Metz. Wilhelm Schmitz.
1?) An dem Hauptportal der Kathedrale in Sens,
welche aus dem Ende des XII. Jahrh. stammt, be-
finden sich unter den allegorischen Figuren der Künste
und Wissenschaften ähnliche Grotesken. Ferner sind
am Portalbau des Domes zu Münster über und neben
dem Eingang eine Menge viereckiger, skulptirter
Platten eingemauert, die aus verschiedenen Zeiten
stammen und ähnliche Thiergestalten aufweisen wie
die hiesigen Decken.
Grünewald-Studien.
Mit Abbildung.
WM
?W J
Sri E
K'-S
ffimmrfr^
III.
Sit den Bildern der Dresdener
Galerie von 1875 bis 1881
theilen die Nummern 217 bis
222 der Darmstädter Samm-
lung das Geschick derNamens-
losigkeit. Der Katalog theilt sie der ober-
rheinischen Schule und die fünf ersten ins-
besondere der Werkstätte Schongauers zu. Auch
sie sind mehrfach Gegenstand der kunstgeschicht-
lichen Kontroverse geworden.
Die Bilder1) stellen die Geifselung (217) und
die Beweinung Christi (218), den Tod des hl.
Dominikus (219), dessen Himmelfahrt (220) und
Aufnahme im Himmel (221), sowie die Gefangen-
nehmung Christi (222) dar. (Fichtenholz;
Dimensionen: 1,11 x 0,76; 1,11 x 0,76; 0,97 x
0,77; 0,78x1,10; 0,58x1,11; 0,77x1,10.)
') Phot. Ernst Neeb, Mainz.
Die Geifselung Christi. Eine niedere Kammer.
Die Hände an eine Säule gebunden, bis auf das
Lendentuch nackt, blickt Christus mit leichter Drehung
des Hauptes den Beschauer an. Rechts und links
von ihm schlägt je ein Scherge auf ihn ein. Ein
dritter kauert etwas nach hinten links und bindet eine
Ruthe; ein vierter, der eine höhnische Geberde macht,
nach hinten rechts. Christus hat Lilienkreuz im Nimbus.
Die Beweinung Christi. Unter dem Kreuz,
das die Mitte des Bildes einhält, sitzt Maria und hält
den Leichnam Christi auf dem Schoofs. Rechts von
ihr (1. vom Beschauer) werden kauernd zwei heilige
Frauen sichtbar, links von ihr vorn eine dritte. Etwas
hinter dieser unter dem Kreuz steht Johannes. Christus
hat Lilienkreuz im Nimbus. Hintergrund ein steiler,
massiger Höhenzug.
Der Tod des hl. Dominikus. Die bei-
gegebene Abbildung veranschaulicht das Bild. Es
ist aus einem gröfseren Gemälde herausgeschnitten.
Die Himmelfahrt des hl. Dominikus.
(Vergl. Lichtdrucktafel im folgenden Heft V.)
Die Krönung des hl. Dominikus. Er schwebt
in Halbfigur von sechs Engeln getragen aufwärts.
1897.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
102
dunklen Untergrunde (Oxydgrün) in vorzüglicher
Weise ab. Einige derselben erinnern sehr an
die Thiergestalten der frühmittelalterlichen Stoff-
gewebe, indessen zeigen sie in der Zeichnung
sowohl als in der farbigen Behandlung, wie
auch in der Modellirung der Köpfe mehr
Aehnlichkeit mit dem Figürlichen der aus
nämlicher Zeit stammenden Kodizes. Endlich
ist auch nicht zu verkennen, dafs die Verbin-
dungen der ringförmigen Einfassungen, die Be-
handlung der Blätter, sowie auch die schwarze
Konturirung des Figuralen und Ornamentalen
entschieden die Technick der Glasmalerei des
beginnenden XHI.Jahrh. verrathen. Auch auf die
figurirten Bodenbeläge darf hingewiesen werden,
sowohl auf die musivischen, welche das Mittel-
alter in Italien öfters, in Deutschland nur selten
(St. Gereon in Köln) von den Römern über-
nommen hat, wie die in Gips eingeschnittenen
und farbig ausgestrichenen, die sich nur noch
in Hildesheim und Helmstedt erhalten haben.
Die Zwickelfüllungen der einzelnen Felder
und Verbindungen der ringförmigen Einfassungen
sind nicht nur in der Zeichnung, sondern auch
in der Farbe überall verschieden. Ueberhaupt
tritt bei diesen Decken eine aufsergewöhnliche
Mannigfaltigkeit in der Wahl der Motive, welche
ihren Höhepunkt in dem unerschöpflichen
Reichthum an grotesken17) Darstellungen er-
reicht, zu Tage. Man findet letztere häufig
an Chorgestühlen und Wasserspeiern sowie auch
in den Manuskripten des XII. bis XVI. Jahrh.
Es sind Kinder muthwilliger Künstlerlaune,
die darum immer neu und ansprechend bleiben,
wenn auch das ästhetisch Schöne bei ihnen in
vielen Fällen seine Rechnung nicht findet.
Zum Schlüsse ist noch darauf hinzuweisen,
dafs Figuren sowohl als Ornamente frei und
ohne ängstliche Sorgfalt aufgetragen sind, und
dafs der Künstler es verstanden hat, erstere
den Eintheilungen der Bretter in virtuoser
Weise anzupassen.
Auch ist die Wirkung des Ganzen eine
äufserst harmonische, Dank der gleichmäfsigen
Vertheilung der Farbe.
Metz. Wilhelm Schmitz.
1?) An dem Hauptportal der Kathedrale in Sens,
welche aus dem Ende des XII. Jahrh. stammt, be-
finden sich unter den allegorischen Figuren der Künste
und Wissenschaften ähnliche Grotesken. Ferner sind
am Portalbau des Domes zu Münster über und neben
dem Eingang eine Menge viereckiger, skulptirter
Platten eingemauert, die aus verschiedenen Zeiten
stammen und ähnliche Thiergestalten aufweisen wie
die hiesigen Decken.
Grünewald-Studien.
Mit Abbildung.
WM
?W J
Sri E
K'-S
ffimmrfr^
III.
Sit den Bildern der Dresdener
Galerie von 1875 bis 1881
theilen die Nummern 217 bis
222 der Darmstädter Samm-
lung das Geschick derNamens-
losigkeit. Der Katalog theilt sie der ober-
rheinischen Schule und die fünf ersten ins-
besondere der Werkstätte Schongauers zu. Auch
sie sind mehrfach Gegenstand der kunstgeschicht-
lichen Kontroverse geworden.
Die Bilder1) stellen die Geifselung (217) und
die Beweinung Christi (218), den Tod des hl.
Dominikus (219), dessen Himmelfahrt (220) und
Aufnahme im Himmel (221), sowie die Gefangen-
nehmung Christi (222) dar. (Fichtenholz;
Dimensionen: 1,11 x 0,76; 1,11 x 0,76; 0,97 x
0,77; 0,78x1,10; 0,58x1,11; 0,77x1,10.)
') Phot. Ernst Neeb, Mainz.
Die Geifselung Christi. Eine niedere Kammer.
Die Hände an eine Säule gebunden, bis auf das
Lendentuch nackt, blickt Christus mit leichter Drehung
des Hauptes den Beschauer an. Rechts und links
von ihm schlägt je ein Scherge auf ihn ein. Ein
dritter kauert etwas nach hinten links und bindet eine
Ruthe; ein vierter, der eine höhnische Geberde macht,
nach hinten rechts. Christus hat Lilienkreuz im Nimbus.
Die Beweinung Christi. Unter dem Kreuz,
das die Mitte des Bildes einhält, sitzt Maria und hält
den Leichnam Christi auf dem Schoofs. Rechts von
ihr (1. vom Beschauer) werden kauernd zwei heilige
Frauen sichtbar, links von ihr vorn eine dritte. Etwas
hinter dieser unter dem Kreuz steht Johannes. Christus
hat Lilienkreuz im Nimbus. Hintergrund ein steiler,
massiger Höhenzug.
Der Tod des hl. Dominikus. Die bei-
gegebene Abbildung veranschaulicht das Bild. Es
ist aus einem gröfseren Gemälde herausgeschnitten.
Die Himmelfahrt des hl. Dominikus.
(Vergl. Lichtdrucktafel im folgenden Heft V.)
Die Krönung des hl. Dominikus. Er schwebt
in Halbfigur von sechs Engeln getragen aufwärts.