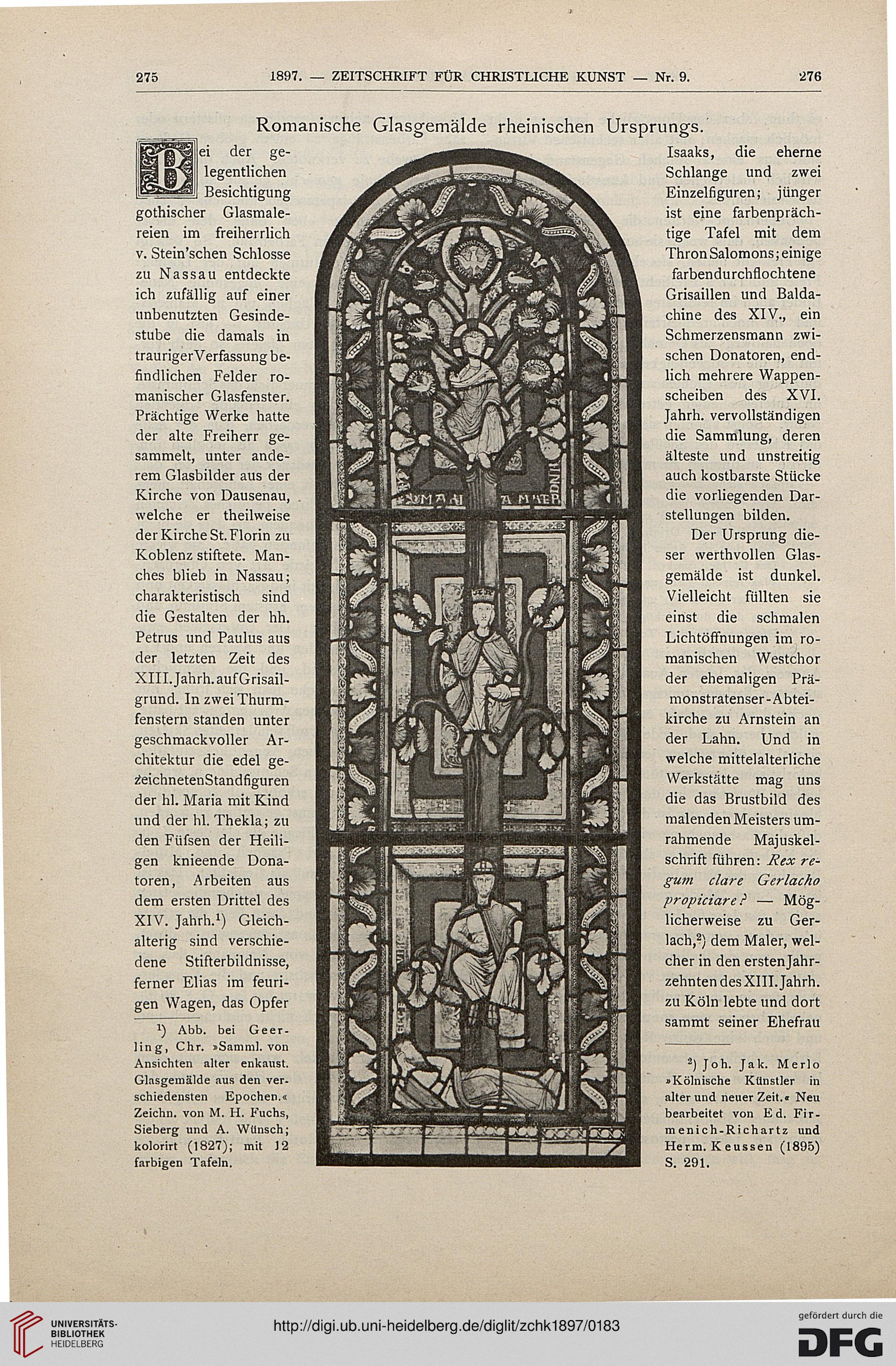275
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
276
ei der ge-
legentlichen
Besichtigung
gothischer Glasmale-
reien im freiherrlich
v. Stein'schen Schlosse
zu Nassau entdeckte
ich zufällig auf einer
unbenutzten Gesinde-
stube die damals in
traurigerVerfassung be-
findlichen Felder ro-
manischer Glasfenster.
Prächtige Werke hatte
der alte Freiherr ge-
sammelt, unter ande-
rem Glasbilder aus der
Kirche von Dausenau,
welche er theilweise
der Kirche St. Florin zu
Koblenz stiftete. Man-
ches blieb in Nassau;
charakteristisch sind
die Gestalten der hh.
Petrus und Paulus aus
der letzten Zeit des
XIII. Jahrh. auf Grisail-
grund. In zweiThurm-
fenstern standen unter
geschmackvoller Ar-
chitektur die edel ge-
z*eichnetenStandfiguren
der hl. Maria mit Kind
und der hl. Thekla; zu
den Füfsen der Heili-
gen knieende Dona-
toren, Arbeiten aus
dem ersten Drittel des
XIV. Jahrh.1) Gleich-
alterig sind verschie-
dene Stifterbildnisse,
ferner Elias im feuri-
gen Wagen, das Opfer
!) Abb. bei Geer-
ling, Chr. »Samml. von
Ansichten alter enkaust.
Glasgemälde aus den ver-
schiedensten Epochen.«
Zeichn. von M. H. Fuchs,
Sieberg und A. Wünsch;
kolorirt (1827); mit 12
farbigen Tafeln.
Romanische Glasgemälde rheinischen Ursprungs.
Isaaks,
die eherne
Schlange und zwei
Einzelfiguren; jünger
ist eine farbenpräch-
tige Tafel mit dem
Thron Salomons; einige
farbendurchflochtene
Grisaillen und Balda-
chine des XIV., ein
Schmerzensmann zwi-
schen Donatoren, end-
lich mehrere Wappen-
scheiben des XVI.
Jahrh. vervollständigen
die Sammlung, deren
älteste und unstreitig
auch kostbarste Stücke
die vorliegenden Dar-
stellungen bilden.
Der Ursprung die-
ser werthvollen Glas-
gemälde ist dunkel.
Vielleicht füllten sie
einst die schmalen
Lichtöffnungen im ro-
manischen Westchor
der ehemaligen Prä-
monstratenser-Abtei-
kirche zu Arnstein an
der Lahn. Und in
welche mittelalterliche
Werkstätte mag uns
die das Brustbild des
malenden Meisters um-
rahmende Majuskel-
schrift führen: Sex re-
gum clare Gerlacho
propiciare? — Mög-
licherweise zu Ger-
lach,2) dem Maler, wel-
cher in den ersten Jahr-
zehnten des XIII. Jahrh.
zu Köln lebte und dort
sammt seiner Ehefrau
2) Joh. Jak. Merlo
»Kölnische Künstler in
alterund neuer Zeit.« Neu
bearbeitet von Ed. Fir-
menich-Richartz und
Herrn. Keussen (1895)
S. 291.
1897. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
276
ei der ge-
legentlichen
Besichtigung
gothischer Glasmale-
reien im freiherrlich
v. Stein'schen Schlosse
zu Nassau entdeckte
ich zufällig auf einer
unbenutzten Gesinde-
stube die damals in
traurigerVerfassung be-
findlichen Felder ro-
manischer Glasfenster.
Prächtige Werke hatte
der alte Freiherr ge-
sammelt, unter ande-
rem Glasbilder aus der
Kirche von Dausenau,
welche er theilweise
der Kirche St. Florin zu
Koblenz stiftete. Man-
ches blieb in Nassau;
charakteristisch sind
die Gestalten der hh.
Petrus und Paulus aus
der letzten Zeit des
XIII. Jahrh. auf Grisail-
grund. In zweiThurm-
fenstern standen unter
geschmackvoller Ar-
chitektur die edel ge-
z*eichnetenStandfiguren
der hl. Maria mit Kind
und der hl. Thekla; zu
den Füfsen der Heili-
gen knieende Dona-
toren, Arbeiten aus
dem ersten Drittel des
XIV. Jahrh.1) Gleich-
alterig sind verschie-
dene Stifterbildnisse,
ferner Elias im feuri-
gen Wagen, das Opfer
!) Abb. bei Geer-
ling, Chr. »Samml. von
Ansichten alter enkaust.
Glasgemälde aus den ver-
schiedensten Epochen.«
Zeichn. von M. H. Fuchs,
Sieberg und A. Wünsch;
kolorirt (1827); mit 12
farbigen Tafeln.
Romanische Glasgemälde rheinischen Ursprungs.
Isaaks,
die eherne
Schlange und zwei
Einzelfiguren; jünger
ist eine farbenpräch-
tige Tafel mit dem
Thron Salomons; einige
farbendurchflochtene
Grisaillen und Balda-
chine des XIV., ein
Schmerzensmann zwi-
schen Donatoren, end-
lich mehrere Wappen-
scheiben des XVI.
Jahrh. vervollständigen
die Sammlung, deren
älteste und unstreitig
auch kostbarste Stücke
die vorliegenden Dar-
stellungen bilden.
Der Ursprung die-
ser werthvollen Glas-
gemälde ist dunkel.
Vielleicht füllten sie
einst die schmalen
Lichtöffnungen im ro-
manischen Westchor
der ehemaligen Prä-
monstratenser-Abtei-
kirche zu Arnstein an
der Lahn. Und in
welche mittelalterliche
Werkstätte mag uns
die das Brustbild des
malenden Meisters um-
rahmende Majuskel-
schrift führen: Sex re-
gum clare Gerlacho
propiciare? — Mög-
licherweise zu Ger-
lach,2) dem Maler, wel-
cher in den ersten Jahr-
zehnten des XIII. Jahrh.
zu Köln lebte und dort
sammt seiner Ehefrau
2) Joh. Jak. Merlo
»Kölnische Künstler in
alterund neuer Zeit.« Neu
bearbeitet von Ed. Fir-
menich-Richartz und
Herrn. Keussen (1895)
S. 291.