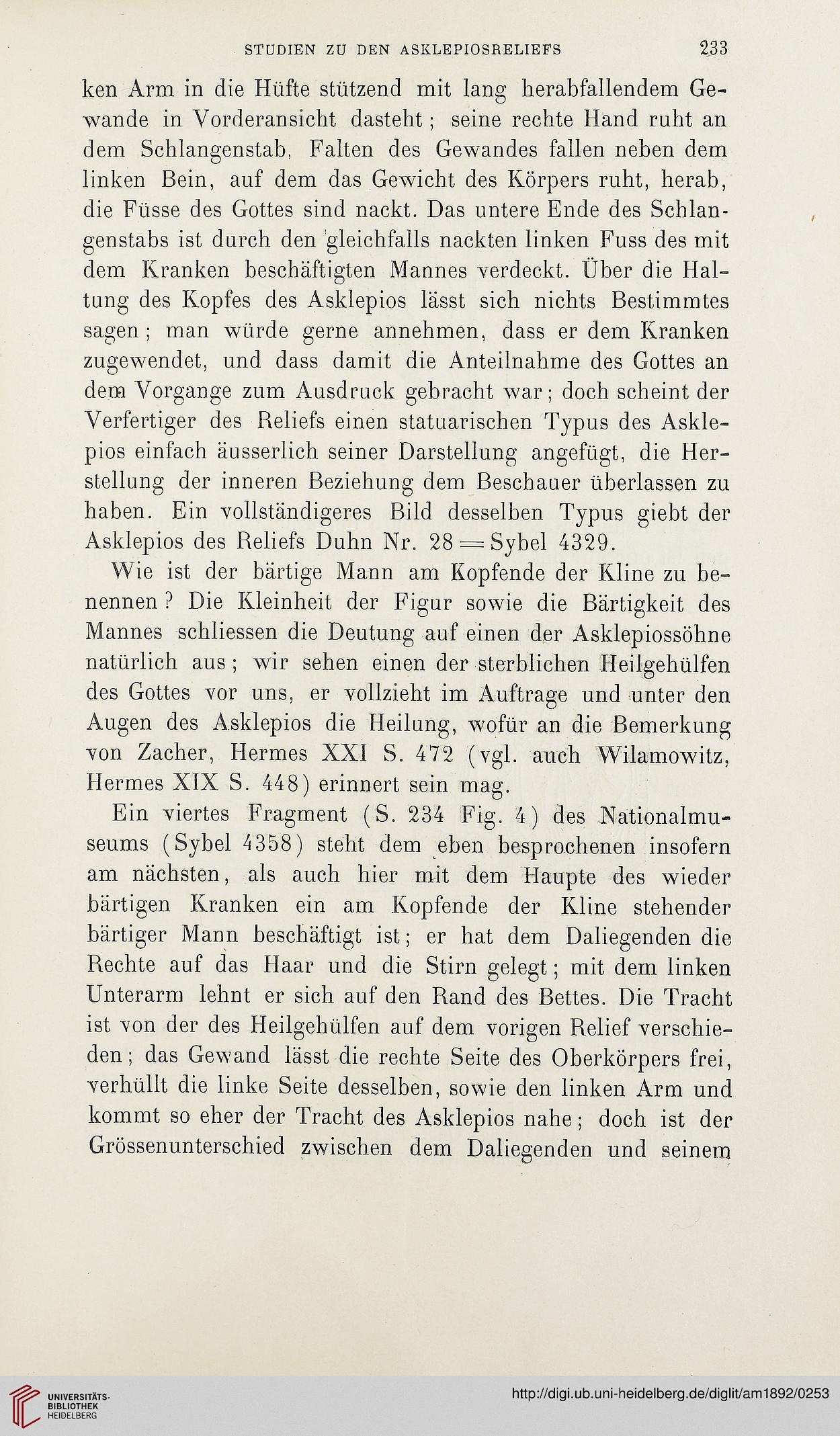STUDIEN ZU DEN ASKLEPIOSRELIEFS 233
ken Arm in die Hüfte stützend mit lang herabfallendem Ge-
wände in Vorderansicht dasteht; seine rechte Hand ruht an
dem Schlangenstab, Falten des Gewandes fallen neben dem
linken Bein, auf dem das Gewicht des Körpers ruht, herab,
die Füsse des Gottes sind nackt. Das untere Ende des Schlan-
genstabs ist durch den gleichfalls nackten linken Fuss des mit
dem Kranken beschäftigten Mannes verdeckt. Über die Hal-
tung des Kopfes des Asklepios lässt sich nichts Bestimmtes
sagen ; man würde gerne annehmen, dass er dem Kranken
zugewendet, und dass damit die Anteilnahme des Gottes an
dem Vorgänge zum Ausdruck gebracht war; doch scheint der
Verfertiger des Beliefs einen statuarischen Typus des Askle-
pios einfach äusserlich seiner Darstellung angefügt, die Her-
stellung der inneren Beziehung dem Beschauer überlassen zu
haben. Ein vollständigeres Bild desselben Typus giebt der
Asklepios des Reliefs Duhn Nr. 28 = Sybel 4329.
Wie ist der bärtige Mann am Kopfende der Kline zu be-
nennen ? Die Kleinheit der Figur sowie die Bärtigkeit des
Mannes schliessen die Deutung auf einen der Asklepiossöhne
natürlich aus ; wir sehen einen der sterblichen Heilgehülfen
des Gottes vor uns, er vollzieht im Aufträge und unter den
Augen des Asklepios die Heilung, wofür an die Bemerkung
von Zacher, Hermes XXI S. 472 (vgl. auch Wilamowitz,
Hermes XIX S. 448) erinnert sein mag.
Ein viertes Fragment (S. 234 Fig. 4) des Nationalmu-
seums (Sybel 4358) steht dem eben besprochenen insofern
am nächsten, als auch hier mit dem Haupte des wieder
bärtigen Kranken ein am Kopfende der Kline stehender
bärtiger Mann beschäftigt ist; er hat dem Daliegenden die
Rechte auf das Haar und die Stirn gelegt; mit dem linken
Unterarm lehnt er sich auf den Rand des Bettes. Die Tracht
ist von der des Heilgehülfen auf dem vorigen Relief verschie-
den; das Gewand lässt die rechte Seite des Oberkörpers frei,
verhüllt die linke Seite desselben, sowie den linken Arm und
kommt so eher der Tracht des Asklepios nahe; doch ist der
Grössenunterschied zwischen dem Daliegenden und seinem
ken Arm in die Hüfte stützend mit lang herabfallendem Ge-
wände in Vorderansicht dasteht; seine rechte Hand ruht an
dem Schlangenstab, Falten des Gewandes fallen neben dem
linken Bein, auf dem das Gewicht des Körpers ruht, herab,
die Füsse des Gottes sind nackt. Das untere Ende des Schlan-
genstabs ist durch den gleichfalls nackten linken Fuss des mit
dem Kranken beschäftigten Mannes verdeckt. Über die Hal-
tung des Kopfes des Asklepios lässt sich nichts Bestimmtes
sagen ; man würde gerne annehmen, dass er dem Kranken
zugewendet, und dass damit die Anteilnahme des Gottes an
dem Vorgänge zum Ausdruck gebracht war; doch scheint der
Verfertiger des Beliefs einen statuarischen Typus des Askle-
pios einfach äusserlich seiner Darstellung angefügt, die Her-
stellung der inneren Beziehung dem Beschauer überlassen zu
haben. Ein vollständigeres Bild desselben Typus giebt der
Asklepios des Reliefs Duhn Nr. 28 = Sybel 4329.
Wie ist der bärtige Mann am Kopfende der Kline zu be-
nennen ? Die Kleinheit der Figur sowie die Bärtigkeit des
Mannes schliessen die Deutung auf einen der Asklepiossöhne
natürlich aus ; wir sehen einen der sterblichen Heilgehülfen
des Gottes vor uns, er vollzieht im Aufträge und unter den
Augen des Asklepios die Heilung, wofür an die Bemerkung
von Zacher, Hermes XXI S. 472 (vgl. auch Wilamowitz,
Hermes XIX S. 448) erinnert sein mag.
Ein viertes Fragment (S. 234 Fig. 4) des Nationalmu-
seums (Sybel 4358) steht dem eben besprochenen insofern
am nächsten, als auch hier mit dem Haupte des wieder
bärtigen Kranken ein am Kopfende der Kline stehender
bärtiger Mann beschäftigt ist; er hat dem Daliegenden die
Rechte auf das Haar und die Stirn gelegt; mit dem linken
Unterarm lehnt er sich auf den Rand des Bettes. Die Tracht
ist von der des Heilgehülfen auf dem vorigen Relief verschie-
den; das Gewand lässt die rechte Seite des Oberkörpers frei,
verhüllt die linke Seite desselben, sowie den linken Arm und
kommt so eher der Tracht des Asklepios nahe; doch ist der
Grössenunterschied zwischen dem Daliegenden und seinem