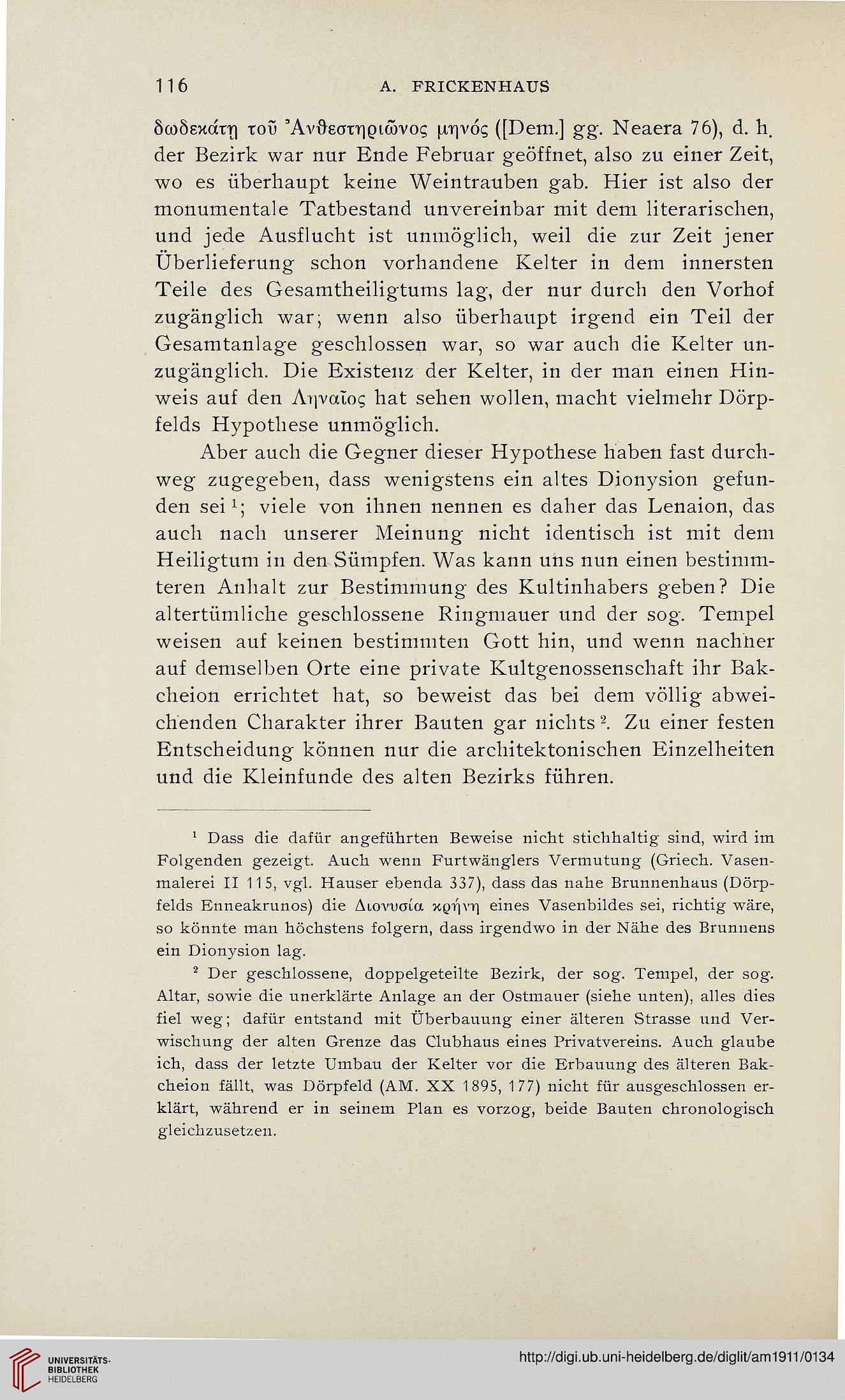116
A. FRICKENHAUS
StoSexctTT] Toü WvÜEdippLtovog pY]vö$ ([Dem.] gg. Neaera 76), d. h.
der Bezirk war nur Ende Februar geöffnet, also zu einer Zeit,
wo es überhaupt keine Weintrauben gab. Hier ist also der
monumentale Tatbestand unvereinbar mit dem literarischen,
und jede Ausflucht ist unmöglich, weil die zur Zeit jener
Überlieferung schon vorhandene Kelter in dem innersten
Teile des Gesamtheiligtums lag, der nur durch den Vorhof
zugänglich war; wenn also überhaupt irgend ein Teil der
Gesamtanlage geschlossen war, so war auch die Kelter un-
zugänglich. Die Existenz der Kelter, in der man einen Hin-
weis auf den Apvalog hat sehen wollen, macht vielmehr Dörp-
felds Hypothese unmöglich.
Aber auch die Gegner dieser Hypothese haben fast durch-
weg zugegeben, dass wenigstens ein altes Dionysion gefun-
den seD; viele von ihnen nennen es daher das Lenaion, das
auch nach unserer Meinung nicht identisch ist mit dem
Heiligtum in den Sümpfen. Was kann uns nun einen bestimm-
teren Anhalt zur Bestimmung des Kultinhabers geben? Die
altertümliche geschlossene Ringmauer und der sog. Tempel
weisen auf keinen bestimmten Gott hin, und wenn nachher
auf demselben Orte eine private Kultgenossenschaft ihr Bak-
cheion errichtet hat, so beweist das bei dem völlig abwei-
chenden Charakter ihrer Bauten gar nichts-. Zu einer festen
Entscheidung können nur die architektonischen Einzelheiten
und die Kleinfunde des alten Bezirks führen.
Dass die dafür angeführten Beweise nicht stichhaltig sind, wird im
Folgenden gezeigt. Auch wenn Furtwänglers Vermutung (Griech. Vasen-
malerei II 115, vgl. Hauser ebenda 337), dass das nahe Brunnenhaus (Dörp-
felds Enneakrunos) die ALOWcia xprjvr) eines Vasenbildes sei, richtig wäre,
so könnte man höchstens folgern, dass irgendwo in der Nähe des Brunnens
ein Dionysion lag.
^ Der geschlossene, doppelgeteilte Bezirk, der sog. Tempel, der sog.
Altar, sowie die unerklärte Anlage an der Ostmauer (siehe unten), alles dies
fiel weg; dafür entstand mit Überbauung einer älteren Strasse und Ver-
wischung der alten Grenze das Clubhaus eines Privatvereins. Auch glaube
ich, dass der letzte Umbau der Kelter vor die Erbauung des älteren Bak-
cheion fällt, was Dörpfeld (AM. XX 1 895, 1 77) nicht für ausgeschlossen er-
klärt, während er in seinem Plan es vorzog, beide Bauten chronologisch
gleichzusetzen.
A. FRICKENHAUS
StoSexctTT] Toü WvÜEdippLtovog pY]vö$ ([Dem.] gg. Neaera 76), d. h.
der Bezirk war nur Ende Februar geöffnet, also zu einer Zeit,
wo es überhaupt keine Weintrauben gab. Hier ist also der
monumentale Tatbestand unvereinbar mit dem literarischen,
und jede Ausflucht ist unmöglich, weil die zur Zeit jener
Überlieferung schon vorhandene Kelter in dem innersten
Teile des Gesamtheiligtums lag, der nur durch den Vorhof
zugänglich war; wenn also überhaupt irgend ein Teil der
Gesamtanlage geschlossen war, so war auch die Kelter un-
zugänglich. Die Existenz der Kelter, in der man einen Hin-
weis auf den Apvalog hat sehen wollen, macht vielmehr Dörp-
felds Hypothese unmöglich.
Aber auch die Gegner dieser Hypothese haben fast durch-
weg zugegeben, dass wenigstens ein altes Dionysion gefun-
den seD; viele von ihnen nennen es daher das Lenaion, das
auch nach unserer Meinung nicht identisch ist mit dem
Heiligtum in den Sümpfen. Was kann uns nun einen bestimm-
teren Anhalt zur Bestimmung des Kultinhabers geben? Die
altertümliche geschlossene Ringmauer und der sog. Tempel
weisen auf keinen bestimmten Gott hin, und wenn nachher
auf demselben Orte eine private Kultgenossenschaft ihr Bak-
cheion errichtet hat, so beweist das bei dem völlig abwei-
chenden Charakter ihrer Bauten gar nichts-. Zu einer festen
Entscheidung können nur die architektonischen Einzelheiten
und die Kleinfunde des alten Bezirks führen.
Dass die dafür angeführten Beweise nicht stichhaltig sind, wird im
Folgenden gezeigt. Auch wenn Furtwänglers Vermutung (Griech. Vasen-
malerei II 115, vgl. Hauser ebenda 337), dass das nahe Brunnenhaus (Dörp-
felds Enneakrunos) die ALOWcia xprjvr) eines Vasenbildes sei, richtig wäre,
so könnte man höchstens folgern, dass irgendwo in der Nähe des Brunnens
ein Dionysion lag.
^ Der geschlossene, doppelgeteilte Bezirk, der sog. Tempel, der sog.
Altar, sowie die unerklärte Anlage an der Ostmauer (siehe unten), alles dies
fiel weg; dafür entstand mit Überbauung einer älteren Strasse und Ver-
wischung der alten Grenze das Clubhaus eines Privatvereins. Auch glaube
ich, dass der letzte Umbau der Kelter vor die Erbauung des älteren Bak-
cheion fällt, was Dörpfeld (AM. XX 1 895, 1 77) nicht für ausgeschlossen er-
klärt, während er in seinem Plan es vorzog, beide Bauten chronologisch
gleichzusetzen.