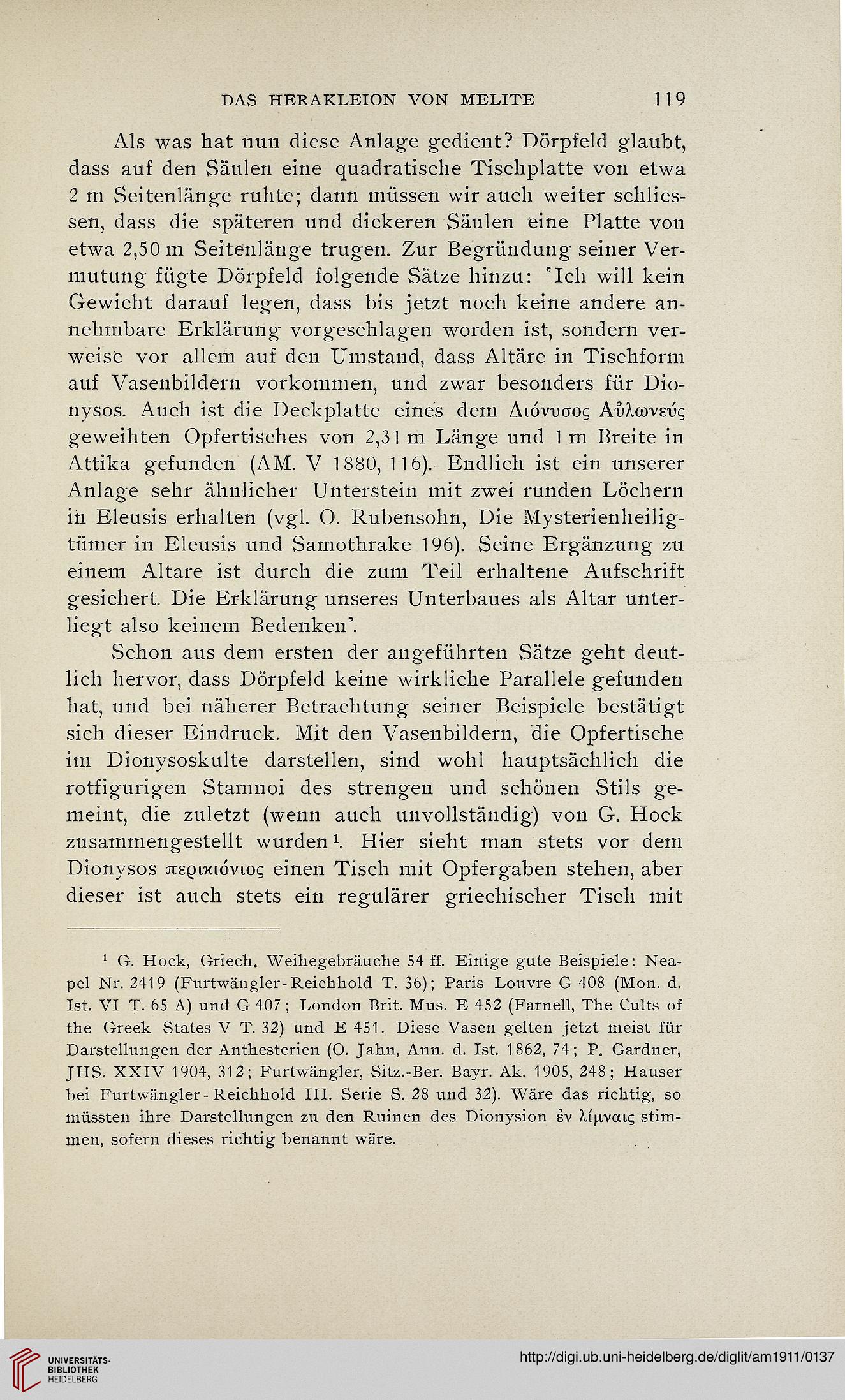DAS HERAKLEION VON MELITE
119
Als was hat nun diese Anlage gedient? Dörpfeld glaubt,
dass auf den Säulen eine quadratische Tischplatte von etwa
2 m Seitenlange ruhte; dann müssen wir auch weiter schlies-
sen, dass die späteren und dickeren Säulen eine Platte von
etwa 2,50 m Seitenlänge trugen. Zur Begründungseiner Ver-
mutung fügte Dörpfeld folgende Sätze hinzu: "Ich will kein
Gewicht darauf legen, dass bis jetzt noch keine andere an-
nehmbare Erklärung vorgeschlagen worden ist, sondern ver-
weise vor allem auf den Umstand, dass Altäre in Tischform
auf Vasenbildern Vorkommen, und zwar besonders für Dio-
nysos. Auch ist die Deckplatte eines dem Atovuoog AüAtoveu$
geweihten Opfertisches von 2,31 m Länge und 1 m Breite in
Attika gefunden (AM. V 1880, 1 16). Endlich ist ein unserer
Anlage sehr ähnlicher Unterstein mit zwei runden Löchern
in Eleusis erhalten (vgl. O. Rubensohn, Die Mysterienheilig-
tümer in Eleusis und Samothrake 196). Seine Ergänzung zu
einem Altäre ist durch die zum Teil erhaltene Aufschrift
gesichert. Die Erklärung unseres Unterbaues als Altar unter-
liegt also keinem Bedenken'.
Schon aus dem ersten der angeführten Sätze geht deut-
lich hervor, dass Dörpfeld keine wirkliche Parallele gefunden
hat, und bei näherer Betrachtung seiner Beispiele bestätigt
sich dieser Eindruck. Mit den Vasenbildern, die Opfertische
im Dionysoskulte darstellen, sind wohl hauptsächlich die
rotfigurigen Stamnoi des strengen und schönen Stils ge-
meint, die zuletzt (wenn auch unvollständig) von G. Hock
zusammengestellt wurden b Hier sieht man stets vor dem
Dionysos jtepoaovmg einen Tisch mit Opfergaben stehen, aber
dieser ist auch stets ein regulärer griechischer Tisch mit
' G. Hock, Griech. Weihegebräuche 54 ff. Einige gute Beispiele: Nea-
pel Nr. 2419 (Furtwängler-Reichhold T. 36); Paris Louvre G 408 (Mon. d.
Ist. VI T. 65 A) und G 407 ; London Brit. Mus. E 452 (Farnell, The Cults of
the Greek States V T. 32) und E 451. Diese Vasen gelten jetzt meist für
Darstellungen der Anthesterien (O. Jahn, Ann. d. Ist. 1862, 74; P. Gardner,
JHS. XXIV 1904, 312; Furtwängler, Sitz.-Ber. Bayr. Ak. 1905, 248; Hauser
bei Furtwängler-Reichhold III. Serie S. 28 und 32). Wäre das richtig, so
müssten ihre Darstellungen zu den Ruinen des Dionysion sv 7apvou.$ stim-
men, sofern dieses richtig benannt wäre.
119
Als was hat nun diese Anlage gedient? Dörpfeld glaubt,
dass auf den Säulen eine quadratische Tischplatte von etwa
2 m Seitenlange ruhte; dann müssen wir auch weiter schlies-
sen, dass die späteren und dickeren Säulen eine Platte von
etwa 2,50 m Seitenlänge trugen. Zur Begründungseiner Ver-
mutung fügte Dörpfeld folgende Sätze hinzu: "Ich will kein
Gewicht darauf legen, dass bis jetzt noch keine andere an-
nehmbare Erklärung vorgeschlagen worden ist, sondern ver-
weise vor allem auf den Umstand, dass Altäre in Tischform
auf Vasenbildern Vorkommen, und zwar besonders für Dio-
nysos. Auch ist die Deckplatte eines dem Atovuoog AüAtoveu$
geweihten Opfertisches von 2,31 m Länge und 1 m Breite in
Attika gefunden (AM. V 1880, 1 16). Endlich ist ein unserer
Anlage sehr ähnlicher Unterstein mit zwei runden Löchern
in Eleusis erhalten (vgl. O. Rubensohn, Die Mysterienheilig-
tümer in Eleusis und Samothrake 196). Seine Ergänzung zu
einem Altäre ist durch die zum Teil erhaltene Aufschrift
gesichert. Die Erklärung unseres Unterbaues als Altar unter-
liegt also keinem Bedenken'.
Schon aus dem ersten der angeführten Sätze geht deut-
lich hervor, dass Dörpfeld keine wirkliche Parallele gefunden
hat, und bei näherer Betrachtung seiner Beispiele bestätigt
sich dieser Eindruck. Mit den Vasenbildern, die Opfertische
im Dionysoskulte darstellen, sind wohl hauptsächlich die
rotfigurigen Stamnoi des strengen und schönen Stils ge-
meint, die zuletzt (wenn auch unvollständig) von G. Hock
zusammengestellt wurden b Hier sieht man stets vor dem
Dionysos jtepoaovmg einen Tisch mit Opfergaben stehen, aber
dieser ist auch stets ein regulärer griechischer Tisch mit
' G. Hock, Griech. Weihegebräuche 54 ff. Einige gute Beispiele: Nea-
pel Nr. 2419 (Furtwängler-Reichhold T. 36); Paris Louvre G 408 (Mon. d.
Ist. VI T. 65 A) und G 407 ; London Brit. Mus. E 452 (Farnell, The Cults of
the Greek States V T. 32) und E 451. Diese Vasen gelten jetzt meist für
Darstellungen der Anthesterien (O. Jahn, Ann. d. Ist. 1862, 74; P. Gardner,
JHS. XXIV 1904, 312; Furtwängler, Sitz.-Ber. Bayr. Ak. 1905, 248; Hauser
bei Furtwängler-Reichhold III. Serie S. 28 und 32). Wäre das richtig, so
müssten ihre Darstellungen zu den Ruinen des Dionysion sv 7apvou.$ stim-
men, sofern dieses richtig benannt wäre.