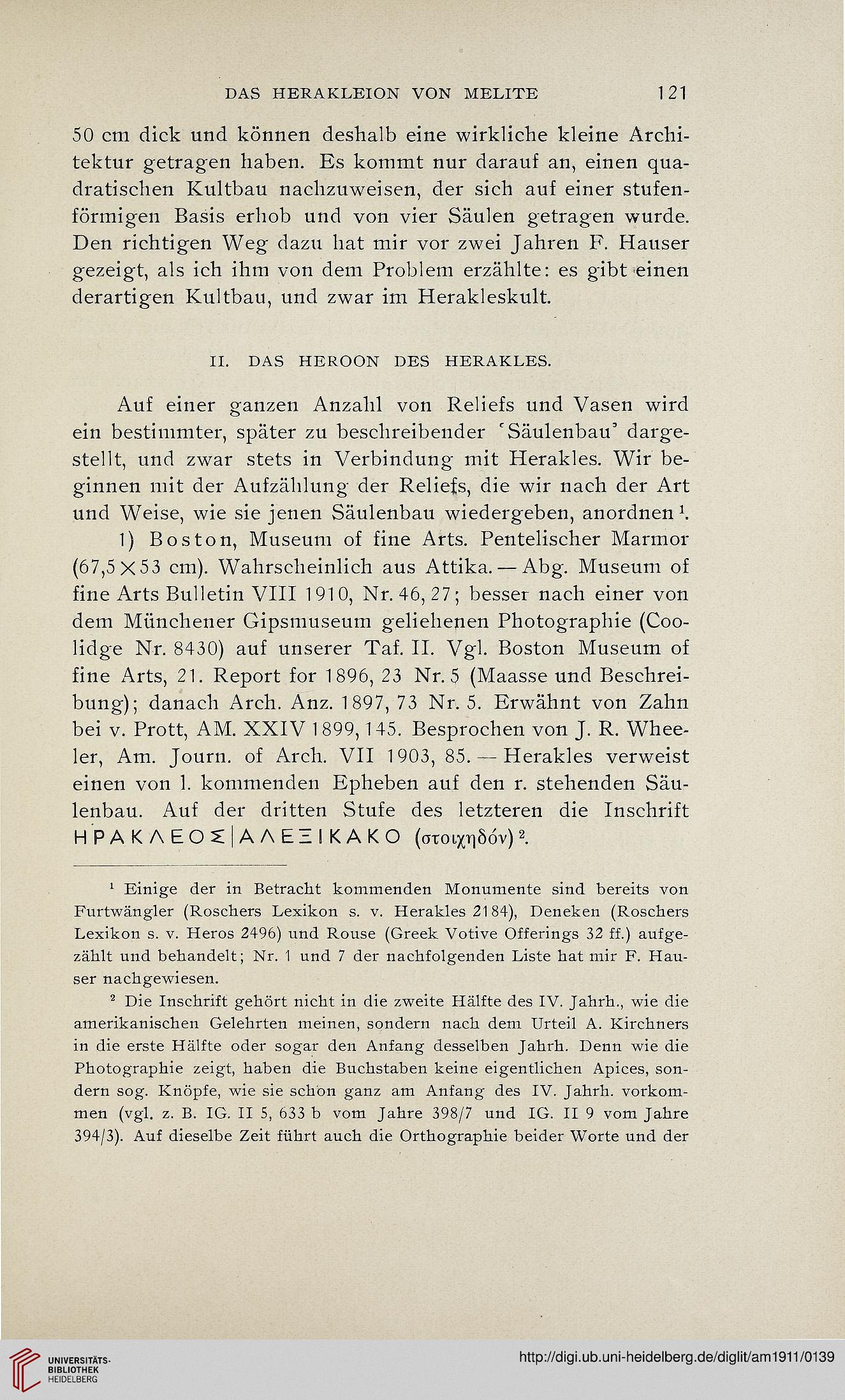DAS HERAKLEION VON MELITE
121
50 cm dick und können deshalb eine wirkliche kleine Archi-
tektur getragen haben. Es kommt nur darauf an, einen qua-
dratischen Kultbau nachzuweisen, der sich auf einer stufen-
förmigen Basis erhob und von vier Säulen getragen wurde.
Den richtigen Weg dazu hat mir vor zwei Jahren F. Hauser
gezeigt, als ich ihm von dem Problem erzählte: es gibt einen
derartigen Kultbau, und zwar im Herakleskult.
II. DAS HEROON DES HERAKLES.
Auf einer ganzen Anzahl von Reliefs und Vasen wird
ein bestimmter, später zu beschreibender 'Säulenbau' darge-
stellt, und zwar stets in Verbindung mit Herakles. Wir be-
ginnen mit der Aufzählung der Reliefs, die wir nach der Art
und Weise, wie sie jenen Säulenbau wiedergeben, anordnen b
1) Boston, Museum of fine Arts. Pentelischer Marmor
(67,5x53 cm). Wahrscheinlich aus Attika. — Abg. Museum of
fine Arts Bulletin VIII 1910, Nr. 46, 27; besser nach einer von
dem Münchener Gipsmuseum geliehenen Photographie (Coo-
lidge Nr. 8430) auf unserer Taf. II. Vgl. Boston Museum of
fine Arts, 21. Report for 1896, 23 Nr. 5 (Maasse und Beschrei-
bung); danach Arch. Anz. 1 897, 73 Nr. 5. Erwähnt von Zahn
bei v. Prott, AM. XXIV 1899,145. Besprochen von J. R. Whee-
ler, Am. Journ. of Arch. VII 1903, 85. — Herakles verweist
einen von 1. kommenden Epheben auf den r. stehenden Säu-
lenbau. Auf der dritten Stufe des letzteren die Inschrift
HPAKAEO^[AAE—!KAKO (aroixq&dv) 2.
' Einige der in Betracht kommenden Monumente sind bereits von
Furtwängler (Roschers Lexikon s. v. Herakles 2184), Deneken (Roschers
Lexikon s. v. Heros 2496) und Rouse (Greek Votive Offerings 32 ff.) aufge-
zählt und behandelt; Nr. 1 und 7 der nachfolgenden Liste hat mir F. Hau-
ser nachgewiesen.
2 Die Inschrift gehört nicht in die zweite Hälfte des IV. Jahrh., wie die
amerikanischen Gelehrten meinen, sondern nach dem Urteil A. Kirchners
in die erste Hälfte oder sogar den Anfang desselben Jahrh. Denn wie die
Photographie zeigt, haben die Buchstaben keine eigentlichen Apices, son-
dern sog. Knöpfe, wie sie schon ganz am Anfang des IV. Jahrh. Vorkom-
men (vgl. z. B. IG. II 5, 633 b vom Jahre 398/7 und IG. II 9 vom Jahre
394/3). Auf dieselbe Zeit führt auch die Orthographie beider Worte und der
121
50 cm dick und können deshalb eine wirkliche kleine Archi-
tektur getragen haben. Es kommt nur darauf an, einen qua-
dratischen Kultbau nachzuweisen, der sich auf einer stufen-
förmigen Basis erhob und von vier Säulen getragen wurde.
Den richtigen Weg dazu hat mir vor zwei Jahren F. Hauser
gezeigt, als ich ihm von dem Problem erzählte: es gibt einen
derartigen Kultbau, und zwar im Herakleskult.
II. DAS HEROON DES HERAKLES.
Auf einer ganzen Anzahl von Reliefs und Vasen wird
ein bestimmter, später zu beschreibender 'Säulenbau' darge-
stellt, und zwar stets in Verbindung mit Herakles. Wir be-
ginnen mit der Aufzählung der Reliefs, die wir nach der Art
und Weise, wie sie jenen Säulenbau wiedergeben, anordnen b
1) Boston, Museum of fine Arts. Pentelischer Marmor
(67,5x53 cm). Wahrscheinlich aus Attika. — Abg. Museum of
fine Arts Bulletin VIII 1910, Nr. 46, 27; besser nach einer von
dem Münchener Gipsmuseum geliehenen Photographie (Coo-
lidge Nr. 8430) auf unserer Taf. II. Vgl. Boston Museum of
fine Arts, 21. Report for 1896, 23 Nr. 5 (Maasse und Beschrei-
bung); danach Arch. Anz. 1 897, 73 Nr. 5. Erwähnt von Zahn
bei v. Prott, AM. XXIV 1899,145. Besprochen von J. R. Whee-
ler, Am. Journ. of Arch. VII 1903, 85. — Herakles verweist
einen von 1. kommenden Epheben auf den r. stehenden Säu-
lenbau. Auf der dritten Stufe des letzteren die Inschrift
HPAKAEO^[AAE—!KAKO (aroixq&dv) 2.
' Einige der in Betracht kommenden Monumente sind bereits von
Furtwängler (Roschers Lexikon s. v. Herakles 2184), Deneken (Roschers
Lexikon s. v. Heros 2496) und Rouse (Greek Votive Offerings 32 ff.) aufge-
zählt und behandelt; Nr. 1 und 7 der nachfolgenden Liste hat mir F. Hau-
ser nachgewiesen.
2 Die Inschrift gehört nicht in die zweite Hälfte des IV. Jahrh., wie die
amerikanischen Gelehrten meinen, sondern nach dem Urteil A. Kirchners
in die erste Hälfte oder sogar den Anfang desselben Jahrh. Denn wie die
Photographie zeigt, haben die Buchstaben keine eigentlichen Apices, son-
dern sog. Knöpfe, wie sie schon ganz am Anfang des IV. Jahrh. Vorkom-
men (vgl. z. B. IG. II 5, 633 b vom Jahre 398/7 und IG. II 9 vom Jahre
394/3). Auf dieselbe Zeit führt auch die Orthographie beider Worte und der