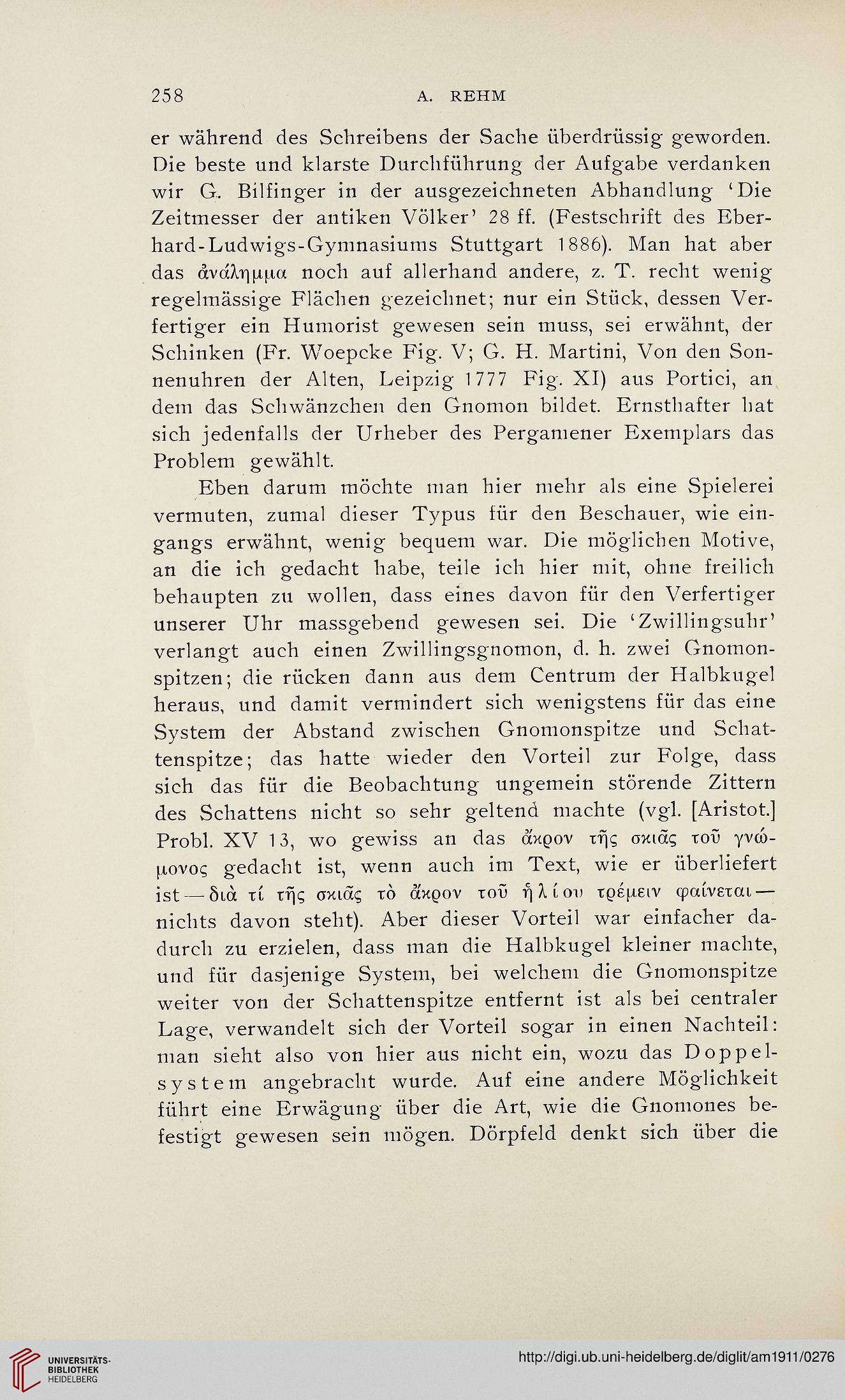258
A. REHM
er während des Schreibens der Sache überdrüssig geworden.
Die beste und klarste Durchführung der Aufgabe verdanken
wir G. Bilfinger in der ausgezeichneten Abhandlung 'Die
Zeitmesser der antiken Völker' 28 ff. (Festschrift des Eber-
hard-Ludwigs-Gymnasiums Stuttgart 1886). Man hat aber
das dvdMippot noch auf allerhand andere, z. T. recht wenig
regelmässige Flächen gezeichnet; nur ein Stück, dessen Ver-
fertiger ein Humorist gewesen sein muss, sei erwähnt, der
Schinken (Fr. Woepcke Fig. V; G. H. Martini, Von den Son-
nenuhren der Alten, Leipzig 1 777 Fig. XI) aus Portici, an
dem das Schwänzchen den Gnomon bildet. Ernsthafter hat
sich jedenfalls der Urheber des Pergamener Exemplars das
Problem gewählt.
Eben darum möchte man hier mehr als eine Spielerei
vermuten, zumal dieser Typus für den Beschauer, wie ein-
gangs erwähnt, wenig bequem war. Die möglichen Motive,
an die ich gedacht habe, teile ich hier mit, ohne freilich
behaupten zu wollen, dass eines davon für den Verfertiger
unserer Uhr massgebend gewesen sei. Die 'Zwillingsuhr'
verlangt auch einen Zwillingsgnomon, d. h. zwei Gnomon-
spitzen; die rücken dann aus dem Centrum der Halbkugel
heraus, und damit vermindert sich wenigstens für das eine
System der Abstand zwischen Gnomonspitze und Schat-
tenspitze; das hatte wieder den Vorteil zur Folge, dass
sich das für die Beobachtung ungemein störende Zittern
des Schattens nicht so sehr geltend machte (vgl. [Aristot.]
Probl. XV 13, wo gewiss an das axpov rfjq oxtctg roü yvto-
povog gedacht ist, wenn auch im Text, wie er überliefert
ist — öm in riji; oxuxg rö axpov roü qTHoo rpepetv cpouverou —
nichts davon steht). Aber dieser Vorteil war einfacher da-
durch zu erzielen, dass man die Halbkugel kleiner machte,
und für dasjenige System, bei welchem die Gnomonspitze
weiter von der Schattenspitze entfernt ist als bei centraler
Lage, verwandelt sich der Vorteil sogar in einen Nachteil:
man sieht also von hier aus nicht ein, wozu das Doppel-
system angebracht wurde. Auf eine andere Möglichkeit
führt eine Erwägung über die Art, wie die Gnomones be-
festigt gewesen sein mögen. Dörpfeld denkt sich über die
A. REHM
er während des Schreibens der Sache überdrüssig geworden.
Die beste und klarste Durchführung der Aufgabe verdanken
wir G. Bilfinger in der ausgezeichneten Abhandlung 'Die
Zeitmesser der antiken Völker' 28 ff. (Festschrift des Eber-
hard-Ludwigs-Gymnasiums Stuttgart 1886). Man hat aber
das dvdMippot noch auf allerhand andere, z. T. recht wenig
regelmässige Flächen gezeichnet; nur ein Stück, dessen Ver-
fertiger ein Humorist gewesen sein muss, sei erwähnt, der
Schinken (Fr. Woepcke Fig. V; G. H. Martini, Von den Son-
nenuhren der Alten, Leipzig 1 777 Fig. XI) aus Portici, an
dem das Schwänzchen den Gnomon bildet. Ernsthafter hat
sich jedenfalls der Urheber des Pergamener Exemplars das
Problem gewählt.
Eben darum möchte man hier mehr als eine Spielerei
vermuten, zumal dieser Typus für den Beschauer, wie ein-
gangs erwähnt, wenig bequem war. Die möglichen Motive,
an die ich gedacht habe, teile ich hier mit, ohne freilich
behaupten zu wollen, dass eines davon für den Verfertiger
unserer Uhr massgebend gewesen sei. Die 'Zwillingsuhr'
verlangt auch einen Zwillingsgnomon, d. h. zwei Gnomon-
spitzen; die rücken dann aus dem Centrum der Halbkugel
heraus, und damit vermindert sich wenigstens für das eine
System der Abstand zwischen Gnomonspitze und Schat-
tenspitze; das hatte wieder den Vorteil zur Folge, dass
sich das für die Beobachtung ungemein störende Zittern
des Schattens nicht so sehr geltend machte (vgl. [Aristot.]
Probl. XV 13, wo gewiss an das axpov rfjq oxtctg roü yvto-
povog gedacht ist, wenn auch im Text, wie er überliefert
ist — öm in riji; oxuxg rö axpov roü qTHoo rpepetv cpouverou —
nichts davon steht). Aber dieser Vorteil war einfacher da-
durch zu erzielen, dass man die Halbkugel kleiner machte,
und für dasjenige System, bei welchem die Gnomonspitze
weiter von der Schattenspitze entfernt ist als bei centraler
Lage, verwandelt sich der Vorteil sogar in einen Nachteil:
man sieht also von hier aus nicht ein, wozu das Doppel-
system angebracht wurde. Auf eine andere Möglichkeit
führt eine Erwägung über die Art, wie die Gnomones be-
festigt gewesen sein mögen. Dörpfeld denkt sich über die