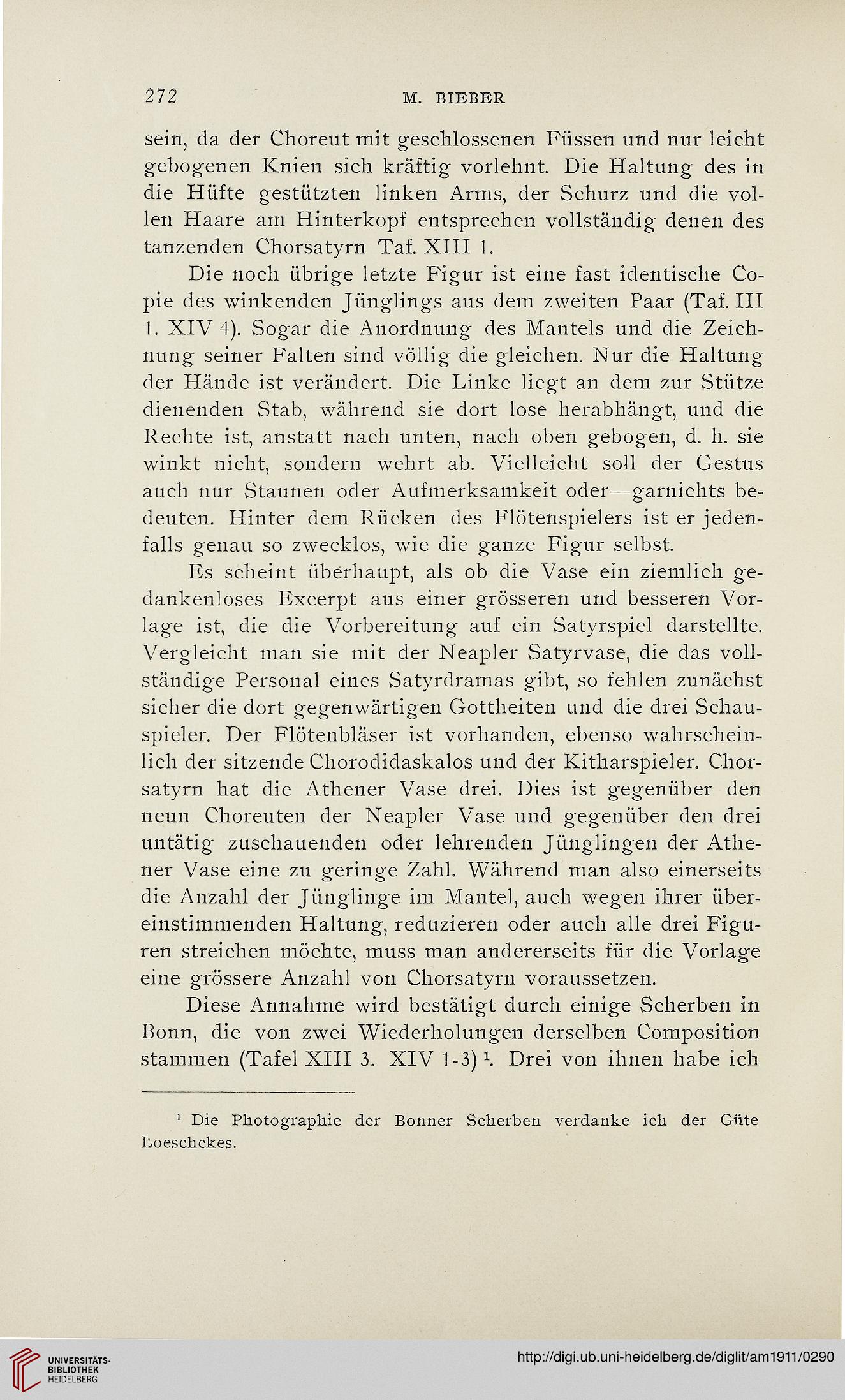272
M. BIEBER
sein, da der Choreut mit geschlossenen Füssen und nur leicht
gebogenen Knien sich kräftig vorlehnt. Die Haltung des in
die Hüfte gestützten linken Arms, der Schurz und die vol-
len Haare am Hinterkopf entsprechen vollständig denen des
tanzenden Chorsatyrn Taf. XIII 1.
Die noch übrige letzte Figur ist eine fast identische Co-
pie des winkenden Jünglings aus dem zweiten Paar (Taf. III
1. XIV 4). Sogar die Anordnung des Mantels und die Zeich-
nung seiner Falten sind völlig die gleichen. Nur die Haltung
der Hände ist verändert. Die Linke liegt an dem zur Stütze
dienenden Stab, während sie dort lose herabhängt, und die
Rechte ist, anstatt nach unten, nach oben gebogen, d. h. sie
winkt nicht, sondern wehrt ab. Vielleicht soll der Gestus
auch nur Staunen oder Aufmerksamkeit oder—garnichts be-
deuten. Hinter dem Rücken des Flötenspielers ist er jeden-
falls genau so zwecklos, wie die ganze Figur selbst.
Es scheint überhaupt, als ob die Vase ein ziemlich ge-
dankenloses Excerpt aus einer grösseren und besseren Vor-
lage ist, die die Vorbereitung auf ein Satyrspiel darstellte.
Vergleicht man sie mit der Neapler Satyrvase, die das voll-
ständige Personal eines Satyrdramas gibt, so fehlen zunächst
sicher die dort gegenwärtigen Gottheiten und die drei Schau-
spieler. Der Flötenbläser ist vorhanden, ebenso wahrschein-
lich der sitzende Chorodidaskalos und der Kitharspieler. Chor-
satyrn hat die Athener Vase drei. Dies ist gegenüber den
neun Choreuten der Neapler Vase und gegenüber den drei
untätig zuschauenden oder lehrenden Jünglingen der Athe-
ner Vase eine zu geringe Zahl. Während man also einerseits
die Anzahl der Jünglinge im Mantel, auch wegen ihrer über-
einstimmenden Haltung, reduzieren oder auch alle drei Figu-
ren streichen möchte, muss man andererseits für die Vorlage
eine grössere Anzahl von Chorsatyrn voraussetzen.
Diese Annahme wird bestätigt durch einige Scherben in
Bonn, die von zwei Wiederholungen derselben Composition
stammen (Tafel XIII 3. XIV 1-3) ä Drei von ihnen habe ich
* Die Photographie der Bonner Scherben verdanke ich der Güte
Loeschckes.
M. BIEBER
sein, da der Choreut mit geschlossenen Füssen und nur leicht
gebogenen Knien sich kräftig vorlehnt. Die Haltung des in
die Hüfte gestützten linken Arms, der Schurz und die vol-
len Haare am Hinterkopf entsprechen vollständig denen des
tanzenden Chorsatyrn Taf. XIII 1.
Die noch übrige letzte Figur ist eine fast identische Co-
pie des winkenden Jünglings aus dem zweiten Paar (Taf. III
1. XIV 4). Sogar die Anordnung des Mantels und die Zeich-
nung seiner Falten sind völlig die gleichen. Nur die Haltung
der Hände ist verändert. Die Linke liegt an dem zur Stütze
dienenden Stab, während sie dort lose herabhängt, und die
Rechte ist, anstatt nach unten, nach oben gebogen, d. h. sie
winkt nicht, sondern wehrt ab. Vielleicht soll der Gestus
auch nur Staunen oder Aufmerksamkeit oder—garnichts be-
deuten. Hinter dem Rücken des Flötenspielers ist er jeden-
falls genau so zwecklos, wie die ganze Figur selbst.
Es scheint überhaupt, als ob die Vase ein ziemlich ge-
dankenloses Excerpt aus einer grösseren und besseren Vor-
lage ist, die die Vorbereitung auf ein Satyrspiel darstellte.
Vergleicht man sie mit der Neapler Satyrvase, die das voll-
ständige Personal eines Satyrdramas gibt, so fehlen zunächst
sicher die dort gegenwärtigen Gottheiten und die drei Schau-
spieler. Der Flötenbläser ist vorhanden, ebenso wahrschein-
lich der sitzende Chorodidaskalos und der Kitharspieler. Chor-
satyrn hat die Athener Vase drei. Dies ist gegenüber den
neun Choreuten der Neapler Vase und gegenüber den drei
untätig zuschauenden oder lehrenden Jünglingen der Athe-
ner Vase eine zu geringe Zahl. Während man also einerseits
die Anzahl der Jünglinge im Mantel, auch wegen ihrer über-
einstimmenden Haltung, reduzieren oder auch alle drei Figu-
ren streichen möchte, muss man andererseits für die Vorlage
eine grössere Anzahl von Chorsatyrn voraussetzen.
Diese Annahme wird bestätigt durch einige Scherben in
Bonn, die von zwei Wiederholungen derselben Composition
stammen (Tafel XIII 3. XIV 1-3) ä Drei von ihnen habe ich
* Die Photographie der Bonner Scherben verdanke ich der Güte
Loeschckes.