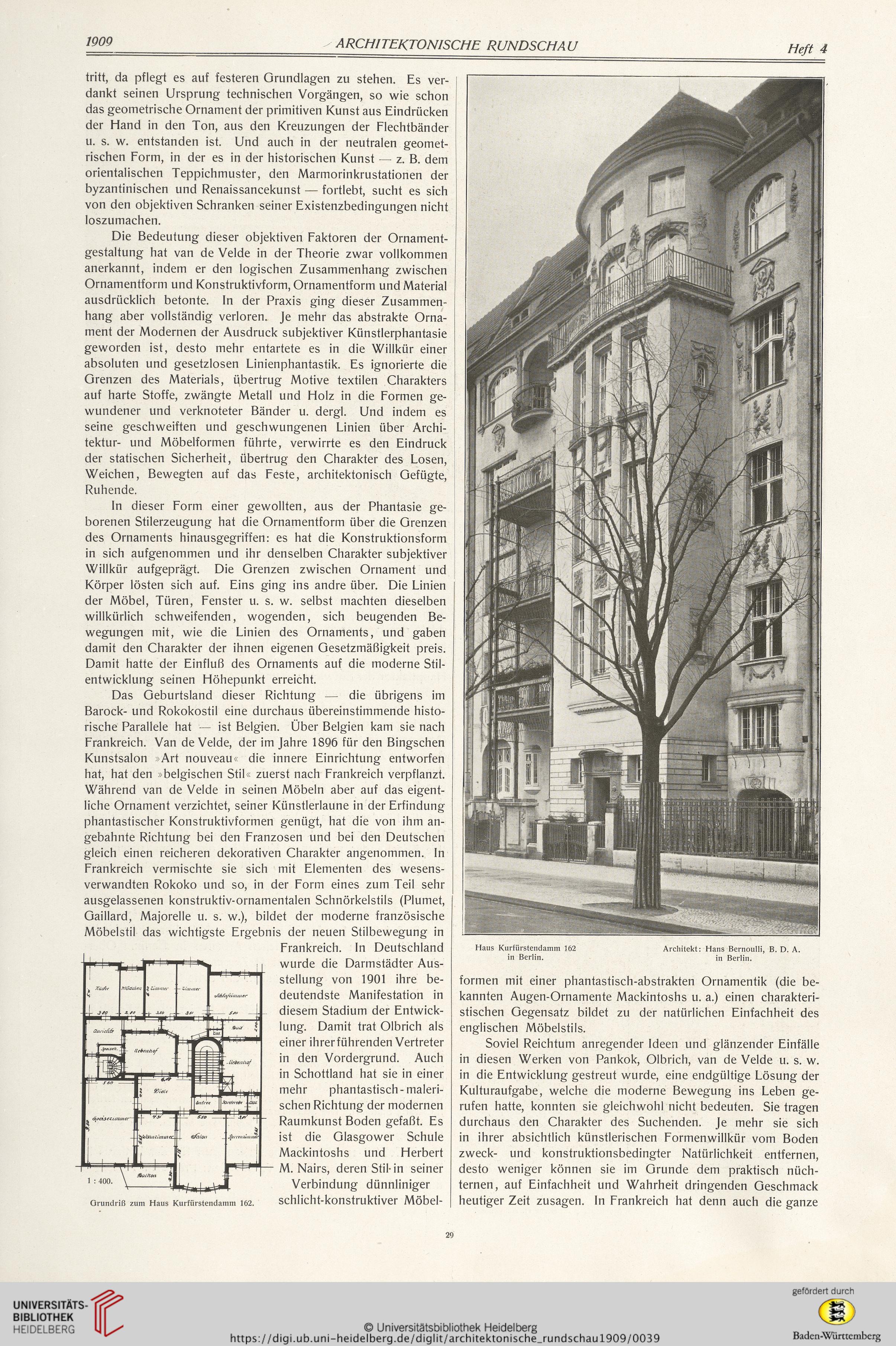1909
" ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 4
tritt, da pflegt es auf festeren Grundlagen zu stehen. Es ver-
dankt seinen Ursprung technischen Vorgängen, so wie schon
das geometrische Ornament der primitiven Kunst aus Eindrücken
der Hand in den Ton, aus den Kreuzungen der Flechtbänder
u. s. w. entstanden ist. Und auch in der neutralen geomet-
rischen Form, in der es in der historischen Kunst — z. B. dem
orientalischen Teppichmuster, den Marmorinkrustationen der
byzantinischen und Renaissancekunst — fortlebt, sucht es sich
von den objektiven Schranken seiner Existenzbedingungen nicht
loszumachen.
Die Bedeutung dieser objektiven Faktoren der Ornament-
gestaltung hat van de Velde in der Theorie zwar vollkommen
anerkannt, indem er den logischen Zusammenhang zwischen
Ornamentform und Konstruktivform, Ornamentform und Material
ausdrücklich betonte. In der Praxis ging dieser Zusammen-
hang aber vollständig verloren. Je mehr das abstrakte Orna-
ment der Modernen der Ausdruck subjektiver Künstlerphantasie
geworden ist, desto mehr entartete es in die Willkür einer
absoluten und gesetzlosen Linienphantastik. Es ignorierte die
Grenzen des Materials, übertrug Motive textilen Charakters
auf harte Stoffe, zwängte Metall und Holz in die Formen ge-
wundener und verknoteter Bänder u. dergl. Und indem es
seine geschweiften und geschwungenen Linien über Archi-
tektur- und Möbelformen führte, verwirrte es den Eindruck
der statischen Sicherheit, übertrug den Charakter des Losen,
Weichen, Bewegten auf das Feste, architektonisch Gefügte,
Ruhende.
In dieser Form einer gewollten, aus der Phantasie ge-
borenen Stilerzeugung hat die Ornamentform über die Grenzen
des Ornaments hinausgegriffen: es hat die Konstruktionsform
in sich aufgenommen und ihr denselben Charakter subjektiver
Willkür aufgeprägt. Die Grenzen zwischen Ornament und
Körper lösten sich auf. Eins ging ins andre über. Die Linien
der Möbel, Türen, Fenster u. s. w. selbst machten dieselben
willkürlich schweifenden, wogenden, sich beugenden Be-
wegungen mit, wie die Linien des Ornaments, und gaben
damit den Charakter der ihnen eigenen Gesetzmäßigkeit preis.
Damit hatte der Einfluß des Ornaments auf die moderne Stil-
entwicklung seinen Höhepunkt erreicht.
Das Geburtsland dieser Richtung — die übrigens im
Barock- und Rokokostil eine durchaus übereinstimmende histo-
rische Parallele hat — ist Belgien. Über Belgien kam sie nach
Frankreich. Van de Velde, der im Jahre 1896 für den Bingschen
Kunstsalon »Art nouveau« die innere Einrichtung entworfen
hat, hat den »belgischen Stil« zuerst nach Frankreich verpflanzt.
Während van de Velde in seinen Möbeln aber auf das eigent-
liche Ornament verzichtet, seiner Künstlerlaune in der Erfindung
phantastischer Konstruktivformen genügt, hat die von ihm an-
gebahnte Richtung bei den Franzosen und bei den Deutschen
gleich einen reicheren dekorativen Charakter angenommen. In
Frankreich vermischte sie sich mit Elementen des wesens-
verwandten Rokoko und so, in der Form eines zum Teil sehr
ausgelassenen konstruktiv-ornamentalen Schnörkelstils (Plumet,
Gaillard, Majorelle u. s. w.), bildet der moderne französische
Möbelstil das wichtigste Ergebnis der neuen Stilbewegung in
Frankreich. In Deutschland
wurde die Darmstädter Aus-
stellung von 1901 ihre be-
deutendste Manifestation in
diesem Stadium der Entwick-
lung. Damit trat Olbrich als
einer ihrerführenden Vertreter
in den Vordergrund. Auch
in Schottland hat sie in einer
mehr phantastisch-maleri-
schen Richtung der modernen
Raumkunst Boden gefaßt. Es
ist die Glasgower Schule
Mackintoshs und Herbert
M. Nairs, deren Stil-in seiner
Verbindung dünnliniger
schlicht-konstruktiver Möbel-
Grundriß zum Haus Kurfürstendamm 162.
Haus Kurfürstendamm 162
in Berlin.
Architekt: Hans Bernoulli, B. D. A.
in Berlin.
formen mit einer phantastisch-abstrakten Ornamentik (die be-
kannten Augen-Ornamente Mackintoshs u. a.) einen charakteri-
stischen Gegensatz bildet zu der natürlichen Einfachheit des
englischen Möbelstils.
Soviel Reichtum anregender Ideen und glänzender Einfälle
in diesen Werken von Pankok, Olbrich, van de Velde u. s. w.
in die Entwicklung gestreut wurde, eine endgültige Lösung der
Kulturaufgabe, welche die moderne Bewegung ins Leben ge-
rufen hatte, konnten sie gleichwohl nicht bedeuten. Sie tragen
durchaus den Charakter des Suchenden. Je mehr sie sich
in ihrer absichtlich künstlerischen Formenwillkür vom Boden
zweck- und konstruktionsbedingter Natürlichkeit entfernen,
desto weniger können sie im Grunde dem praktisch nüch-
ternen, auf Einfachheit und Wahrheit dringenden Geschmack
heutiger Zeit zusagen. In Frankreich hat denn auch die ganze
29
" ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 4
tritt, da pflegt es auf festeren Grundlagen zu stehen. Es ver-
dankt seinen Ursprung technischen Vorgängen, so wie schon
das geometrische Ornament der primitiven Kunst aus Eindrücken
der Hand in den Ton, aus den Kreuzungen der Flechtbänder
u. s. w. entstanden ist. Und auch in der neutralen geomet-
rischen Form, in der es in der historischen Kunst — z. B. dem
orientalischen Teppichmuster, den Marmorinkrustationen der
byzantinischen und Renaissancekunst — fortlebt, sucht es sich
von den objektiven Schranken seiner Existenzbedingungen nicht
loszumachen.
Die Bedeutung dieser objektiven Faktoren der Ornament-
gestaltung hat van de Velde in der Theorie zwar vollkommen
anerkannt, indem er den logischen Zusammenhang zwischen
Ornamentform und Konstruktivform, Ornamentform und Material
ausdrücklich betonte. In der Praxis ging dieser Zusammen-
hang aber vollständig verloren. Je mehr das abstrakte Orna-
ment der Modernen der Ausdruck subjektiver Künstlerphantasie
geworden ist, desto mehr entartete es in die Willkür einer
absoluten und gesetzlosen Linienphantastik. Es ignorierte die
Grenzen des Materials, übertrug Motive textilen Charakters
auf harte Stoffe, zwängte Metall und Holz in die Formen ge-
wundener und verknoteter Bänder u. dergl. Und indem es
seine geschweiften und geschwungenen Linien über Archi-
tektur- und Möbelformen führte, verwirrte es den Eindruck
der statischen Sicherheit, übertrug den Charakter des Losen,
Weichen, Bewegten auf das Feste, architektonisch Gefügte,
Ruhende.
In dieser Form einer gewollten, aus der Phantasie ge-
borenen Stilerzeugung hat die Ornamentform über die Grenzen
des Ornaments hinausgegriffen: es hat die Konstruktionsform
in sich aufgenommen und ihr denselben Charakter subjektiver
Willkür aufgeprägt. Die Grenzen zwischen Ornament und
Körper lösten sich auf. Eins ging ins andre über. Die Linien
der Möbel, Türen, Fenster u. s. w. selbst machten dieselben
willkürlich schweifenden, wogenden, sich beugenden Be-
wegungen mit, wie die Linien des Ornaments, und gaben
damit den Charakter der ihnen eigenen Gesetzmäßigkeit preis.
Damit hatte der Einfluß des Ornaments auf die moderne Stil-
entwicklung seinen Höhepunkt erreicht.
Das Geburtsland dieser Richtung — die übrigens im
Barock- und Rokokostil eine durchaus übereinstimmende histo-
rische Parallele hat — ist Belgien. Über Belgien kam sie nach
Frankreich. Van de Velde, der im Jahre 1896 für den Bingschen
Kunstsalon »Art nouveau« die innere Einrichtung entworfen
hat, hat den »belgischen Stil« zuerst nach Frankreich verpflanzt.
Während van de Velde in seinen Möbeln aber auf das eigent-
liche Ornament verzichtet, seiner Künstlerlaune in der Erfindung
phantastischer Konstruktivformen genügt, hat die von ihm an-
gebahnte Richtung bei den Franzosen und bei den Deutschen
gleich einen reicheren dekorativen Charakter angenommen. In
Frankreich vermischte sie sich mit Elementen des wesens-
verwandten Rokoko und so, in der Form eines zum Teil sehr
ausgelassenen konstruktiv-ornamentalen Schnörkelstils (Plumet,
Gaillard, Majorelle u. s. w.), bildet der moderne französische
Möbelstil das wichtigste Ergebnis der neuen Stilbewegung in
Frankreich. In Deutschland
wurde die Darmstädter Aus-
stellung von 1901 ihre be-
deutendste Manifestation in
diesem Stadium der Entwick-
lung. Damit trat Olbrich als
einer ihrerführenden Vertreter
in den Vordergrund. Auch
in Schottland hat sie in einer
mehr phantastisch-maleri-
schen Richtung der modernen
Raumkunst Boden gefaßt. Es
ist die Glasgower Schule
Mackintoshs und Herbert
M. Nairs, deren Stil-in seiner
Verbindung dünnliniger
schlicht-konstruktiver Möbel-
Grundriß zum Haus Kurfürstendamm 162.
Haus Kurfürstendamm 162
in Berlin.
Architekt: Hans Bernoulli, B. D. A.
in Berlin.
formen mit einer phantastisch-abstrakten Ornamentik (die be-
kannten Augen-Ornamente Mackintoshs u. a.) einen charakteri-
stischen Gegensatz bildet zu der natürlichen Einfachheit des
englischen Möbelstils.
Soviel Reichtum anregender Ideen und glänzender Einfälle
in diesen Werken von Pankok, Olbrich, van de Velde u. s. w.
in die Entwicklung gestreut wurde, eine endgültige Lösung der
Kulturaufgabe, welche die moderne Bewegung ins Leben ge-
rufen hatte, konnten sie gleichwohl nicht bedeuten. Sie tragen
durchaus den Charakter des Suchenden. Je mehr sie sich
in ihrer absichtlich künstlerischen Formenwillkür vom Boden
zweck- und konstruktionsbedingter Natürlichkeit entfernen,
desto weniger können sie im Grunde dem praktisch nüch-
ternen, auf Einfachheit und Wahrheit dringenden Geschmack
heutiger Zeit zusagen. In Frankreich hat denn auch die ganze
29