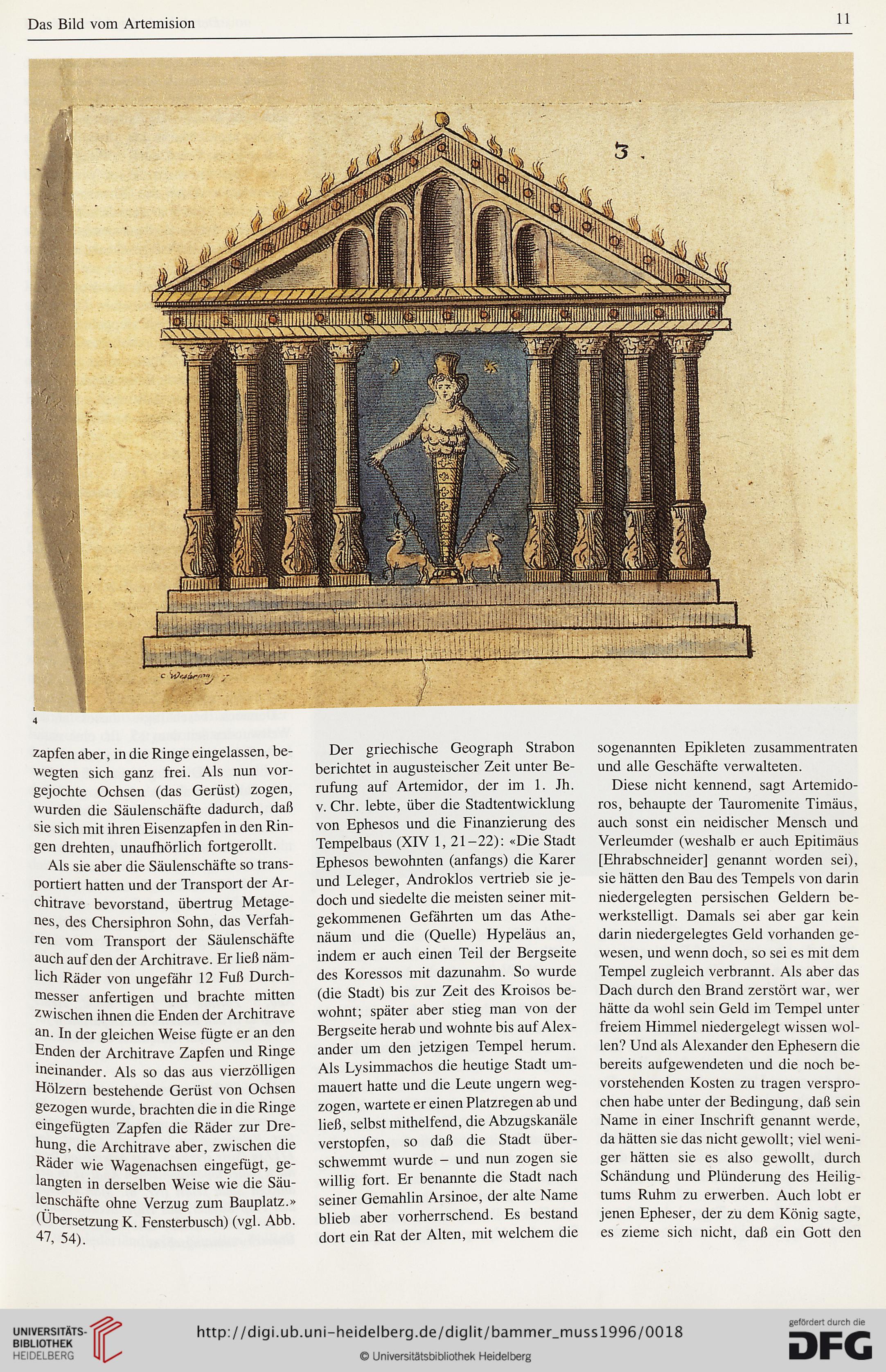Das Bild vom Artemision
11
zapfen aber, in die Ringe eingelassen, be-
wegten sich ganz frei. Als nun vor-
gejochte Ochsen (das Gerüst) zogen,
wurden die Säulenschäfte dadurch, daß
sie sich mit ihren Eisenzapfen in den Rin-
gen drehten, unaufhörlich fortgerollt.
Als sie aber die Säulenschäfte so trans-
portiert hatten und der Transport der Ar-
chitrave bevorstand, übertrug Metage-
nes, des Chersiphron Sohn, das Verfah-
ren vom Transport der Säulenschäfte
auch auf den der Architrave. Er ließ näm-
lich Räder von ungefähr 12 Fuß Durch-
messer anfertigen und brachte mitten
zwischen ihnen die Enden der Architrave
an- In der gleichen Weise fiigte er an den
Enden der Architrave Zapfen und Ringe
meinander. Als so das aus vierzölligen
Hölzern bestehende Gerüst von Ochsen
gezogen wurde, brachten die in die Ringe
eingefügten Zapfen die Räder zur Dre-
hung, die Architrave aber, zwischen die
Räder wie Wagenachsen eingefugt, ge-
iangten in derselben Weise wie die Säu-
lenschäfte ohne Verzug zum Bauplatz.»
(Übersetzung K. Fensterbusch) (vgl. Abb.
47, 54).
Der griechische Geograph Strabon
berichtet in augusteischer Zeit unter Be-
rufung auf Artemidor, der im 1. Jh.
v. Chr. lebte, iiber die Stadtentwicklung
von Ephesos und die Finanzierung des
Tempelbaus (XIV 1,21-22): «Die Stadt
Ephesos bewohnten (anfangs) die Karer
und Leleger, Androklos vertrieb sie je-
doch und siedelte die meisten seiner mit-
gekommenen Gefährten um das Athe-
näum und die (Quelle) Hypeläus an,
indem er auch einen Teil der Bergseite
des Koressos mit dazunahm. So wurde
(die Stadt) bis zur Zeit des Kroisos be-
wohnt; später aber stieg man von der
Bergseite herab und wohnte bis auf Alex-
ander um den jetzigen Tempel herum.
Als Lysimmachos die heutige Stadt um-
mauert hatte und die Leute ungern weg-
zogen, wartete er einen Platzregen ab und
ließ, selbst mithelfend, die Abzugskanäle
verstopfen, so daß die Stadt über-
schwemmt wurde - und nun zogen sie
willig fort. Er benannte die Stadt nach
seiner Gemahlin Arsinoe, der alte Name
blieb aber vorherrschend. Es bestand
dort ein Rat der Alten, mit welchem die
sogenannten Epikleten zusammentraten
und alle Geschäfte verwalteten.
Diese nicht kennend, sagt Artemido-
ros, behaupte der Tauromenite Timäus,
auch sonst ein neidischer Mensch und
Verleumder (weshalb er auch Epitimäus
[Ehrabschneider] genannt worden sei),
sie hätten den Bau des Tempels von darin
niedergelegten persischen Geldern be-
werkstelligt. Damals sei aber gar kein
darin niedergelegtes Geld vorhanden ge-
wesen, und wenn doch, so sei es mit dem
Tempel zugleich verbrannt. Als aber das
Dach durch den Brand zerstört war, wer
hätte da wohl sein Geld im Tempel unter
freiem Himmel niedergelegt wissen wol-
len? Und als Alexander den Ephesern die
bereits aufgewendeten und die noch be-
vorstehenden Kosten zu tragen verspro-
chen habe unter der Bedingung, daß sein
Name in einer Inschrift genannt werde,
da hätten sie das nicht gewollt; viel weni-
ger hätten sie es also gewollt, durch
Schändung und Plünderung des Heilig-
tums Ruhm zu erwerben. Auch lobt er
jenen Epheser, der zu dem König sagte,
es zieme sich nicht, daß ein Gott den
11
zapfen aber, in die Ringe eingelassen, be-
wegten sich ganz frei. Als nun vor-
gejochte Ochsen (das Gerüst) zogen,
wurden die Säulenschäfte dadurch, daß
sie sich mit ihren Eisenzapfen in den Rin-
gen drehten, unaufhörlich fortgerollt.
Als sie aber die Säulenschäfte so trans-
portiert hatten und der Transport der Ar-
chitrave bevorstand, übertrug Metage-
nes, des Chersiphron Sohn, das Verfah-
ren vom Transport der Säulenschäfte
auch auf den der Architrave. Er ließ näm-
lich Räder von ungefähr 12 Fuß Durch-
messer anfertigen und brachte mitten
zwischen ihnen die Enden der Architrave
an- In der gleichen Weise fiigte er an den
Enden der Architrave Zapfen und Ringe
meinander. Als so das aus vierzölligen
Hölzern bestehende Gerüst von Ochsen
gezogen wurde, brachten die in die Ringe
eingefügten Zapfen die Räder zur Dre-
hung, die Architrave aber, zwischen die
Räder wie Wagenachsen eingefugt, ge-
iangten in derselben Weise wie die Säu-
lenschäfte ohne Verzug zum Bauplatz.»
(Übersetzung K. Fensterbusch) (vgl. Abb.
47, 54).
Der griechische Geograph Strabon
berichtet in augusteischer Zeit unter Be-
rufung auf Artemidor, der im 1. Jh.
v. Chr. lebte, iiber die Stadtentwicklung
von Ephesos und die Finanzierung des
Tempelbaus (XIV 1,21-22): «Die Stadt
Ephesos bewohnten (anfangs) die Karer
und Leleger, Androklos vertrieb sie je-
doch und siedelte die meisten seiner mit-
gekommenen Gefährten um das Athe-
näum und die (Quelle) Hypeläus an,
indem er auch einen Teil der Bergseite
des Koressos mit dazunahm. So wurde
(die Stadt) bis zur Zeit des Kroisos be-
wohnt; später aber stieg man von der
Bergseite herab und wohnte bis auf Alex-
ander um den jetzigen Tempel herum.
Als Lysimmachos die heutige Stadt um-
mauert hatte und die Leute ungern weg-
zogen, wartete er einen Platzregen ab und
ließ, selbst mithelfend, die Abzugskanäle
verstopfen, so daß die Stadt über-
schwemmt wurde - und nun zogen sie
willig fort. Er benannte die Stadt nach
seiner Gemahlin Arsinoe, der alte Name
blieb aber vorherrschend. Es bestand
dort ein Rat der Alten, mit welchem die
sogenannten Epikleten zusammentraten
und alle Geschäfte verwalteten.
Diese nicht kennend, sagt Artemido-
ros, behaupte der Tauromenite Timäus,
auch sonst ein neidischer Mensch und
Verleumder (weshalb er auch Epitimäus
[Ehrabschneider] genannt worden sei),
sie hätten den Bau des Tempels von darin
niedergelegten persischen Geldern be-
werkstelligt. Damals sei aber gar kein
darin niedergelegtes Geld vorhanden ge-
wesen, und wenn doch, so sei es mit dem
Tempel zugleich verbrannt. Als aber das
Dach durch den Brand zerstört war, wer
hätte da wohl sein Geld im Tempel unter
freiem Himmel niedergelegt wissen wol-
len? Und als Alexander den Ephesern die
bereits aufgewendeten und die noch be-
vorstehenden Kosten zu tragen verspro-
chen habe unter der Bedingung, daß sein
Name in einer Inschrift genannt werde,
da hätten sie das nicht gewollt; viel weni-
ger hätten sie es also gewollt, durch
Schändung und Plünderung des Heilig-
tums Ruhm zu erwerben. Auch lobt er
jenen Epheser, der zu dem König sagte,
es zieme sich nicht, daß ein Gott den