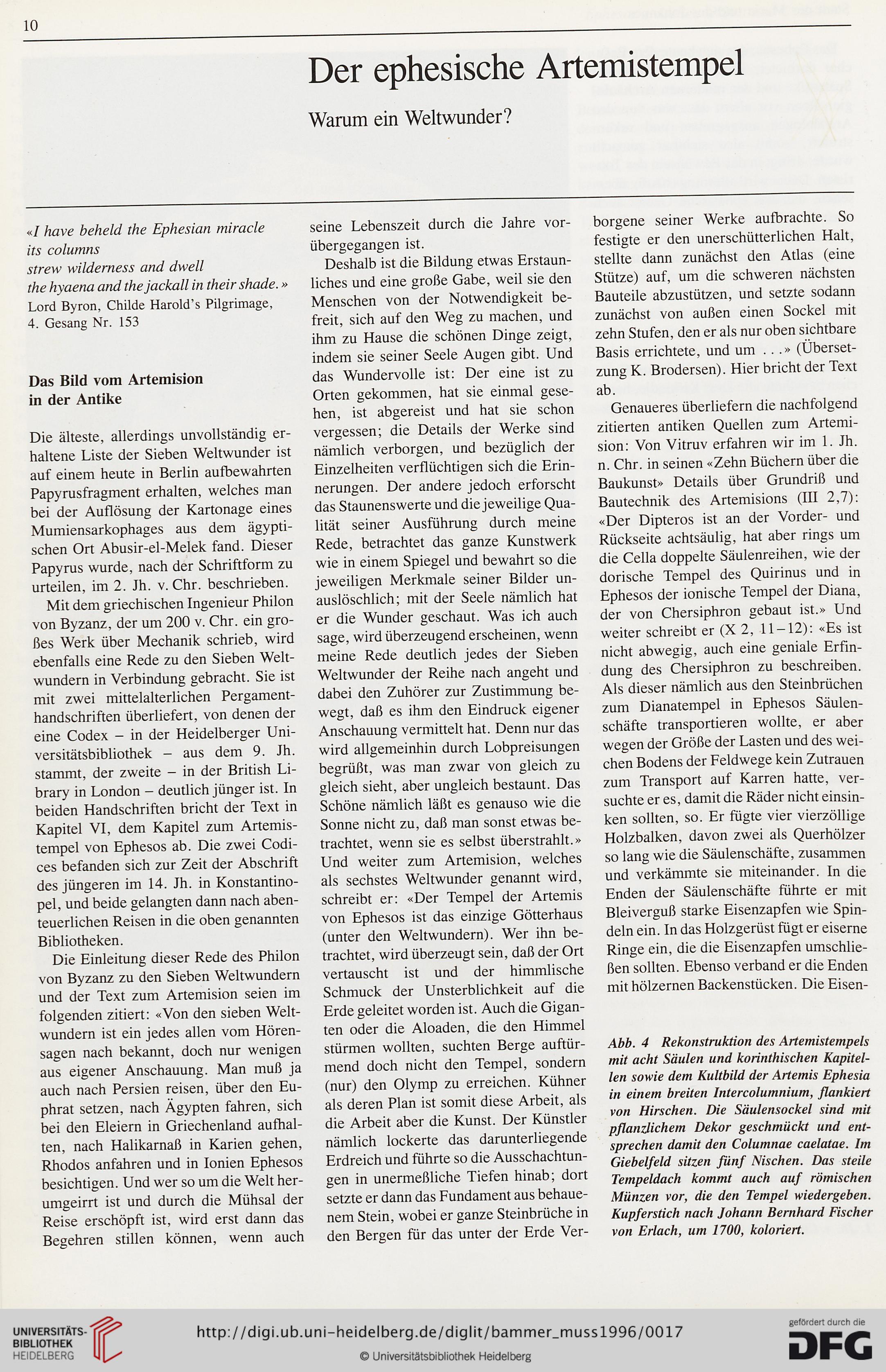10
Der ephesische Artemistempel
Warum ein Weltwunder?
«/ have beheld the Ephesian miracle
its columns
strew wilderness and dwell
the hyaena and the jackall in their shade.»
Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage,
4. Gesang Nr. 153
Das Bild vom Artemision
in der Antike
Die älteste, allerdings unvollständig er-
haltene Liste der Sieben Weltwunder ist
auf einem heute in Berlin aufbewahrten
Papyrusfragment erhalten, welches man
bei der Auflösung der Kartonage eines
Mumiensarkophages aus dem ägypti-
schen Ort Abusir-el-Melek fand. Dieser
Papyrus wurde, nach der Schriftform zu
urteilen, im 2. Jh. v. Chr. beschrieben.
Mit dem griechischen Ingenieur Philon
von Byzanz, der um 200 v. Chr. ein gro-
ßes Werk über Mechanik schrieb, wird
ebenfalls eine Rede zu den Sieben Welt-
wundern in Verbindung gebracht. Sie ist
mit zwei mittelalterlichen Pergament-
handschriften überliefert, von denen der
eine Codex - in der Heidelberger Uni-
versitätsbibliothek - aus dem 9. Jh.
stammt, der zweite - in der British Li-
brary in London - deutlich jünger ist. In
beiden Handschriften bricht der Text in
Kapitel VI, dem Kapitel zum Artemis-
tempel von Ephesos ab. Die zwei Codi-
ces befanden sich zur Zeit der Abschrift
des jüngeren im 14. Jh. in Konstantino-
pel, und beide gelangten dann nach aben-
teuerlichen Reisen in die oben genannten
Bibliotheken.
Die Einleitung dieser Rede des Philon
von Byzanz zu den Sieben Weltwundem
und der Text zum Artemision seien im
folgenden zitiert: «Von den sieben Welt-
wundern ist ein jedes allen vom Hören-
sagen nach bekannt, doch nur wenigen
aus eigener Anschauung. Man muß ja
auch nach Persien reisen, über den Eu-
phrat setzen, nach Ägypten fahren, sich
bei den Eleiern in Griechenland aufhal-
ten, nach Halikarnaß in Karien gehen,
Rhodos anfahren und in Ionien Ephesos
besichtigen. Und wer so um die Welt her-
umgeirrt ist und durch die Mühsal der
Reise erschöpft ist, wird erst dann das
Begehren stillen können, wenn auch
seine Lebenszeit durch die Jahre vor-
übergegangen ist.
Deshalb ist die Bildung etwas Erstaun-
liches und eine große Gabe, weil sie den
Menschen von der Notwendigkeit be-
freit, sich auf den Weg zu machen, und
ihm zu Hause die schönen Dinge zeigt,
indem sie seiner Seele Augen gibt. Und
das Wundervolle ist: Der eine ist zu
Orten gekommen, hat sie einmal gese-
hen, ist abgereist und hat sie schon
vergessen; die Details der Werke sind
nämlich verborgen, und bezüglich der
Einzelheiten verflüchtigen sich die Erin-
nerungen. Der andere jedoch erforscht
das Staunenswerte und die jeweilige Qua-
lität seiner Ausführung durch meine
Rede, betrachtet das ganze Kunstwerk
wie in einem Spiegel und bewahrt so die
jeweiligen Merkmale seiner Bilder un-
auslöschlich; mit der Seele nämlich hat
er die Wunder geschaut. Was ich auch
sage, wird überzeugend erscheinen, wenn
meine Rede deutlich jedes der Sieben
Weltwunder der Reihe nach angeht und
dabei den Zuhörer zur Zustimmung be-
wegt, daß es ihm den Eindruck eigener
Anschauung vermittelt hat. Denn nur das
wird allgemeinhin durch Lobpreisungen
begrüßt, was man zwar von gleich zu
gleich sieht, aber ungleich bestaunt. Das
Schöne nämlich läßt es genauso wie die
Sonne nicht zu, daß man sonst etwas be-
trachtet, wenn sie es selbst überstrahlt.»
Und weiter zum Artemision, welches
als sechstes Weltwunder genannt wird,
schreibt er: «Der Tempel der Artemis
von Ephesos ist das einzige Götterhaus
(unter den Weltwundern). Wer ihn be-
trachtet, wird überzeugt sein, daß der Ort
vertauscht ist und der himmlische
Schmuck der Unsterblichkeit auf die
Erde geleitet worden ist. Auch die Gigan-
ten oder die Aloaden, die den Himmel
stürmen wollten, suchten Berge auftür-
mend doch nicht den Tempel, sondern
(nur) den Olymp zu erreichen. Kühner
als deren Plan ist somit diese Arbeit, als
die Arbeit aber die Kunst. Der Künstler
nämlich lockerte das darunterliegende
Erdreich und führte so die Ausschachtun-
gen in unermeßliche Tiefen hinab; dort
setzte er dann das Fundament aus behaue-
nem Stein, wobei er ganze Steinbrüche in
den Bergen für das unter der Erde Ver-
borgene seiner Werke aufbrachte. So
festigte er den unerschütterlichen Halt,
stellte dann zunächst den Atlas (eine
Stütze) auf, um die schweren nächsten
Bauteile abzustützen, und setzte sodann
zunächst von außen einen Sockel mit
zehn Stufen, den er als nur oben sichtbare
Basis errichtete, und um ...» (Überset-
zung K. Brodersen). Hier bricht der Text
ab.
Genaueres überliefern die nachfolgend
zitierten antiken Quellen zum Artemi-
sion: Von Vitruv erfahren wir im 1. Jh.
n. Chr. in seinen «Zehn Büchern über die
Baukunst» Details über Grundriß und
Bautechnik des Artemisions (III 2,7):
«Der Dipteros ist an der Vorder- und
Rückseite achtsäulig, hat aber rings um
die Cella doppelte Säulenreihen, wie der
dorische Tempel des Quirinus und in
Ephesos der ionische Tempel der Diana,
der von Chersiphron gebaut ist.» Und
weiter schreibt er (X 2, 11-12): «Es ist
nicht abwegig, auch eine geniale Erfin-
dung des Chersiphron zu beschreiben.
Als dieser nämlich aus den Steinbrüchen
zum Dianatempel in Ephesos Säulen-
schäfte transportieren wollte, er aber
wegen der Größe der Lasten und des wei-
chen Bodens der Feldwege kein Zutrauen
zum Transport auf Karren hatte, ver-
suchte er es, damit die Räder nicht einsin-
ken sollten, so. Er fügte vier vierzöllige
Holzbalken, davon zwei als Querhölzer
so lang wie die Säulenschäfte, zusammen
und verkämmte sie miteinander. In die
Enden der Säulenschäfte führte er mit
Bleiverguß starke Eisenzapfen wie Spin-
deln ein. In das Holzgerüst fügt er eiserne
Ringe ein, die die Eisenzapfen umschlie-
ßen sollten. Ebenso verband er die Enden
mit hölzernen Backenstücken. Die Eisen-
Abb. 4 Rekonstruktion des Artemistempels
mit acht Säulen und korinthischen Kapitel-
len sowie dem Kultbild der Artemis Ephesia
in einem breiten Intercolumnium, flankiert
von Hirschen. Die Säulensockel sind mit
pflanilichem Dekor geschmückt und ent-
sprechen damit den Columnae caelatae. Im
Giebelfeld sitzen fiinf Nischen. Das steile
Tempeldach kommt auch auf römischen
Münzen vor, die den Tempel wiedergeben.
Kupferstich nach Johann Bernhard Fischer
von Erlach, um 1700, koloriert.
Der ephesische Artemistempel
Warum ein Weltwunder?
«/ have beheld the Ephesian miracle
its columns
strew wilderness and dwell
the hyaena and the jackall in their shade.»
Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage,
4. Gesang Nr. 153
Das Bild vom Artemision
in der Antike
Die älteste, allerdings unvollständig er-
haltene Liste der Sieben Weltwunder ist
auf einem heute in Berlin aufbewahrten
Papyrusfragment erhalten, welches man
bei der Auflösung der Kartonage eines
Mumiensarkophages aus dem ägypti-
schen Ort Abusir-el-Melek fand. Dieser
Papyrus wurde, nach der Schriftform zu
urteilen, im 2. Jh. v. Chr. beschrieben.
Mit dem griechischen Ingenieur Philon
von Byzanz, der um 200 v. Chr. ein gro-
ßes Werk über Mechanik schrieb, wird
ebenfalls eine Rede zu den Sieben Welt-
wundern in Verbindung gebracht. Sie ist
mit zwei mittelalterlichen Pergament-
handschriften überliefert, von denen der
eine Codex - in der Heidelberger Uni-
versitätsbibliothek - aus dem 9. Jh.
stammt, der zweite - in der British Li-
brary in London - deutlich jünger ist. In
beiden Handschriften bricht der Text in
Kapitel VI, dem Kapitel zum Artemis-
tempel von Ephesos ab. Die zwei Codi-
ces befanden sich zur Zeit der Abschrift
des jüngeren im 14. Jh. in Konstantino-
pel, und beide gelangten dann nach aben-
teuerlichen Reisen in die oben genannten
Bibliotheken.
Die Einleitung dieser Rede des Philon
von Byzanz zu den Sieben Weltwundem
und der Text zum Artemision seien im
folgenden zitiert: «Von den sieben Welt-
wundern ist ein jedes allen vom Hören-
sagen nach bekannt, doch nur wenigen
aus eigener Anschauung. Man muß ja
auch nach Persien reisen, über den Eu-
phrat setzen, nach Ägypten fahren, sich
bei den Eleiern in Griechenland aufhal-
ten, nach Halikarnaß in Karien gehen,
Rhodos anfahren und in Ionien Ephesos
besichtigen. Und wer so um die Welt her-
umgeirrt ist und durch die Mühsal der
Reise erschöpft ist, wird erst dann das
Begehren stillen können, wenn auch
seine Lebenszeit durch die Jahre vor-
übergegangen ist.
Deshalb ist die Bildung etwas Erstaun-
liches und eine große Gabe, weil sie den
Menschen von der Notwendigkeit be-
freit, sich auf den Weg zu machen, und
ihm zu Hause die schönen Dinge zeigt,
indem sie seiner Seele Augen gibt. Und
das Wundervolle ist: Der eine ist zu
Orten gekommen, hat sie einmal gese-
hen, ist abgereist und hat sie schon
vergessen; die Details der Werke sind
nämlich verborgen, und bezüglich der
Einzelheiten verflüchtigen sich die Erin-
nerungen. Der andere jedoch erforscht
das Staunenswerte und die jeweilige Qua-
lität seiner Ausführung durch meine
Rede, betrachtet das ganze Kunstwerk
wie in einem Spiegel und bewahrt so die
jeweiligen Merkmale seiner Bilder un-
auslöschlich; mit der Seele nämlich hat
er die Wunder geschaut. Was ich auch
sage, wird überzeugend erscheinen, wenn
meine Rede deutlich jedes der Sieben
Weltwunder der Reihe nach angeht und
dabei den Zuhörer zur Zustimmung be-
wegt, daß es ihm den Eindruck eigener
Anschauung vermittelt hat. Denn nur das
wird allgemeinhin durch Lobpreisungen
begrüßt, was man zwar von gleich zu
gleich sieht, aber ungleich bestaunt. Das
Schöne nämlich läßt es genauso wie die
Sonne nicht zu, daß man sonst etwas be-
trachtet, wenn sie es selbst überstrahlt.»
Und weiter zum Artemision, welches
als sechstes Weltwunder genannt wird,
schreibt er: «Der Tempel der Artemis
von Ephesos ist das einzige Götterhaus
(unter den Weltwundern). Wer ihn be-
trachtet, wird überzeugt sein, daß der Ort
vertauscht ist und der himmlische
Schmuck der Unsterblichkeit auf die
Erde geleitet worden ist. Auch die Gigan-
ten oder die Aloaden, die den Himmel
stürmen wollten, suchten Berge auftür-
mend doch nicht den Tempel, sondern
(nur) den Olymp zu erreichen. Kühner
als deren Plan ist somit diese Arbeit, als
die Arbeit aber die Kunst. Der Künstler
nämlich lockerte das darunterliegende
Erdreich und führte so die Ausschachtun-
gen in unermeßliche Tiefen hinab; dort
setzte er dann das Fundament aus behaue-
nem Stein, wobei er ganze Steinbrüche in
den Bergen für das unter der Erde Ver-
borgene seiner Werke aufbrachte. So
festigte er den unerschütterlichen Halt,
stellte dann zunächst den Atlas (eine
Stütze) auf, um die schweren nächsten
Bauteile abzustützen, und setzte sodann
zunächst von außen einen Sockel mit
zehn Stufen, den er als nur oben sichtbare
Basis errichtete, und um ...» (Überset-
zung K. Brodersen). Hier bricht der Text
ab.
Genaueres überliefern die nachfolgend
zitierten antiken Quellen zum Artemi-
sion: Von Vitruv erfahren wir im 1. Jh.
n. Chr. in seinen «Zehn Büchern über die
Baukunst» Details über Grundriß und
Bautechnik des Artemisions (III 2,7):
«Der Dipteros ist an der Vorder- und
Rückseite achtsäulig, hat aber rings um
die Cella doppelte Säulenreihen, wie der
dorische Tempel des Quirinus und in
Ephesos der ionische Tempel der Diana,
der von Chersiphron gebaut ist.» Und
weiter schreibt er (X 2, 11-12): «Es ist
nicht abwegig, auch eine geniale Erfin-
dung des Chersiphron zu beschreiben.
Als dieser nämlich aus den Steinbrüchen
zum Dianatempel in Ephesos Säulen-
schäfte transportieren wollte, er aber
wegen der Größe der Lasten und des wei-
chen Bodens der Feldwege kein Zutrauen
zum Transport auf Karren hatte, ver-
suchte er es, damit die Räder nicht einsin-
ken sollten, so. Er fügte vier vierzöllige
Holzbalken, davon zwei als Querhölzer
so lang wie die Säulenschäfte, zusammen
und verkämmte sie miteinander. In die
Enden der Säulenschäfte führte er mit
Bleiverguß starke Eisenzapfen wie Spin-
deln ein. In das Holzgerüst fügt er eiserne
Ringe ein, die die Eisenzapfen umschlie-
ßen sollten. Ebenso verband er die Enden
mit hölzernen Backenstücken. Die Eisen-
Abb. 4 Rekonstruktion des Artemistempels
mit acht Säulen und korinthischen Kapitel-
len sowie dem Kultbild der Artemis Ephesia
in einem breiten Intercolumnium, flankiert
von Hirschen. Die Säulensockel sind mit
pflanilichem Dekor geschmückt und ent-
sprechen damit den Columnae caelatae. Im
Giebelfeld sitzen fiinf Nischen. Das steile
Tempeldach kommt auch auf römischen
Münzen vor, die den Tempel wiedergeben.
Kupferstich nach Johann Bernhard Fischer
von Erlach, um 1700, koloriert.