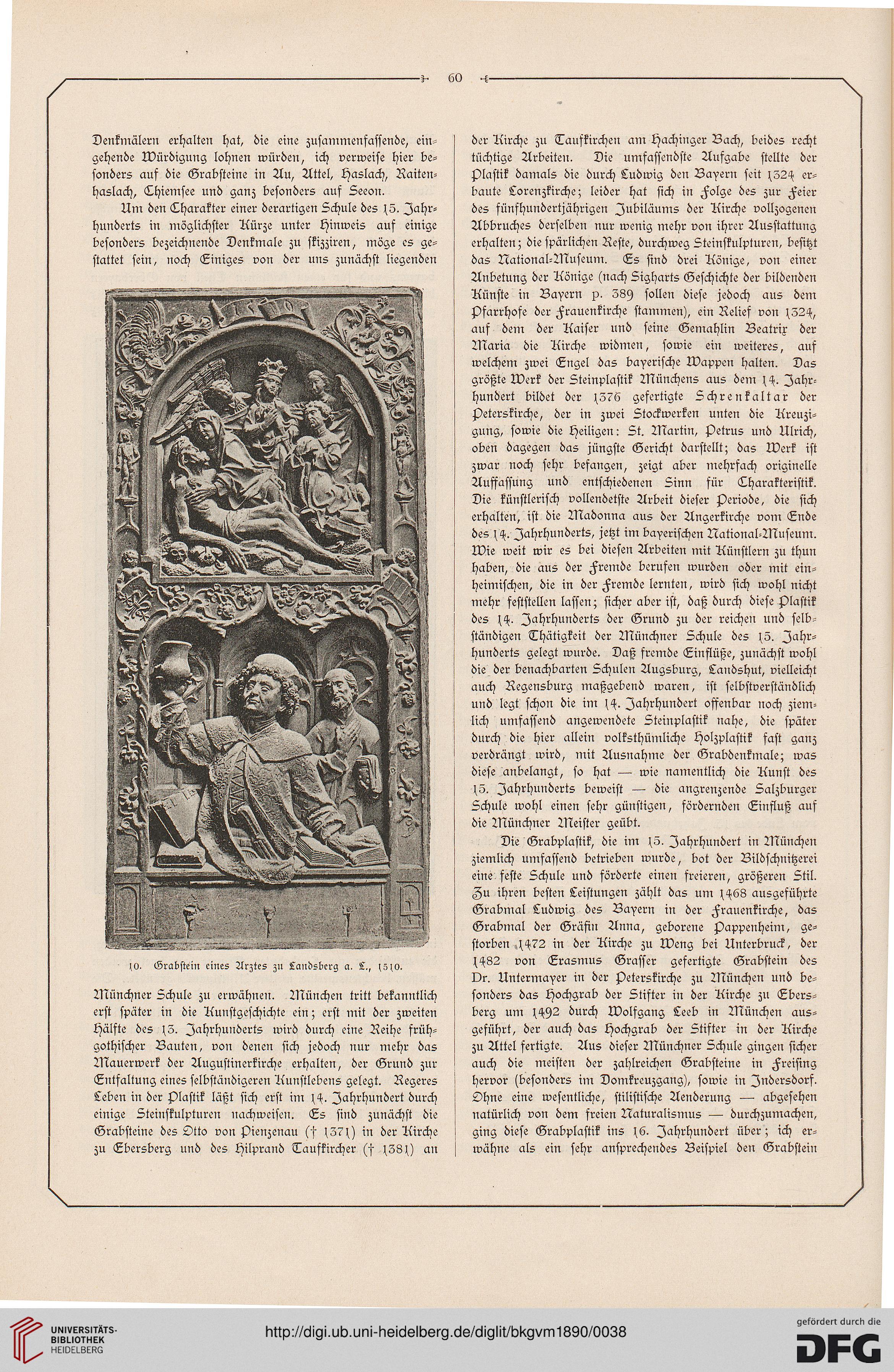Denkmälern erhalten hat, die eine zusammenfassende, ein-
gehende Würdigung lohnen würden, ich verweise hier be-
sonders auf die Grabsteine in Au, Atteh Haslach, Raiten-
haslach, Ehiemsee und ganz besonders auf Seeon.
Am den Eharakter einer derartigen Schule des (5. Jahr-
hunderts in möglichster Aürze unter Hinweis auf einige
befonders bezeichnende Denkmale zu skizziren, möge cs ge-
stattet sein, noch Einiges von der uns zunächst liegenden
JO- Grabstein eines Arztes zu Landsberg a- L-, jsjo.
Münchner Schule zu erwähnen. München tritt bekanntlich
erst später in die Kunstgeschichte ein; erst init der zweiten
Pälfte des so. Jahrhunderts wird durch eine Reihe früh-
gothischer Bauten, von denen sich jedoch nur mehr das
Mauerwerk der Augustinerkirche erhalten, der Grund zur
Entfaltung eines selbständigeren Annstlebens gelegt. Regeres
Leben in der Plastik läßt sich erst im Jahrhundert durch
einige Steinskulpturen Nachweisen. Es sind zunächst die
Grabsteine des Otto von Pienzenau (ff \37\) in der Airche
zu Ebersberg und des Pilprand Taufkircher (f (38 () an
der Airche zu Taufkirchen anr pachinger Bach, beides recht
tüchtige Arbeiten. Die unrfaffendste Aufgabe stellte der
Plastik damals die durch Ludwig den Bayern seit (52H er-
baute Lorenzkirche; leider hat sich in Folge des zur Feier
des fünfhundertjährigen Jubiläums der Airche vollzogenen
Abbruches derselben nur wenig mehr von ihrer Ausstattung
erhalten; die spärlichen Reste, durchweg Steinskulpturen, besitzt
das National-Museum. Es sind drei Aönige, von einer
Anbetung der Aönige (nach Sigharts Geschichte der bildenden
Aünste in Bayern p. 089 sollen diese jedoch aus dein
pfarrhofe der Frauenkirche stammen), ein Relief von (32^,
auf dem der Aaiser und feine Gemahlin Beatrix der
Maria die Airche widmen, sowie ein weiteres, auf
welchem zwei Engel das bayerische Wappen halten. Das
größte Werk der Steinplastik Münchens aus dem (<(. Jahr-
hundert bildet der (376 gefertigte Schrenkaltar der
Peterskirche, der in zwei Stockwerken unten die Areuzi-
gung, sowie die peiligen: St. Martin, Petrus und Ulrich,
oben dagegen das jüngste Gericht darstellt; das Werk ist
zwar noch sehr befangen, zeigt aber mehrfach originelle
Auffaffung und entschiedenen Sinn für Eharakteristik.
Die künstlerisch vollendetste Arbeit dieser Periode, die sich
erhalten, ist die Madonna aus der Angerkirche vom Ende
des (H. Jahrhunderts, jetzt hn bayerischen National-Museum.
Wie weit wir es bei diesen Arbeiten mit Aünstlern zu thun
haben, die aus der Freinde berufen wurden oder mit ein-
heimischen, die in der Fremde lernten, wird sich wohl nicht
niehr feststellen lassen; sicher aber ist, daß durch diese Plastik
des (H. Jahrhunderts der Grund zu der reichen und selb-
ständigen Thätigkeit der Münchner Schule des (3. Jahr-
hunderts gelegt wurde. Daß fremde Einflüße, zunächst wohl
die der benachbarten Schulen Augsburg, Landshut, vielleicht
auch Regensburg nraßgebend waren, ist selbstverständlich
und legt schon die im (<(. Jahrhundert offenbar noch ziem-
lich umfassend angewendete Steinplastik nahe, die später
durch die hier allein volksthümliche Holzplastik fast ganz
verdrängt wird, mit Ausnahme der Grabdenkmale; was
diese anbelangt, so hat —- wie namentlich die Aunst des
(3. Jahrhunderts beweist — die angrenzende Salzburger
Schule wohl einen sehr günstigen, fördernden Einfluß auf
die Münchner Meister geübt.
Die Grabplastik, die im (3. Jahrhundert in München
ziemlich umfassend betrieben wurde, bot der Bildschuitzerei
eine feste Schule und förderte einen freieren, größeren Stil.
Zu ihren besten Leistungen zählt das um (-(68 ausgeführte
Grabmal Ludwig des Bayern in der Frauenkirche, das
Grabmal der Gräfin Anna, geborene Pappenheim, ge-
storben ,(*(72 in der Airche zu Weng bei Unterdrück, der
(-(82 von Erasmus Graffer gefertigte Grabstein des
Or. Untermayer in der Peterskirche zu München und be-
sonders das pochgrab der Stifter in der Airche zu Ebers-
berg um (*(92 durch Wolfgang Leeb in München aus-
geführt, der auch das pochgrab der Stifter in der Airche
zu Attel fertigte. Aus dieser Münchner Schule gingen sicher
auch die meisten der zahlreichen Grabsteine in Freising
hervor (besonders im Domkrcuzgang), sowie in Indersdors.
Ohne eine wesentliche, stilistische Aenderung — abgesehen
natürlich von dem freien Naturalismus — durchzumachen,
ging diese Grabplastik ins (6. Jahrhundert über; ich er-
wähne als ein sehr ansprechendes Beispiel den Grabstein
gehende Würdigung lohnen würden, ich verweise hier be-
sonders auf die Grabsteine in Au, Atteh Haslach, Raiten-
haslach, Ehiemsee und ganz besonders auf Seeon.
Am den Eharakter einer derartigen Schule des (5. Jahr-
hunderts in möglichster Aürze unter Hinweis auf einige
befonders bezeichnende Denkmale zu skizziren, möge cs ge-
stattet sein, noch Einiges von der uns zunächst liegenden
JO- Grabstein eines Arztes zu Landsberg a- L-, jsjo.
Münchner Schule zu erwähnen. München tritt bekanntlich
erst später in die Kunstgeschichte ein; erst init der zweiten
Pälfte des so. Jahrhunderts wird durch eine Reihe früh-
gothischer Bauten, von denen sich jedoch nur mehr das
Mauerwerk der Augustinerkirche erhalten, der Grund zur
Entfaltung eines selbständigeren Annstlebens gelegt. Regeres
Leben in der Plastik läßt sich erst im Jahrhundert durch
einige Steinskulpturen Nachweisen. Es sind zunächst die
Grabsteine des Otto von Pienzenau (ff \37\) in der Airche
zu Ebersberg und des Pilprand Taufkircher (f (38 () an
der Airche zu Taufkirchen anr pachinger Bach, beides recht
tüchtige Arbeiten. Die unrfaffendste Aufgabe stellte der
Plastik damals die durch Ludwig den Bayern seit (52H er-
baute Lorenzkirche; leider hat sich in Folge des zur Feier
des fünfhundertjährigen Jubiläums der Airche vollzogenen
Abbruches derselben nur wenig mehr von ihrer Ausstattung
erhalten; die spärlichen Reste, durchweg Steinskulpturen, besitzt
das National-Museum. Es sind drei Aönige, von einer
Anbetung der Aönige (nach Sigharts Geschichte der bildenden
Aünste in Bayern p. 089 sollen diese jedoch aus dein
pfarrhofe der Frauenkirche stammen), ein Relief von (32^,
auf dem der Aaiser und feine Gemahlin Beatrix der
Maria die Airche widmen, sowie ein weiteres, auf
welchem zwei Engel das bayerische Wappen halten. Das
größte Werk der Steinplastik Münchens aus dem (<(. Jahr-
hundert bildet der (376 gefertigte Schrenkaltar der
Peterskirche, der in zwei Stockwerken unten die Areuzi-
gung, sowie die peiligen: St. Martin, Petrus und Ulrich,
oben dagegen das jüngste Gericht darstellt; das Werk ist
zwar noch sehr befangen, zeigt aber mehrfach originelle
Auffaffung und entschiedenen Sinn für Eharakteristik.
Die künstlerisch vollendetste Arbeit dieser Periode, die sich
erhalten, ist die Madonna aus der Angerkirche vom Ende
des (H. Jahrhunderts, jetzt hn bayerischen National-Museum.
Wie weit wir es bei diesen Arbeiten mit Aünstlern zu thun
haben, die aus der Freinde berufen wurden oder mit ein-
heimischen, die in der Fremde lernten, wird sich wohl nicht
niehr feststellen lassen; sicher aber ist, daß durch diese Plastik
des (H. Jahrhunderts der Grund zu der reichen und selb-
ständigen Thätigkeit der Münchner Schule des (3. Jahr-
hunderts gelegt wurde. Daß fremde Einflüße, zunächst wohl
die der benachbarten Schulen Augsburg, Landshut, vielleicht
auch Regensburg nraßgebend waren, ist selbstverständlich
und legt schon die im (<(. Jahrhundert offenbar noch ziem-
lich umfassend angewendete Steinplastik nahe, die später
durch die hier allein volksthümliche Holzplastik fast ganz
verdrängt wird, mit Ausnahme der Grabdenkmale; was
diese anbelangt, so hat —- wie namentlich die Aunst des
(3. Jahrhunderts beweist — die angrenzende Salzburger
Schule wohl einen sehr günstigen, fördernden Einfluß auf
die Münchner Meister geübt.
Die Grabplastik, die im (3. Jahrhundert in München
ziemlich umfassend betrieben wurde, bot der Bildschuitzerei
eine feste Schule und förderte einen freieren, größeren Stil.
Zu ihren besten Leistungen zählt das um (-(68 ausgeführte
Grabmal Ludwig des Bayern in der Frauenkirche, das
Grabmal der Gräfin Anna, geborene Pappenheim, ge-
storben ,(*(72 in der Airche zu Weng bei Unterdrück, der
(-(82 von Erasmus Graffer gefertigte Grabstein des
Or. Untermayer in der Peterskirche zu München und be-
sonders das pochgrab der Stifter in der Airche zu Ebers-
berg um (*(92 durch Wolfgang Leeb in München aus-
geführt, der auch das pochgrab der Stifter in der Airche
zu Attel fertigte. Aus dieser Münchner Schule gingen sicher
auch die meisten der zahlreichen Grabsteine in Freising
hervor (besonders im Domkrcuzgang), sowie in Indersdors.
Ohne eine wesentliche, stilistische Aenderung — abgesehen
natürlich von dem freien Naturalismus — durchzumachen,
ging diese Grabplastik ins (6. Jahrhundert über; ich er-
wähne als ein sehr ansprechendes Beispiel den Grabstein