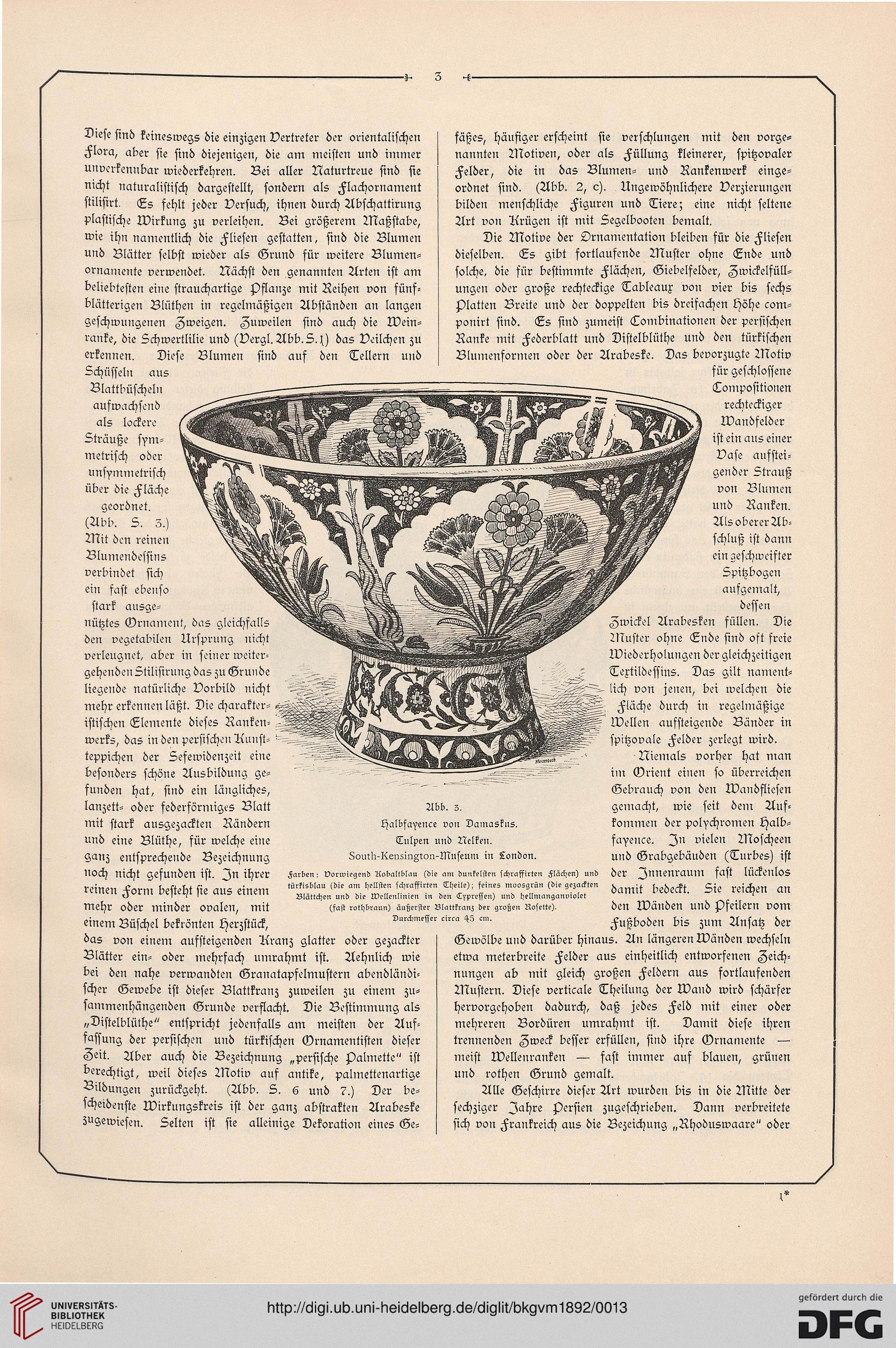/■
5tefe sind keineswegs die einzigen Vertreter der orientalischen
Flora, aber sie sind diejenigen, die an: meisten und immer
unverkennbar wiederkehren. Bei aller Naturtreue sind sie
nicht naturalistisch dargestellt, sondern als Flachornament
stilisirt. Es fehlt jeder Versuch, ihnen durch Abschattirung
plastische Wirkung zu verleihen. Bei größerem Maßstabe,
wie ihn namentlich die Fliesen gestatten, sind die Blumen
und Blätter selbst wieder als Grund für weitere Blumen-
ornamente verwendet. Nächst den genannten Arten ist am
beliebtesten eine strauchartige Pflanze mit Reihen von fünf-
blätterigen Blüthen in regelmäßigen Abständen an langen
geschwungenen Zweigen. Zuweilen sind auch die Wein-
ranke, die Schwertlilie und (Vergl. Abb.S.H das Veilchen zu
erkennen. Diese Blumen sind auf den Tellern und
Schüsseln aus
Blattbüfcheln
aufwachsend
als lockere
Sträuße sym-
metrisch oder
unsymmetrisch
über die Fläche
geordnet.
(Abb. S. 3.)
Mit den reinen
Blumendessins
verbindet sich
ein fast ebenso
stark ausge-
nütztcs Ornament, das gleichfalls
den vegetabilen Ursprung nicht
verleugnet, aber in seiner weiter-
gehenden Stilifinmg das zu Grunde
liegende natürliche Vorbild nicht
mehr erkennen läßt. Die charakter-
istischen Elemente dieses Ranken- *
Werks, das in den persischen Kuiist-
teppichen der Sefewidenzeit eine
besonders schöne Ausbildung ge-
sunden hat, sind ein längliches,
lanzett- oder federförmiges Blatt
mit stark ausgezackten Rändern
und eine Blüths, für welche eine
ganz entsprechende Bezeichnung
noch nicht gefunden ist. In ihrer
reinen Form besteht sie aus einem
mehr oder minder ovalen, mit
einen: Büschel bekrönten Herzstück,
das von einen: aufsteigenden Kranz glatter oder gezackter
Blätter ein- oder mehrfach umrahmt ist. Aehnlich wie
bei den nahe verwandten Granatapfelmustern abendländi-
scher Gewebe ist dieser Blattkranz zuweilen zu einem zu-
sainmenhängenden Grunde versiacht. Die Bestiminung als
,/Distelblüthe" entspricht jedenfalls am meisten der Auf-
fassung der persischen und türkischen Ornamentisten dieser
Seit. Aber auch die Bezeichnung „persische Palmette" ist
berechtigt, weil dieses Motiv auf antike, palmettenartige
Bildungen zurückgeht. (Abb. S. 6 und 7.) Der be-
scheidenste Wirkungskreis ist der ganz abstrakten Arabeske
Zugewiesen. Leiten ist sie alleinige Dekoration eines Ge-
Abb. s.
Ljalbfayence von Damaskus.
Tulpen und Nelken.
Loullr-IiensinAlon-Mnseuni in London.
Farben: Vorwiegend Aobaltblau (die am dunkelsten schraffirten Flächen) und
türkisblau (die am hellsten schraffirten Theile); feines moosgrün (die gezackten
Blättchen und die Wellenlinien in den Lypresien) und hellnianganviolet
(fast rothbraun) äußerster Blattkranz der großen Rosette).
Durchmesser circa ^5 cm.
fäßes, häufiger erscheint sie verschlungen mit den vorge-
nannten Motiven, oder als Füllung kleinerer, spitzovaler
Felder, die in das Blumen- und Rankenwerk einge-
ordnet sind. (Abb. 2, c). Nngewöhnlichere Verzierungen
bilden menschliche Figuren und Tiere; eine nicht seltene
Art von Krügen ist mit Segelbooten bciualt.
Die Motive der Ornamentation bleiben für die Fliesen
dieselben. Es gibt fortlaufende Muster ohne Ende und
solche, die für bestimmte Flächen, Giebelfelder, Zwickelfüll-
ungen oder große rechteckige Tableaux von vier bis sechs
Platten Breite und der doppelten bis dreifachen höhe com-
ponirt sind. Es sind zumeist Tombinationen der persischen
Ranke init Federblatt und Distelblüthe und den türkischen
Blumenformen oder der Arabeske. Das bevorzugte Motiv
für geschlossene
Tompositionen
rechteckiger
Wandselder
ist ein aus einer
Vase aufstei-
gender Strauß
von Blumen
und Ranken.
Als oberer Ab-
schluß ist dann
ein geschweifter
Spitzbogen
aufgemalt,
dessen
Zwickel Arabesken füllen. Die
Muster ohne Ende sind oft freie
Wiederholungen der gleichzeitigen
Textildessins. Das gilt nament-
lich von jenen, bei welchen die
Fläche durch in regelmäßige
Wellen aufsteigende Bänder in
spitzovale Felder zerlegt wird.
Niemals vorher hat man
im Grient einen so überreichen
Gebrauch von den Wandstiesen
gemacht, wie seit dein Auf-
kommen der polychromen Halb-
fayence. Zn vielen Moscheen
und Grabgebäuden (Turbes) ist
der Znnenraum fast lückenlos
damit bedeckt. Sie reichen an
den Wänden und Pfeilern vom
Fußboden bis zum Ansatz der
Gewölbe und darüber hinaus. An längeren Wänden wechseln
etwa meterbreite Felder aus einheitlich entworfenen Zeich-
nungen ab mit gleich großen Feldern aus fortlaufenden
Mustern. Diese verticale Theilung der Wand wird schärfer
hervorgchoben dadurch, daß jedes Feld init einer oder
nrehreren Bordüren umrahnrt ist. Damit diese ihren
trennenden Zweck besser erfüllen, sind ihre Ornamente —
meist Wellenranken — fast immer auf blauen, grünen
und rothen Grund gemalt.
Alle Geschirre dieser Art wurden bis in die Mitte der
sechziger Jahre Persien zugeschrieben. Dann verbreitete
sich von Frankreich aus die Bezeichung „Rhoduswaare" oder
/
5tefe sind keineswegs die einzigen Vertreter der orientalischen
Flora, aber sie sind diejenigen, die an: meisten und immer
unverkennbar wiederkehren. Bei aller Naturtreue sind sie
nicht naturalistisch dargestellt, sondern als Flachornament
stilisirt. Es fehlt jeder Versuch, ihnen durch Abschattirung
plastische Wirkung zu verleihen. Bei größerem Maßstabe,
wie ihn namentlich die Fliesen gestatten, sind die Blumen
und Blätter selbst wieder als Grund für weitere Blumen-
ornamente verwendet. Nächst den genannten Arten ist am
beliebtesten eine strauchartige Pflanze mit Reihen von fünf-
blätterigen Blüthen in regelmäßigen Abständen an langen
geschwungenen Zweigen. Zuweilen sind auch die Wein-
ranke, die Schwertlilie und (Vergl. Abb.S.H das Veilchen zu
erkennen. Diese Blumen sind auf den Tellern und
Schüsseln aus
Blattbüfcheln
aufwachsend
als lockere
Sträuße sym-
metrisch oder
unsymmetrisch
über die Fläche
geordnet.
(Abb. S. 3.)
Mit den reinen
Blumendessins
verbindet sich
ein fast ebenso
stark ausge-
nütztcs Ornament, das gleichfalls
den vegetabilen Ursprung nicht
verleugnet, aber in seiner weiter-
gehenden Stilifinmg das zu Grunde
liegende natürliche Vorbild nicht
mehr erkennen läßt. Die charakter-
istischen Elemente dieses Ranken- *
Werks, das in den persischen Kuiist-
teppichen der Sefewidenzeit eine
besonders schöne Ausbildung ge-
sunden hat, sind ein längliches,
lanzett- oder federförmiges Blatt
mit stark ausgezackten Rändern
und eine Blüths, für welche eine
ganz entsprechende Bezeichnung
noch nicht gefunden ist. In ihrer
reinen Form besteht sie aus einem
mehr oder minder ovalen, mit
einen: Büschel bekrönten Herzstück,
das von einen: aufsteigenden Kranz glatter oder gezackter
Blätter ein- oder mehrfach umrahmt ist. Aehnlich wie
bei den nahe verwandten Granatapfelmustern abendländi-
scher Gewebe ist dieser Blattkranz zuweilen zu einem zu-
sainmenhängenden Grunde versiacht. Die Bestiminung als
,/Distelblüthe" entspricht jedenfalls am meisten der Auf-
fassung der persischen und türkischen Ornamentisten dieser
Seit. Aber auch die Bezeichnung „persische Palmette" ist
berechtigt, weil dieses Motiv auf antike, palmettenartige
Bildungen zurückgeht. (Abb. S. 6 und 7.) Der be-
scheidenste Wirkungskreis ist der ganz abstrakten Arabeske
Zugewiesen. Leiten ist sie alleinige Dekoration eines Ge-
Abb. s.
Ljalbfayence von Damaskus.
Tulpen und Nelken.
Loullr-IiensinAlon-Mnseuni in London.
Farben: Vorwiegend Aobaltblau (die am dunkelsten schraffirten Flächen) und
türkisblau (die am hellsten schraffirten Theile); feines moosgrün (die gezackten
Blättchen und die Wellenlinien in den Lypresien) und hellnianganviolet
(fast rothbraun) äußerster Blattkranz der großen Rosette).
Durchmesser circa ^5 cm.
fäßes, häufiger erscheint sie verschlungen mit den vorge-
nannten Motiven, oder als Füllung kleinerer, spitzovaler
Felder, die in das Blumen- und Rankenwerk einge-
ordnet sind. (Abb. 2, c). Nngewöhnlichere Verzierungen
bilden menschliche Figuren und Tiere; eine nicht seltene
Art von Krügen ist mit Segelbooten bciualt.
Die Motive der Ornamentation bleiben für die Fliesen
dieselben. Es gibt fortlaufende Muster ohne Ende und
solche, die für bestimmte Flächen, Giebelfelder, Zwickelfüll-
ungen oder große rechteckige Tableaux von vier bis sechs
Platten Breite und der doppelten bis dreifachen höhe com-
ponirt sind. Es sind zumeist Tombinationen der persischen
Ranke init Federblatt und Distelblüthe und den türkischen
Blumenformen oder der Arabeske. Das bevorzugte Motiv
für geschlossene
Tompositionen
rechteckiger
Wandselder
ist ein aus einer
Vase aufstei-
gender Strauß
von Blumen
und Ranken.
Als oberer Ab-
schluß ist dann
ein geschweifter
Spitzbogen
aufgemalt,
dessen
Zwickel Arabesken füllen. Die
Muster ohne Ende sind oft freie
Wiederholungen der gleichzeitigen
Textildessins. Das gilt nament-
lich von jenen, bei welchen die
Fläche durch in regelmäßige
Wellen aufsteigende Bänder in
spitzovale Felder zerlegt wird.
Niemals vorher hat man
im Grient einen so überreichen
Gebrauch von den Wandstiesen
gemacht, wie seit dein Auf-
kommen der polychromen Halb-
fayence. Zn vielen Moscheen
und Grabgebäuden (Turbes) ist
der Znnenraum fast lückenlos
damit bedeckt. Sie reichen an
den Wänden und Pfeilern vom
Fußboden bis zum Ansatz der
Gewölbe und darüber hinaus. An längeren Wänden wechseln
etwa meterbreite Felder aus einheitlich entworfenen Zeich-
nungen ab mit gleich großen Feldern aus fortlaufenden
Mustern. Diese verticale Theilung der Wand wird schärfer
hervorgchoben dadurch, daß jedes Feld init einer oder
nrehreren Bordüren umrahnrt ist. Damit diese ihren
trennenden Zweck besser erfüllen, sind ihre Ornamente —
meist Wellenranken — fast immer auf blauen, grünen
und rothen Grund gemalt.
Alle Geschirre dieser Art wurden bis in die Mitte der
sechziger Jahre Persien zugeschrieben. Dann verbreitete
sich von Frankreich aus die Bezeichung „Rhoduswaare" oder
/