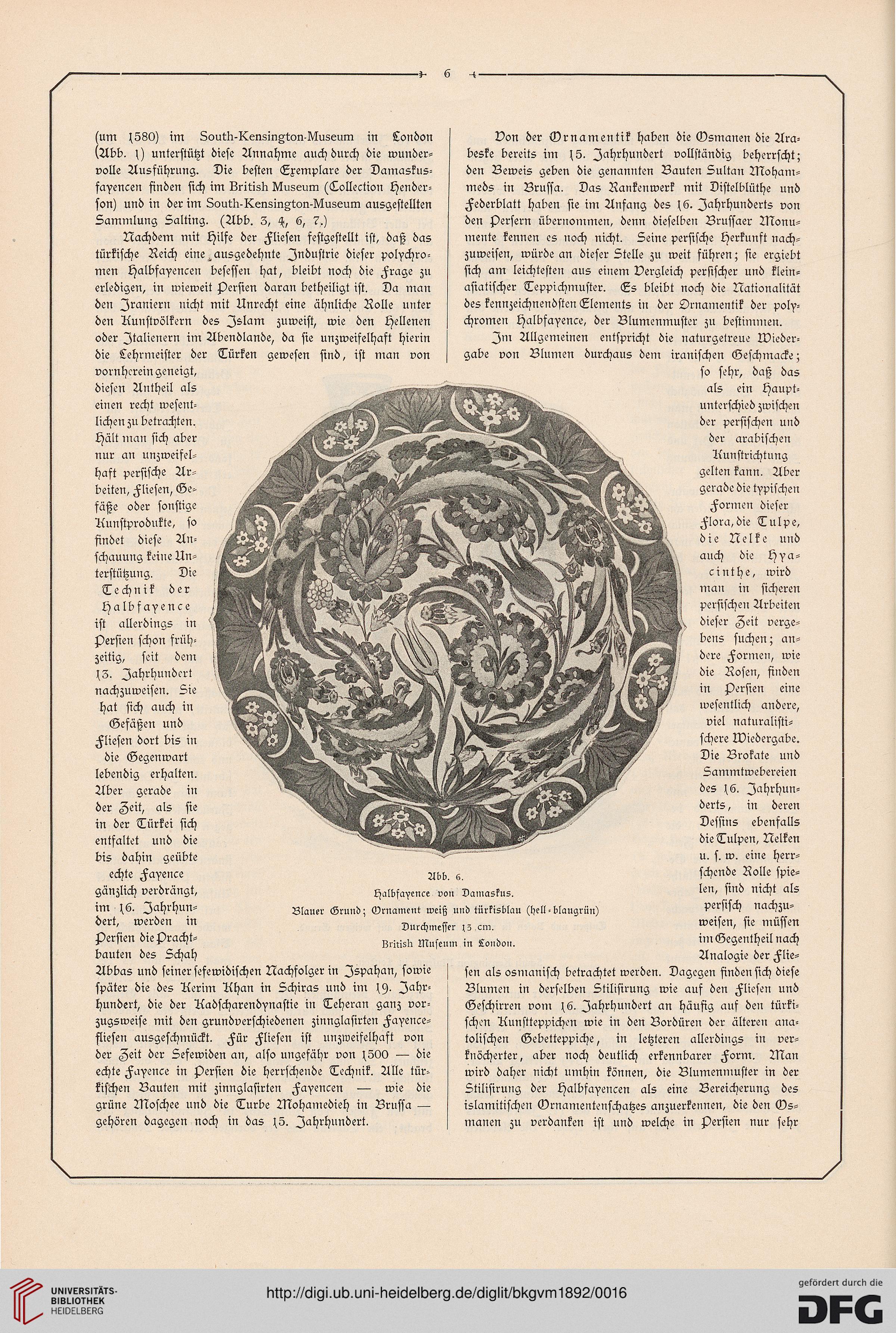6
4
x
■#-
(um 1580) im South-Kensington-Museum in London
(Abb. s) unterstützt diese Annahme auch durch die wunder-
volle Ausführung. Die besten Exemplare der Damaskus-
fayencen finden sich im British Museum (Collection pender-
fon) und in der im South-Kensington-Museum ausgestellten
Sammlung Salting. (Abb. 3, 6, 7.)
Nachdem mit pilfe der Fliesen festgestellt ist, daß das
türkische Reich eine ^ausgedehnte Industrie dieser polychro-
men palbfayencen besessen hat, bleibt noch die Frage zu
erledigen, in wieweit Persien daran betheiligt ist. Da man
den Iraniern nicht mit Unrecht eine ähnliche Rolle unter
den Kunstvölkern des Islam zuweist, wie den Hellenen
oder Italienern im Abendlande, da sie unzweifelhaft hierin
die Lehrmeister der Türken gewesen sind, ist man von
vornherein geneigt,
diesen Antheil als
einen recht wesent-
lichen zu betrachten,
f^ätt man sich aber
nur an unzweifel-
haft persische Ar-
beiten, Fliesen, Ge-
fäße oder sonstige
Kunstprodukte, so
findet diese An-
schauung keine Un-
terstützung. Die
Technik der
palbfayence
ist allerdings in
Persien schon früh-
zeitig, seit dem
f3. Jahrhundert
nachzuweisen. Sie
hat sich auch in
Gefäßen und
Fliesen dort bis in
die Gegenwart
lebendig erhalten.
Aber gerade in
der Zeit, als sie
in der Türkei sich
entfaltet und die
bis dahin geübte
echte Fayence
gänzlich verdrängt,
im f6. Jahrhun-
dert, werden in
Persien die Pracht-
bauten des Schah
Abbas und seiner sefewidischen Nachfolger in Ispahan, sowie
später die des Kerim Khan in Schiras und im \C). Jahr-
hundert, die der Kadscharendynastie in Teheran ganz vor-
zugsweise mit den grundverschiedenen zinnglasirten Fayence-
siiesen ausgeschmückt. Für Fliesen ist unzweifelhaft von
der Zeit der Sefewiden an, also ungefähr von f500 — die
echte Fayence in Persien die herrschende Technik. Alle tür-
kischen Bauten mit zinnglasirten Fayencen — wie die
grüne Moschee und die Turbe Mohamedieh in Brussa —
gehören dagegen noch in das fö. Jahrhundert.
Bon der Ornamentik haben die Osmanen die Ara-
beske bereits im f5. Jahrhundert vollständig beherrscht;
den Beweis geben die genannten Bauten Sultan Mohain-
meds in Brussa. Das Rankenwerk mit Distelblüthe und
Federblatt haben sie im Anfang des f6. Jahrhunderts von
den Persern übernommen, denn dieselben Brussaer Monu-
mente kennen es noch nicht. Seine persische Herkunft nach-
zuweisen, würde an dieser Stelle zu weit führen; sie ergiebt
sich am leichtesten aus einem Bergleich persischer und klein-
asiatischer Teppichmuster. Es bleibt noch die Nationalität
des kennzeichnendsten Elements in der Ornamentik der poly-
chromen kfalbfayence, der Blumenmuster zu bestimmen.
Im Allgemeinen entspricht die naturgetreue Wieder-
gabe von Blumen durchaus denr iranischen Geschmacke;
so sehr, daß das
als ein Paupt-
unterschied zwischen
der persischen und
der arabischen
Kunstrichtung
gelten kann. Aber
gerade die typischen
Formen dieser
Flora,die Tulpe,
die Nelke und
auch die pya-
cinthe, wird
man in sicheren
persischen Arbeiten
dieser Zeit verge-
bens suchen; an-
dere Formen, wie
die Rosen, finden
in Persien eine
wesentlich andere,
viel naturalisti-
schere Wiedergabe.
Die Brokate und
Sammtwebereien
des f6. Jahrhun-
derts , in deren
Dessins ebenfalls
die Tulpen, Nelken
u. f. w. eine herr-
schende Rolle spie-
len, sind nicht als
persisch nachzu-
weisen, sie müssen
imGegentheil nach
Analogie der Flie-
sen als osmanisch betrachtet werden. Dagegen finden sich diese
Blumen in derselben Stilisirung wie auf den Fliesen und
Geschirren vom (6. Jahrhundert an häufig auf den türki-
schen Kunstteppichen wie in den Bordüren der älteren ana-
tolischen Gebetteppiche, in letzteren allerdings in ver-
knöcherter, aber noch deutlich erkennbarer Form. Man
wird daher nicht umhin können, die Blumenmuster in der
Stilisirung der palbfayencen als eine Bereicherung des
islamitischen Grnamentenschatzes anzuerkennen, die den Ms-
manen zu verdanken ist und welche in Persien nur sehr
Abb. s.
Ejalbfaycncc von Damaskus.
Blauer Grund; Grnamcnt weiß und türkisblau (hell-blaugrun)
Durchmesser (5 .cm.
British Museum in London.
X
X
4
x
■#-
(um 1580) im South-Kensington-Museum in London
(Abb. s) unterstützt diese Annahme auch durch die wunder-
volle Ausführung. Die besten Exemplare der Damaskus-
fayencen finden sich im British Museum (Collection pender-
fon) und in der im South-Kensington-Museum ausgestellten
Sammlung Salting. (Abb. 3, 6, 7.)
Nachdem mit pilfe der Fliesen festgestellt ist, daß das
türkische Reich eine ^ausgedehnte Industrie dieser polychro-
men palbfayencen besessen hat, bleibt noch die Frage zu
erledigen, in wieweit Persien daran betheiligt ist. Da man
den Iraniern nicht mit Unrecht eine ähnliche Rolle unter
den Kunstvölkern des Islam zuweist, wie den Hellenen
oder Italienern im Abendlande, da sie unzweifelhaft hierin
die Lehrmeister der Türken gewesen sind, ist man von
vornherein geneigt,
diesen Antheil als
einen recht wesent-
lichen zu betrachten,
f^ätt man sich aber
nur an unzweifel-
haft persische Ar-
beiten, Fliesen, Ge-
fäße oder sonstige
Kunstprodukte, so
findet diese An-
schauung keine Un-
terstützung. Die
Technik der
palbfayence
ist allerdings in
Persien schon früh-
zeitig, seit dem
f3. Jahrhundert
nachzuweisen. Sie
hat sich auch in
Gefäßen und
Fliesen dort bis in
die Gegenwart
lebendig erhalten.
Aber gerade in
der Zeit, als sie
in der Türkei sich
entfaltet und die
bis dahin geübte
echte Fayence
gänzlich verdrängt,
im f6. Jahrhun-
dert, werden in
Persien die Pracht-
bauten des Schah
Abbas und seiner sefewidischen Nachfolger in Ispahan, sowie
später die des Kerim Khan in Schiras und im \C). Jahr-
hundert, die der Kadscharendynastie in Teheran ganz vor-
zugsweise mit den grundverschiedenen zinnglasirten Fayence-
siiesen ausgeschmückt. Für Fliesen ist unzweifelhaft von
der Zeit der Sefewiden an, also ungefähr von f500 — die
echte Fayence in Persien die herrschende Technik. Alle tür-
kischen Bauten mit zinnglasirten Fayencen — wie die
grüne Moschee und die Turbe Mohamedieh in Brussa —
gehören dagegen noch in das fö. Jahrhundert.
Bon der Ornamentik haben die Osmanen die Ara-
beske bereits im f5. Jahrhundert vollständig beherrscht;
den Beweis geben die genannten Bauten Sultan Mohain-
meds in Brussa. Das Rankenwerk mit Distelblüthe und
Federblatt haben sie im Anfang des f6. Jahrhunderts von
den Persern übernommen, denn dieselben Brussaer Monu-
mente kennen es noch nicht. Seine persische Herkunft nach-
zuweisen, würde an dieser Stelle zu weit führen; sie ergiebt
sich am leichtesten aus einem Bergleich persischer und klein-
asiatischer Teppichmuster. Es bleibt noch die Nationalität
des kennzeichnendsten Elements in der Ornamentik der poly-
chromen kfalbfayence, der Blumenmuster zu bestimmen.
Im Allgemeinen entspricht die naturgetreue Wieder-
gabe von Blumen durchaus denr iranischen Geschmacke;
so sehr, daß das
als ein Paupt-
unterschied zwischen
der persischen und
der arabischen
Kunstrichtung
gelten kann. Aber
gerade die typischen
Formen dieser
Flora,die Tulpe,
die Nelke und
auch die pya-
cinthe, wird
man in sicheren
persischen Arbeiten
dieser Zeit verge-
bens suchen; an-
dere Formen, wie
die Rosen, finden
in Persien eine
wesentlich andere,
viel naturalisti-
schere Wiedergabe.
Die Brokate und
Sammtwebereien
des f6. Jahrhun-
derts , in deren
Dessins ebenfalls
die Tulpen, Nelken
u. f. w. eine herr-
schende Rolle spie-
len, sind nicht als
persisch nachzu-
weisen, sie müssen
imGegentheil nach
Analogie der Flie-
sen als osmanisch betrachtet werden. Dagegen finden sich diese
Blumen in derselben Stilisirung wie auf den Fliesen und
Geschirren vom (6. Jahrhundert an häufig auf den türki-
schen Kunstteppichen wie in den Bordüren der älteren ana-
tolischen Gebetteppiche, in letzteren allerdings in ver-
knöcherter, aber noch deutlich erkennbarer Form. Man
wird daher nicht umhin können, die Blumenmuster in der
Stilisirung der palbfayencen als eine Bereicherung des
islamitischen Grnamentenschatzes anzuerkennen, die den Ms-
manen zu verdanken ist und welche in Persien nur sehr
Abb. s.
Ejalbfaycncc von Damaskus.
Blauer Grund; Grnamcnt weiß und türkisblau (hell-blaugrun)
Durchmesser (5 .cm.
British Museum in London.
X
X