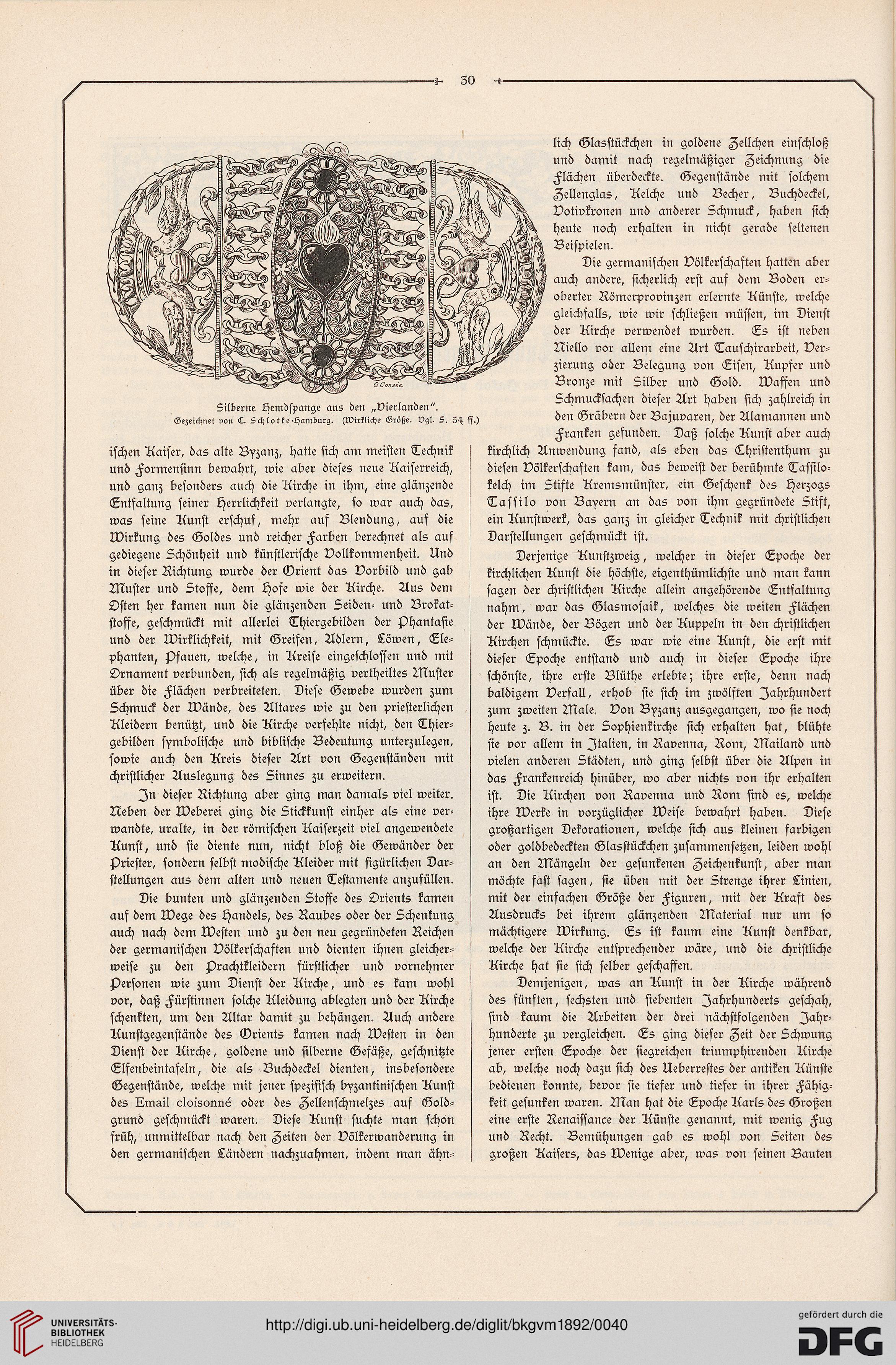Silberne ffemdspange ans den „vierlandeu".
Gezeichnet von <L Schlotke-kamburg. (wirkliche Größe, vgl. S. ZH ff.)
ifchen Aaifer, das alte Byzanz, hatte sich am meisten Technik
und Formensinn bewahrt, wie aber dieses neue Kaiserreich,
und ganz besonders auch die Airche in ihm, eine glänzende
Entfaltung seiner Herrlichkeit verlangte, so war auch das,
was seine Aunst erschus, mehr auf Blendung, auf die
Wirkung des Goldes und reicher Farben berechnet als auf
gediegene Schönheit und künstlerische Vollkommenheit. Und
in dieser Richtung wurde der Grient das Vorbild und gab
Wüster und Stoffe, den: Hofe wie der Airche. Aus den:
Osten her kamen nun die glänzenden Seiden- und Brokat-
stoffe, geschmückt mit allerlei Thiergebilden der Phantasie
und der Wirklichkeit, mit Greifen, Adlern, Löwen, Ele-
phanten, Pfauen, welche, in Areise eingeschlossen und mit
Ornament verbunden, sich als regelmäßig vertheiltes Wüster
über die Flächen verbreiteten. Diese Gewebe wurden zuni
Schmuck der Wände, des Altares wie zu den priesterlichen
Aleidern benützt, und die Airche verfehlte nicht, den Thier-
gebilden symbolische und biblische Bedeutung unterzulegen,
sowie auch den Areis dieser Art von Gegenständen mit
christlicher Auslegung des Sinnes zu erweitern.
In dieser Richtung aber ging man damals viel weiter.
Neben der Weberei ging die Stickkunst einher als eine ver-
wandte, uralte, in der römischen Aaiserzeit viel angewendete
Aunst, und sie diente nun, nicht bloß die Gewänder der
Priester, sondern selbst modische Aleider mit figürlichen Dar-
stellungen aus dem alten und neuen Testamente anzufüllen.
Die bunten und glänzenden Stoffe des Orients kamen
auf dem Wege des Handels, des Raubes oder der Schenkung
auch nach dem Westen und zu den neu gegründeten Reichen
der germanischen Völkerschaften und dienten ihnen gleicher-
weise zu den Prachtkleidern fürstlicher und vornehmer
Personen wie zum Dienst der Airche, und es kam wohl
vor, daß Fürstinnen solche Aleidung ablegten und der Airche
schenkten, um den Altar damit zu behängen. Auch andere
Aunstgegenstände des Grients kamen nach Westen in den
Dienst der Airche, goldene und silberne Gefäße, geschnitzte
Elfenbeintafeln, die als Buchdeckel dienten, insbesondere
Gegenstände, welche mit jener spezifisch byzantinischen Aunst
des Amail cloisonne oder des Zellenschmelzes auf Gold-
grund geschmückt waren. Diese Aunst suchte man schon
früh, unmittelbar nach den Zeiten der Völkerwanderung in
den germanischen Ländern nachzuahmen, indeni man ähn
lich Glasstückchen in goldene Zellchen einschloß
und damit nach regelmäßiger Zeichnung die
Flächen überdeckte. Gegenstände mit solchem
Zellenglas, Aelche und Becher, Buchdeckel,
Votivkronen und anderer Schmuck, haben sich
heute noch erhalten in nicht gerade seltenen
Beispielen.
Die germanischen Völkerschaften hatten aber
auch andere, sicherlich erst auf dem Boden er-
oberter Römerprovinzen erlernte Aünste, welche
gleichfalls, wie wir schließen müssen, im Dienst
der Airche verwendet wurden. <£s ist neben
Niello vor allem eine Art Tauschirarbeit, Ver-
zierung oder Belegung von Eisen, Aupfer und
Bronze mit Silber und Gold. Waffen und
Schinucksachen dieser Art haben sich zahlreich in
den Gräbern der Bajuvaren, der Alaniannen und
Franken gefunden. Daß solche Aunst aber auch
kirchlich Anwendung fand, als eben das Lhristenthum zu
diesen Völkerschaften kam, das beweist der berühmte Taffilo-
kelch im Stifte Aremsmünster, ein Geschenk des Herzogs
Tassilo von Bayern an das von ihm gegründete Stift,
ein Aunstwerk, das ganz in gleicher Technik mit christlichen
Darstellungen geschmückt ist.
Derjenige Aunstzweig, welcher in dieser Epoche der
kirchlichen Aunst die höchste, eigenthümlichste und man kann
sagen der christlichen Airche allein angehörende Entfaltung
nahm , war das Glasmosaik, welches die weiten Flächen
der Wände, der Bögen und der Auppeln in den christlichen
Airchen schmückte. Es war wie eine Aunst, die erst mit
dieser Epoche entstand und auch in dieser Epoche ihre
schönste, ihre erste Blüthe erlebte; ihre erste, denn nach
baldigem Verfall, erhob sie sich im zwölften Jahrhundert
zuni zweiten Wale. Von Byzanz ausgegangen, wo sie noch
heute z. B. in der Sophienkirche sich erhalten hat, blühte
sie vor allem in Italien, in Ravenna, Rom, Wailand und
vielen anderen Städten, und ging selbst über die Alpen in
das Frankenreich hinüber, wo aber nichts von ihr erhalten
ist. Die Airchen von Ravenna und Rom sind es, welche
ihre Werke in vorzüglicher Weife bewahrt haben. Diese
großartigen Dekorationen, welche sich aus kleinen farbigen
oder goldbedeckten Glasstückchen zusammensetzen, leiden wohl
an den Wängeln der gesunkenen Zeichenkunst, aber man
möchte fast sagen, sie üben mit der Strenge ihrer Linien,
mit der einfachen Größe der Figuren, mit der Araft des
Ausdrucks bei ihrem glänzenden Waterial nur um so
mächtigere Wirkung. Es ist kaum eine Aunst denkbar,
welche der Airche entsprechender wäre, und die christliche
Airche hat sie sich selber geschaffen.
Demjenigen, was an Aunst in der Airche während
des fünften, sechsten und siebenten Jahrhunderts geschah,
sind kaum die Arbeiten der drei nächstfolgenden Jahr-
hunderte zu vergleichen. Es ging dieser Zeit der Schwung
jener ersten Epoche der siegreichen triumphirenden Airche
ab, welche noch dazu sich des Aeberrestes der antiken Aünste
bedienen konnte, bevor sie tiefer und tiefer in ihrer Fähig-
keit gesunken waren. Wan hat die Epoche Aarls des Großen
eine erste Renaissance der Aünste genannt, mit wenig Fug
und Recht. Bemühungen gab es wohl von Seiten des
großen Aaisers, das Wenige aber, was von feinen Bauten
Gezeichnet von <L Schlotke-kamburg. (wirkliche Größe, vgl. S. ZH ff.)
ifchen Aaifer, das alte Byzanz, hatte sich am meisten Technik
und Formensinn bewahrt, wie aber dieses neue Kaiserreich,
und ganz besonders auch die Airche in ihm, eine glänzende
Entfaltung seiner Herrlichkeit verlangte, so war auch das,
was seine Aunst erschus, mehr auf Blendung, auf die
Wirkung des Goldes und reicher Farben berechnet als auf
gediegene Schönheit und künstlerische Vollkommenheit. Und
in dieser Richtung wurde der Grient das Vorbild und gab
Wüster und Stoffe, den: Hofe wie der Airche. Aus den:
Osten her kamen nun die glänzenden Seiden- und Brokat-
stoffe, geschmückt mit allerlei Thiergebilden der Phantasie
und der Wirklichkeit, mit Greifen, Adlern, Löwen, Ele-
phanten, Pfauen, welche, in Areise eingeschlossen und mit
Ornament verbunden, sich als regelmäßig vertheiltes Wüster
über die Flächen verbreiteten. Diese Gewebe wurden zuni
Schmuck der Wände, des Altares wie zu den priesterlichen
Aleidern benützt, und die Airche verfehlte nicht, den Thier-
gebilden symbolische und biblische Bedeutung unterzulegen,
sowie auch den Areis dieser Art von Gegenständen mit
christlicher Auslegung des Sinnes zu erweitern.
In dieser Richtung aber ging man damals viel weiter.
Neben der Weberei ging die Stickkunst einher als eine ver-
wandte, uralte, in der römischen Aaiserzeit viel angewendete
Aunst, und sie diente nun, nicht bloß die Gewänder der
Priester, sondern selbst modische Aleider mit figürlichen Dar-
stellungen aus dem alten und neuen Testamente anzufüllen.
Die bunten und glänzenden Stoffe des Orients kamen
auf dem Wege des Handels, des Raubes oder der Schenkung
auch nach dem Westen und zu den neu gegründeten Reichen
der germanischen Völkerschaften und dienten ihnen gleicher-
weise zu den Prachtkleidern fürstlicher und vornehmer
Personen wie zum Dienst der Airche, und es kam wohl
vor, daß Fürstinnen solche Aleidung ablegten und der Airche
schenkten, um den Altar damit zu behängen. Auch andere
Aunstgegenstände des Grients kamen nach Westen in den
Dienst der Airche, goldene und silberne Gefäße, geschnitzte
Elfenbeintafeln, die als Buchdeckel dienten, insbesondere
Gegenstände, welche mit jener spezifisch byzantinischen Aunst
des Amail cloisonne oder des Zellenschmelzes auf Gold-
grund geschmückt waren. Diese Aunst suchte man schon
früh, unmittelbar nach den Zeiten der Völkerwanderung in
den germanischen Ländern nachzuahmen, indeni man ähn
lich Glasstückchen in goldene Zellchen einschloß
und damit nach regelmäßiger Zeichnung die
Flächen überdeckte. Gegenstände mit solchem
Zellenglas, Aelche und Becher, Buchdeckel,
Votivkronen und anderer Schmuck, haben sich
heute noch erhalten in nicht gerade seltenen
Beispielen.
Die germanischen Völkerschaften hatten aber
auch andere, sicherlich erst auf dem Boden er-
oberter Römerprovinzen erlernte Aünste, welche
gleichfalls, wie wir schließen müssen, im Dienst
der Airche verwendet wurden. <£s ist neben
Niello vor allem eine Art Tauschirarbeit, Ver-
zierung oder Belegung von Eisen, Aupfer und
Bronze mit Silber und Gold. Waffen und
Schinucksachen dieser Art haben sich zahlreich in
den Gräbern der Bajuvaren, der Alaniannen und
Franken gefunden. Daß solche Aunst aber auch
kirchlich Anwendung fand, als eben das Lhristenthum zu
diesen Völkerschaften kam, das beweist der berühmte Taffilo-
kelch im Stifte Aremsmünster, ein Geschenk des Herzogs
Tassilo von Bayern an das von ihm gegründete Stift,
ein Aunstwerk, das ganz in gleicher Technik mit christlichen
Darstellungen geschmückt ist.
Derjenige Aunstzweig, welcher in dieser Epoche der
kirchlichen Aunst die höchste, eigenthümlichste und man kann
sagen der christlichen Airche allein angehörende Entfaltung
nahm , war das Glasmosaik, welches die weiten Flächen
der Wände, der Bögen und der Auppeln in den christlichen
Airchen schmückte. Es war wie eine Aunst, die erst mit
dieser Epoche entstand und auch in dieser Epoche ihre
schönste, ihre erste Blüthe erlebte; ihre erste, denn nach
baldigem Verfall, erhob sie sich im zwölften Jahrhundert
zuni zweiten Wale. Von Byzanz ausgegangen, wo sie noch
heute z. B. in der Sophienkirche sich erhalten hat, blühte
sie vor allem in Italien, in Ravenna, Rom, Wailand und
vielen anderen Städten, und ging selbst über die Alpen in
das Frankenreich hinüber, wo aber nichts von ihr erhalten
ist. Die Airchen von Ravenna und Rom sind es, welche
ihre Werke in vorzüglicher Weife bewahrt haben. Diese
großartigen Dekorationen, welche sich aus kleinen farbigen
oder goldbedeckten Glasstückchen zusammensetzen, leiden wohl
an den Wängeln der gesunkenen Zeichenkunst, aber man
möchte fast sagen, sie üben mit der Strenge ihrer Linien,
mit der einfachen Größe der Figuren, mit der Araft des
Ausdrucks bei ihrem glänzenden Waterial nur um so
mächtigere Wirkung. Es ist kaum eine Aunst denkbar,
welche der Airche entsprechender wäre, und die christliche
Airche hat sie sich selber geschaffen.
Demjenigen, was an Aunst in der Airche während
des fünften, sechsten und siebenten Jahrhunderts geschah,
sind kaum die Arbeiten der drei nächstfolgenden Jahr-
hunderte zu vergleichen. Es ging dieser Zeit der Schwung
jener ersten Epoche der siegreichen triumphirenden Airche
ab, welche noch dazu sich des Aeberrestes der antiken Aünste
bedienen konnte, bevor sie tiefer und tiefer in ihrer Fähig-
keit gesunken waren. Wan hat die Epoche Aarls des Großen
eine erste Renaissance der Aünste genannt, mit wenig Fug
und Recht. Bemühungen gab es wohl von Seiten des
großen Aaisers, das Wenige aber, was von feinen Bauten