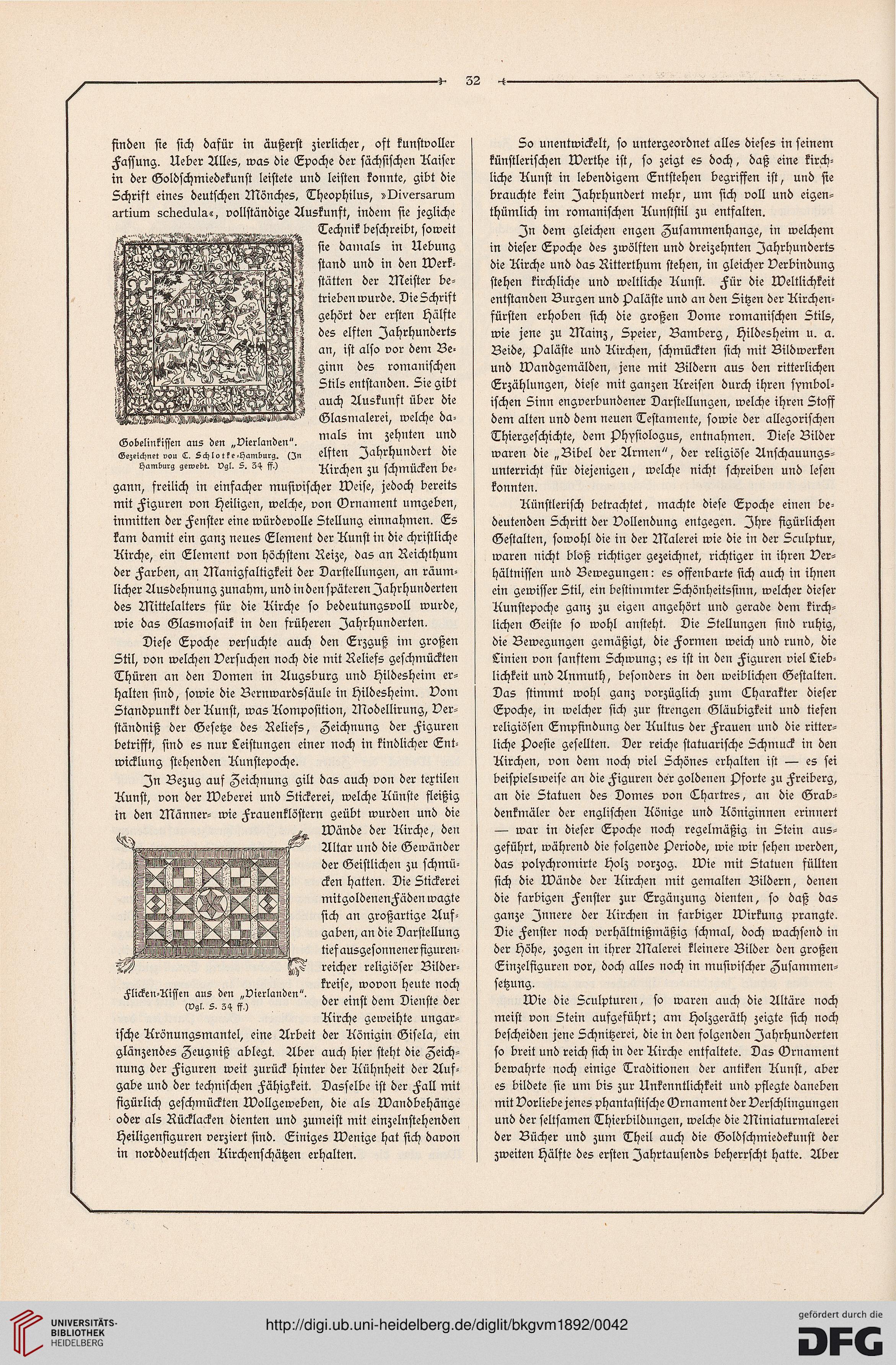■3- 32 -4
finden sie sich dafür in äußerst zierlicher, oft kunstvoller
Fassung. Ueber Alles, was die Epoche der sächsischen Kaiser
in der Goldschrniedekunst leistete und leisten konnte, gibt die
Schrift eines deutschen Mönches, Theophilus, »Diversarum
artium schedula«, vollständige Auskunft, indem sie jegliche
Technik beschreib!, soweit
sie damals in Hebung
stand und in den Werk-
stätten der Meister be-
triebenwurde. Die Schrift
gehört der ersten Hälfte
des elften Jahrhunderts
an, ist also vor den: Be-
ginn des romanischen
Stils entstanden. Sie gibt
auch Auskunft über die
Glasmalerei, welche da-
mals im zehnten und
elften Jahrhundert die
Kirchen zu schmücken be-
Gobelinkissen aus den „vierlandeil".
Gezeichnet von <Z. Schlotke -Hamburg. ßn
Hamburg gewebt, vgl. S. 3^ ff.)
gann, freilich in einfacher musivischer Weise, jedoch bereits
mit Figuren von heiligen, welche, von Ornament umgeben,
inmitten der Fenster eine würdevolle Stellung einnahmen. Es
kam damit ein ganz neues Element der Kunst in die christliche
Kirche, ein Element von höchstem Reize, das an Reichthum
der Farben, an Manigfaltigkeit der Darstellungen, an räum-
licher Ausdehnung zunahm, und in den späteren Jahrhunderten
des Mittelalters für die Kirche so bedeutungsvoll wurde,
wie das Glasmosaik in den früheren Jahrhunderten.
Diese Epoche versuchte auch den Erzguß im großen
Stil, von welchen Versuchen noch die mit Reliefs geschmückten
Thüren an den Domen in Augsburg und Hildesheim er-
halten sind, sowie die Bernwardssäule in Hildesheim. Vom
Standpunkt der Aunst, was Aomposition, Modellirung, Ver-
ständniß der Gesetze des Reliefs, Zeichnung der Figuren
betrifft, sind es nur Leistungen einer noch in kindlicher Ent-
wicklung stehenden Aunstepoche.
Zn Bezug auf Zeichnung gilt das auch von der textilen
Aunst, von der Weberei und Stickerei, welche Aünste fleißig
in den Männer- wie Frauenklöstern geübt wurden und die
Wände der Airche, den
Altar und die Gewänder
der Geistlichen zu schmü-
cken hatten. Die Stickerei
mitgoldenenFäden wagte
sich an großartige Auf-
gaben, an die Darstellung
tief ausgesonnener figuren-
reicher religiöser Bilder-
kreise, wovon heute noch
der einst dein Dienste der
Airche geweihte ungar-
ische Arönungsmantel, eine Arbeit der Königin Gisela, ein
glänzendes Zeugniß ablegt. Aber auch hier steht die Zeich-
nung der Figuren weit zurück hinter der Kühnheit der Auf-
gabe und der technischen Fähigkeit. Dasselbe ist der Fall mit
figürlich geschmückten Wollgeweben, die als Wandbehänge
oder als Rücklacken dienten und zumeist mit einzelnstehenden
Heiligenfiguren verziert sind. Einiges Wenige hat sich davon
in norddeutschen Airchenschätzen erhalten.
Flicken-Rissen aus den „vierlanden",
lvgi. s. 3<* ff.)
So unentwickelt, so untergeordnet alles dieses in seinem
künstlerischen Werthe ist, so zeigt es doch, daß eine kirch-
liche Kunst in lebendigem Entstehen begriffen ist, und sie
brauchte kein Jahrhundert mehr, um sich voll und eigen-
thümlich im romanischen Aunststil zu entfalten.
Zn dem gleichen engen Zusammenhänge, in welchem
in dieser Epoche des zwölften und dreizehnten Zahrhunderts
die Airche und das Ritterthum stehen, in gleicher Verbindung
stehen kirchliche und weltliche Aunst. Für die Weltlichkeit
entstanden Burgen und Paläste und an den Sitzen der Airchen-
fürsten erhoben sich die großen Dome romanischen Stils,
wie jene zu Mainz, Speier, Bamberg, Hildesheim u. a.
Beide, Paläste und Kirchen, schmückten sich mit Bildwerken
und Wandgemälden, jene mit Bildern aus den ritterlichen
Erzählungen, diese mit ganzen Kreisen durch ihren symbol-
ischen Sinn engverbundener Darstellungen, welche ihren Stoff
dem alten und den: neuen Testamente, sowie der allegorischen
Thiergeschichte, dem physiologus, entnahmen. Diese Bilder
waren die „Bibel der Armen", der religiöse Anschauungs-
unterricht für diejenigen, welche nicht schreiben und lesen
konnten.
Künstlerisch betrachtet, machte diese Epoche einen be-
deutenden Schritt der Vollendung entgegen. Zhre figürlichen
Gestalten, sowohl die in der Malerei wie die in der Seulptur,
waren nicht bloß richtiger gezeichnet, richtiger in ihren Ver-
hältnissen und Bewegungen: es offenbarte sich auch in ihnen
ein gewisser Stil, ein bestintmter Schönheitssinn, welcher dieser
Kunstepoche ganz zu eigen angehört und gerade dem kirch-
lichen Geiste so wohl ansteht. Die Stellungen sind ruhig,
die Bewegungen gemäßigt, die Formen weich und rund, die
Linien von sanftem Schwung; es ist in den Figuren viel Lieb-
lichkeit und Anmuth, besonders in den weiblichen Gestalten.
Das stimmt wohl ganz vorzüglich zun: Lharakter dieser
Epoche, in welcher sich zur strengen Gläubigkeit und tiefen
religiösen Empfindung der Kultus der Frauen und die ritter-
liche Poesie gesellten. Der reiche statuarische Schniuck in den
Kirchen, von dem noch viel Schönes erhalten ist — es sei
beispielsweise an die Figuren der goldenen Pforte zu Freiberg,
an die Statuen des Domes von Lhartres, an die Grab-
denkmäler der englischen Könige und Königinnen erinnert
— war in dieser Epoche noch regelmäßig in Stein aus-
geführt, während die folgende Periode, wie wir sehen werden,
das polychromirte Holz vorzog. Wie nrit Statuen füllten
sich die Wände der Kirchen mit gemalten Bildern, denen
die farbigen Fenster zur Ergänzung dienten, so daß das
ganze Znnere der Kirchen in farbiger Wirkung prangte.
Die Fenster noch verhältnißmäßig schmal, doch wachsend in
der Höhe, zogen in ihrer Malerei kleinere Bilder den großen
Einzelfiguren vor, doch alles noch in musivischer Zusammen-
setzung.
Wie die Sculpturen, so waren auch die Altäre noch
meist von Stein aufgeführt; am Holzgeräth zeigte sich noch
bescheiden jene Schnitzerei, die in den folgenden Zahrhunderten
so breit und reich sich in der Kirche entfaltete. Das Ornament
bewahrte noch einige Traditionen der antiken Kunst, aber
es bildete sie um bis zur Unkenntlichkeit und pflegte daneben
mit Vorliebe jenes phantastische Ornament der Verschlingungen
und der seltsamen Thierbildungen, welche die Miniaturmalerei
der Bücher und zum Theil auch die Goldschmiedekunst der
zweiten Hälfte des ersten Zahrtausends beherrscht hatte. Aber
finden sie sich dafür in äußerst zierlicher, oft kunstvoller
Fassung. Ueber Alles, was die Epoche der sächsischen Kaiser
in der Goldschrniedekunst leistete und leisten konnte, gibt die
Schrift eines deutschen Mönches, Theophilus, »Diversarum
artium schedula«, vollständige Auskunft, indem sie jegliche
Technik beschreib!, soweit
sie damals in Hebung
stand und in den Werk-
stätten der Meister be-
triebenwurde. Die Schrift
gehört der ersten Hälfte
des elften Jahrhunderts
an, ist also vor den: Be-
ginn des romanischen
Stils entstanden. Sie gibt
auch Auskunft über die
Glasmalerei, welche da-
mals im zehnten und
elften Jahrhundert die
Kirchen zu schmücken be-
Gobelinkissen aus den „vierlandeil".
Gezeichnet von <Z. Schlotke -Hamburg. ßn
Hamburg gewebt, vgl. S. 3^ ff.)
gann, freilich in einfacher musivischer Weise, jedoch bereits
mit Figuren von heiligen, welche, von Ornament umgeben,
inmitten der Fenster eine würdevolle Stellung einnahmen. Es
kam damit ein ganz neues Element der Kunst in die christliche
Kirche, ein Element von höchstem Reize, das an Reichthum
der Farben, an Manigfaltigkeit der Darstellungen, an räum-
licher Ausdehnung zunahm, und in den späteren Jahrhunderten
des Mittelalters für die Kirche so bedeutungsvoll wurde,
wie das Glasmosaik in den früheren Jahrhunderten.
Diese Epoche versuchte auch den Erzguß im großen
Stil, von welchen Versuchen noch die mit Reliefs geschmückten
Thüren an den Domen in Augsburg und Hildesheim er-
halten sind, sowie die Bernwardssäule in Hildesheim. Vom
Standpunkt der Aunst, was Aomposition, Modellirung, Ver-
ständniß der Gesetze des Reliefs, Zeichnung der Figuren
betrifft, sind es nur Leistungen einer noch in kindlicher Ent-
wicklung stehenden Aunstepoche.
Zn Bezug auf Zeichnung gilt das auch von der textilen
Aunst, von der Weberei und Stickerei, welche Aünste fleißig
in den Männer- wie Frauenklöstern geübt wurden und die
Wände der Airche, den
Altar und die Gewänder
der Geistlichen zu schmü-
cken hatten. Die Stickerei
mitgoldenenFäden wagte
sich an großartige Auf-
gaben, an die Darstellung
tief ausgesonnener figuren-
reicher religiöser Bilder-
kreise, wovon heute noch
der einst dein Dienste der
Airche geweihte ungar-
ische Arönungsmantel, eine Arbeit der Königin Gisela, ein
glänzendes Zeugniß ablegt. Aber auch hier steht die Zeich-
nung der Figuren weit zurück hinter der Kühnheit der Auf-
gabe und der technischen Fähigkeit. Dasselbe ist der Fall mit
figürlich geschmückten Wollgeweben, die als Wandbehänge
oder als Rücklacken dienten und zumeist mit einzelnstehenden
Heiligenfiguren verziert sind. Einiges Wenige hat sich davon
in norddeutschen Airchenschätzen erhalten.
Flicken-Rissen aus den „vierlanden",
lvgi. s. 3<* ff.)
So unentwickelt, so untergeordnet alles dieses in seinem
künstlerischen Werthe ist, so zeigt es doch, daß eine kirch-
liche Kunst in lebendigem Entstehen begriffen ist, und sie
brauchte kein Jahrhundert mehr, um sich voll und eigen-
thümlich im romanischen Aunststil zu entfalten.
Zn dem gleichen engen Zusammenhänge, in welchem
in dieser Epoche des zwölften und dreizehnten Zahrhunderts
die Airche und das Ritterthum stehen, in gleicher Verbindung
stehen kirchliche und weltliche Aunst. Für die Weltlichkeit
entstanden Burgen und Paläste und an den Sitzen der Airchen-
fürsten erhoben sich die großen Dome romanischen Stils,
wie jene zu Mainz, Speier, Bamberg, Hildesheim u. a.
Beide, Paläste und Kirchen, schmückten sich mit Bildwerken
und Wandgemälden, jene mit Bildern aus den ritterlichen
Erzählungen, diese mit ganzen Kreisen durch ihren symbol-
ischen Sinn engverbundener Darstellungen, welche ihren Stoff
dem alten und den: neuen Testamente, sowie der allegorischen
Thiergeschichte, dem physiologus, entnahmen. Diese Bilder
waren die „Bibel der Armen", der religiöse Anschauungs-
unterricht für diejenigen, welche nicht schreiben und lesen
konnten.
Künstlerisch betrachtet, machte diese Epoche einen be-
deutenden Schritt der Vollendung entgegen. Zhre figürlichen
Gestalten, sowohl die in der Malerei wie die in der Seulptur,
waren nicht bloß richtiger gezeichnet, richtiger in ihren Ver-
hältnissen und Bewegungen: es offenbarte sich auch in ihnen
ein gewisser Stil, ein bestintmter Schönheitssinn, welcher dieser
Kunstepoche ganz zu eigen angehört und gerade dem kirch-
lichen Geiste so wohl ansteht. Die Stellungen sind ruhig,
die Bewegungen gemäßigt, die Formen weich und rund, die
Linien von sanftem Schwung; es ist in den Figuren viel Lieb-
lichkeit und Anmuth, besonders in den weiblichen Gestalten.
Das stimmt wohl ganz vorzüglich zun: Lharakter dieser
Epoche, in welcher sich zur strengen Gläubigkeit und tiefen
religiösen Empfindung der Kultus der Frauen und die ritter-
liche Poesie gesellten. Der reiche statuarische Schniuck in den
Kirchen, von dem noch viel Schönes erhalten ist — es sei
beispielsweise an die Figuren der goldenen Pforte zu Freiberg,
an die Statuen des Domes von Lhartres, an die Grab-
denkmäler der englischen Könige und Königinnen erinnert
— war in dieser Epoche noch regelmäßig in Stein aus-
geführt, während die folgende Periode, wie wir sehen werden,
das polychromirte Holz vorzog. Wie nrit Statuen füllten
sich die Wände der Kirchen mit gemalten Bildern, denen
die farbigen Fenster zur Ergänzung dienten, so daß das
ganze Znnere der Kirchen in farbiger Wirkung prangte.
Die Fenster noch verhältnißmäßig schmal, doch wachsend in
der Höhe, zogen in ihrer Malerei kleinere Bilder den großen
Einzelfiguren vor, doch alles noch in musivischer Zusammen-
setzung.
Wie die Sculpturen, so waren auch die Altäre noch
meist von Stein aufgeführt; am Holzgeräth zeigte sich noch
bescheiden jene Schnitzerei, die in den folgenden Zahrhunderten
so breit und reich sich in der Kirche entfaltete. Das Ornament
bewahrte noch einige Traditionen der antiken Kunst, aber
es bildete sie um bis zur Unkenntlichkeit und pflegte daneben
mit Vorliebe jenes phantastische Ornament der Verschlingungen
und der seltsamen Thierbildungen, welche die Miniaturmalerei
der Bücher und zum Theil auch die Goldschmiedekunst der
zweiten Hälfte des ersten Zahrtausends beherrscht hatte. Aber