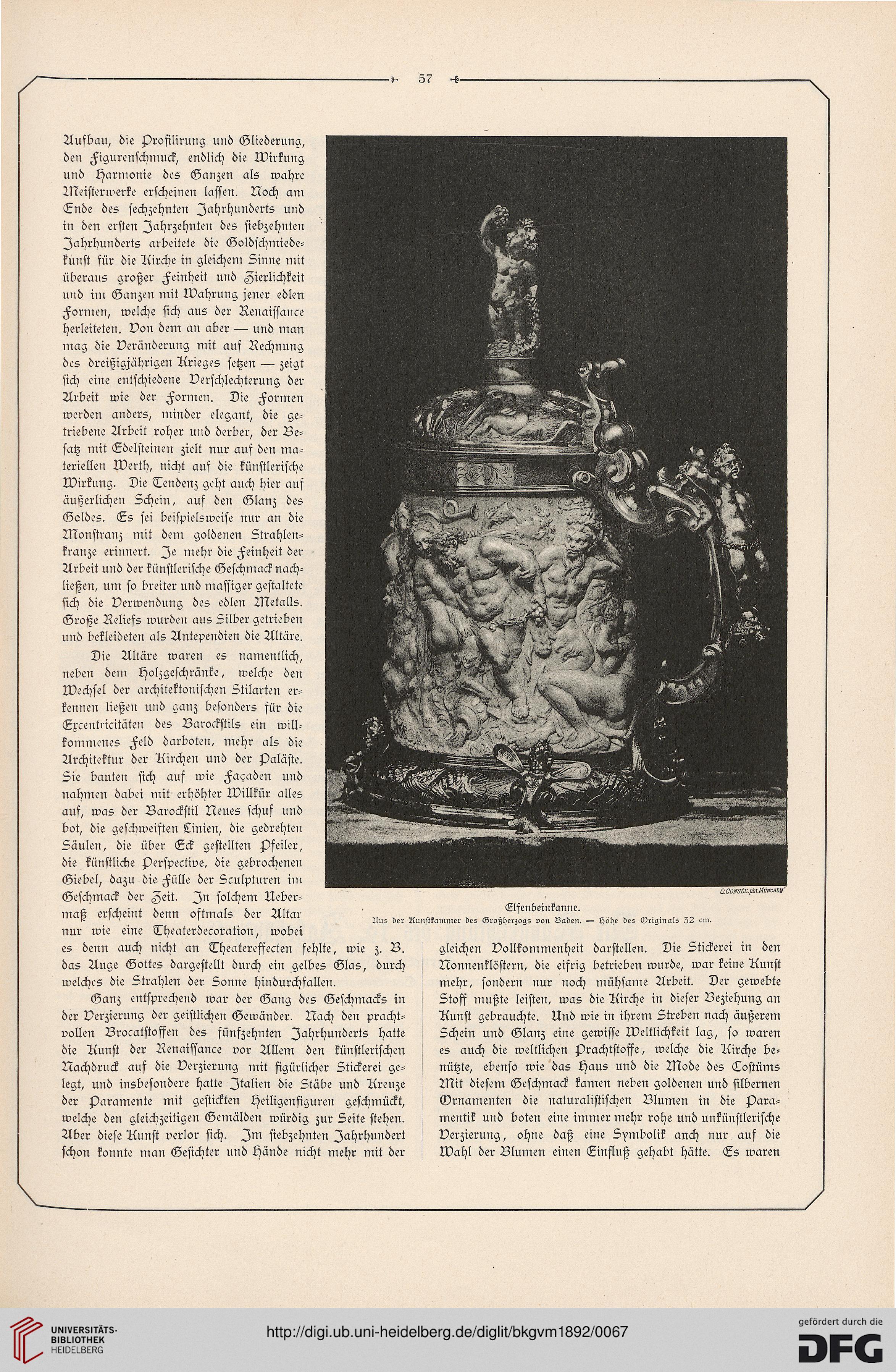57
\
Llfeiibeiiikaniie.
Aus der Aunstkammer des Großherzogs von Baden. — höhe des Originals 32 cm.
Aufbau, die Proftlirutig und Gliederung,
den Figurenschmuck, endlich die Wirkung
und Harmonie des Ganzen als wahre
Meisterwerke erscheinen lassen. Noch am
Ende des sechzehnten Jahrhunderts und
in den ersten Jahrzehnten des siebzehnten
Jahrhunderts arbeitete die Goldschmicde-
kunst für die Kirche in gleichem Sinne mit
überaus großer Feinheit und Zierlichkeit
und im Ganzen mit Wahrung jener edlen
Fornien, welche sich aus der Renaissance
herleiteten. Non den: an aber — und man
mag die Neränderung mit auf Rechnung
des dreißigjährigen Krieges setzen — zeigt
sich eine entschiedene Nerschlechterung der
Arbeit wie der Fornien. Die Formen
werden anders, minder elegant, die ge-
triebene Arbeit roher und derber, der Be-
satz mit Edelsteinen zielt nur auf den ma-
teriellen Werth, nicht aus die künstlerische
Wirkung. Die Tendenz geht auch hier auf
äußerlichen Schein, auf den Glanz des
Goldes. Es sei beispielsweise nur an die
Monstranz mit den: goldenen Strahlen-
kränze erinnert. Je mehr die Feinheit der
Arbeit und der künstlerische Geschnrack nach-
ließen, um so breiter und massiger gestaltete
sich die Verwendung des edlen Metalls.
Große Reliefs wurden aus Silber getrieben
und bekleideten als Antependien die Altäre.
Die Altäre waren es namentlich,
neben dem polzgeschränke, welche den
Wechsel der architektonischen Stilarten er-
kennen ließen und ganz besonders für die
Excentricitäten des Barockstils ein will-
kommenes Feld darboten, mehr als die
Architektur der Kirchen und der Paläste.
Sie bauten sich auf wie Facaden und
nahmen dabei mit erhöhter Willkür alles
auf, was der Barockstil Neues schuf und
bot, die geschweiften Linien, die gedrehten
Säulen, die über Eck gestellten pseiler,
die künstliche Perspective, die gebrochenen
Giebel, dazu die Fülle der Sculpturen im
Geschrnack der Zeit. Zn solchen: Ueber
maß erscheint denn oftmals der Altar
nur wie eine Theaterdecoration, wobei
es denn auch nicht an Theatereffecten fehlte, wie z. B.
das Auge Gottes üargestellt durch ein gelbes Glas, durch
welches die Strahlen der Sonne hindurchfallen.
Ganz entsprechend war der Gang des Geschmacks in
der Verzierung der geistlichen Gewänder. Nach den pracht-
vollen Brocatstoffen des fünfzehnten Jahrhunderts hatte
die Kunst der Renaissance vor Allem den künstlerischen
Nachdruck auf die Verzierung mit figürlicher Stickerei ge-
legt, und insbesondere hatte Italien die Stäbe und Kreuze
der paramente mit gestickten Heiligenfiguren geschmückt,
welche den gleichzeitigen Gemälden würdig zur Seite stehen.
Aber diese Kunst verlor sich. Im siebzehnten Jahrhundert
schon konnte man Gesichter und pände nicht mehr mit der
gleichen Vollkommenheit darstellen. Die Stickerei in den
Nonnenklöstern, die eifrig betrieben wurde, war keine Kunst
nrehr, sondern nur noch mühsame Arbeit. Der gewebte
Stoff mußte leisten, was die Kirche in dieser Beziehung an
Kunst gebrauchte. Und wie in ihrem Streben nach äußerem
Schein und Glanz eine gewisse Weltlichkeit lag, so waren
es auch die weltlichen prachtstoffe, welche die Kirche be-
nützte, ebenso wie das paus und die Mode des Tostüms
Mit diesem Geschrnack kanren neben goldenen und silbernen
Vrnamentcn die naturalistischen Blumen in die para-
mentik und boten eine immer mehr rohe und unkünstlerische
Verzierung, ohne daß eine Symbolik anch nur aus die
Wahl der Blunren einen Einfluß gehabt hätte. Es waren
/