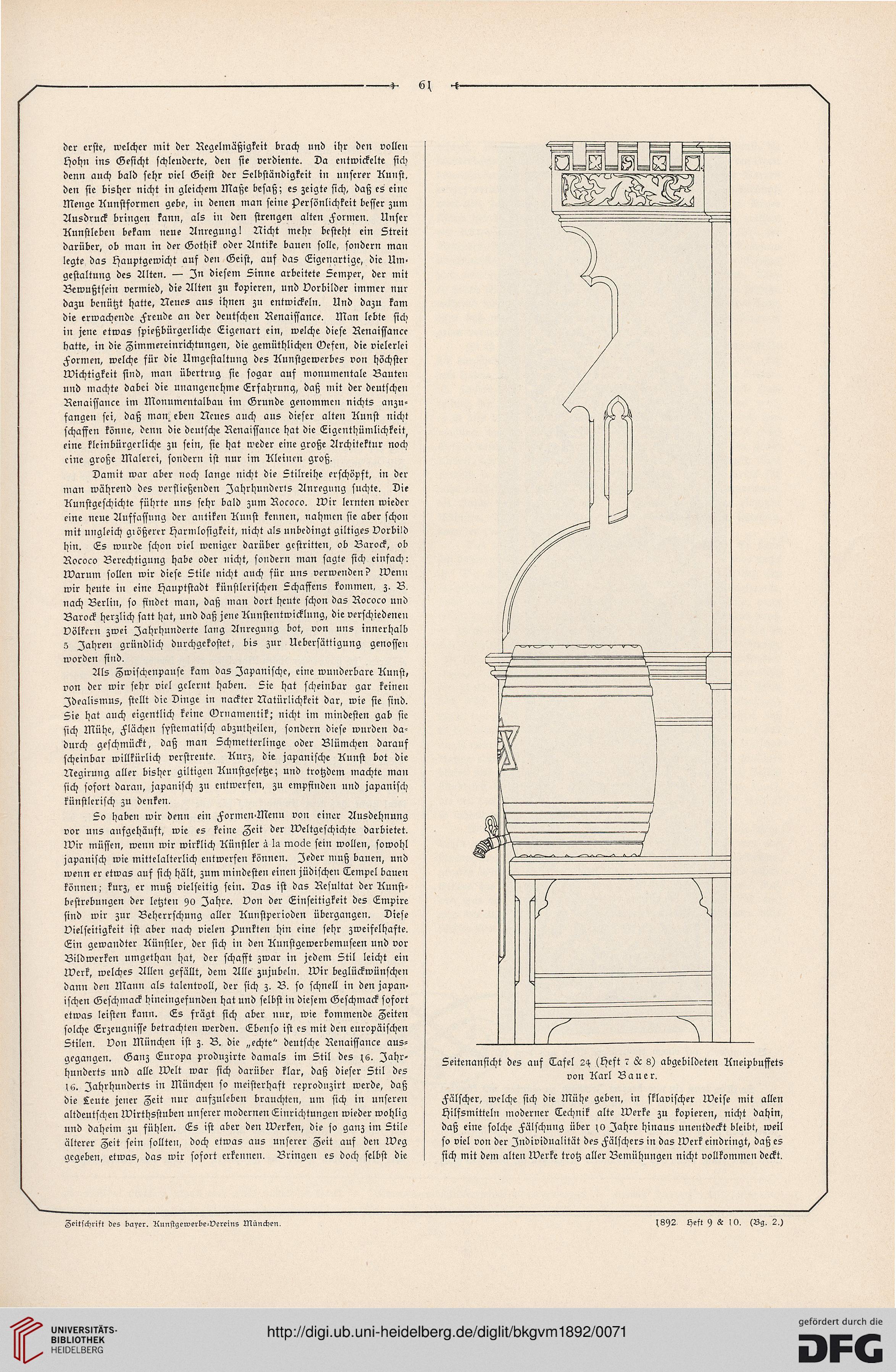der erste, welcher mit der Regelmäßigkeit brach und ihr de» vollen
lhohn ins Gesicht schleuderte, den sie verdiente. Da entwickelte sich
denn auch bald sehr viel Geist der Selbständigkeit in unserer Kunst,
den sie bisher nicht in gleichem Maße besaß; cs zeigte sich, daß cs eine
Menge Kunstformcn gebe, in denen man seine Persönlichkeit besser znm
Ausdruck bringen kann, als in den strengen alten Formen. Unser
Kunstleben bekam neue Anregung! Nicht mehr besteht ein Streit
darüber, ob man in der Gothik oder Antike bauen solle, sondern inan
legte das lfauptgewicht auf den Geist, auf das Eigenartige, die Um-
gestaltung des Alten. — In diesem Sinne arbeitete Semper, der mit
Bewußtsein verinied, die Alten zn kopieren, und Vorbilder immer nur
dazu benützt hatte, Neues aus ihnen zn entwickeln. Und dazu kam
die erwachende Freude an der deutschen Renaissance. Man lebte sich
in jene etwas spießbürgerliche Eigenart ein, welche diese Renaissance
hatte, in die Zimmereinrichtungen, die gemüthlichen Gefen, die vielerlei
Formen, welche für die Umgestaltung des Kunstgewerbcs von höchster
Wichtigkeit sind, man übertrug sic sogar aus monumentale Bauten
und machte dabei die unangenehme Erfahrung, daß mit der deutschen
Renaissance im Monumentalbau im Grunde genommen nichts anzu-
fangen sei, daß man, eben Neues auch aus dieser alten Kunst nicht
schaffen könne, denn die deutsche Renaissance hat die Ligenthümlichkeit,
eine kleinbürgerliche zu sein, sic hat weder eine große Architektur noch
eine große Malerei, sondern ist nur im Kleinen groß.
Damit war aber noch lange nicht die Stilreihe erschöpft, in der
man während des verfließenden Jahrhunderts Anregung suchte. Die
Kunstgeschichte führte uns sehr bald zum Rococo. wir lernten wieder
eine neue Auffassung der antiken Kunst kennen, nahmen sie aber schon
mit ungleich größerer Harmlosigkeit, nicht als unbedingt gütiges Vorbild
hin. Es wurde schon viel weniger darüber gestritten, ob Barock, ob
Rococo Berechtigung habe oder reicht, sondern man sagte sich einfach:
warum sollen wir diese Stile nicht auch für uns verwenden? wenn
wir heute in eine Hauptstadt künstlerischen Schaffens kommen, z. B.
nach Berlin, so findet man, daß man dort heute schon das Rococo und
Barock herzlich satt hat, und daß jene Kunstentwicklnng, die verschiedenen
Völkern zwei Jahrhunderte lang Anregung bot, von »ns innerhalb
5 Jahren gründlich durchgekostet, bis zur Ucbersättigung genosscr,
worden sirid.
Als Zwischenpause kam das Japanische, eine wunderbare Kunst,
von der wir sehr viel gelernt haben. Sie hat scheinbar gar keinen
Idealismus, stellt die Dinge in nackter Natürlichkeit dar, wie sie sind.
Sie hat auch eigentlich keine Drnamentik; nicht im mindesten gab sie
sich Mühe, Flächen systematisch abzutheilen, sondern diese wurden da-
durch geschmückt, daß man Schmetterlinge oder Blümchen darauf
scheinbar willkürlich verstreute. Kurz, die japanische Kunst bot die
Negirung aller bisher gütigen Kunstgesetze; und trotzdem machte man
sich sofort daran, japanisch zn entwerfen, zn empfinden und japanisch
künstlerisch zu denken.
So haben wir denn ein Formen-Menu von einer Ausdehnung
vor uns ansgehäuft, wie es keine Zeit der Weltgeschichte darbictet.
wir müssen, wenn wir wirklich Künstler a la mocle sein wollen, sowohl
japanisch wie mittelalterlich entwerfen können. Jeder muß bauen, und
wenn er etwas auf sich hält, zum mindesten einen jüdischen Tempel bauen
können; kurz, er muß vielseitig sein. Das ist das Resultat der Kunst-
bestrebungen der letzten 90 Jahre, von der Einseitigkeit des Empire
sind wir zur Beherrschung aller Kunstperioden übergangen. Diese
Vielseitigkeit ist aber nach vielen Punkten hin eine sehr zweifelhafte.
Ein gewandter Künstler, der sich in den Kunstgewerbemuseen und vor
Bildwerken umgethan hat, der schafft zwar in jedem Stil leicht ein
Werk, welches Allen gefällt, dem Alle znjubeln. wir beglückwünschen
dann den Mann als talentvoll, der sich z. B. so schnell in den japan-
ischen Geschmack hineingefunden hat und selbst in diesem Geschmack sofort
etwas leisten kann. Es frägt sich aber nur, wie kommende Zeiten
solche Erzeugnisse betrachten werden. Ebenso ist es mit den europäischen
Stilen, von München ist z. B. die „echte"' deutsche Renaissance aus-
gegangen. Ganz Europa produzirtc damals im Stil des \6. Jahr-
hunderts und alle Welt war sich darüber klar, daß dieser Stil des
t6. Jahrhunderts in München so meisterhaft reprodnzirt werde, daß
die Leute jener Zeit nur aufzuleben brauchten, um sich in unseren
altdeutschen wirthsstuben unserer modernen Einrichtungen wieder wohlig
und daheim zu fühlen. Es ist aber den Werken, die jo ganz im Stile
älterer Zeit fein sollten, doch etwas aus unserer Zeit auf den weg
gegeben, etwas, das wir sofort erkennen. Bringen es doch selbst die
Seitenansicht des auf Tafel 24 7 Sc 8) abgebildeten Kneixbuffetr
von Karl Bauer.
Fälscher, welche sich die Mühe geben, in sklavischer weise mit allen
Hilfsmitteln moderner Technik alte werke zu kopieren, nicht dahin,
daß eine solche Fälschung über ;c> Jahre hinaus unentdeckt bleibt, weil
so viel von der Individualität des Fälschers in das werk eindringt, daß es
sich mit der» alten werke trotz aller Bemühungen nicht vollkommen deckt.
V
Zeitschrift des bayer. Aunstgewerbe-Vereins München.
J892 Heft 9 & 10. (Bg. 2.)
lhohn ins Gesicht schleuderte, den sie verdiente. Da entwickelte sich
denn auch bald sehr viel Geist der Selbständigkeit in unserer Kunst,
den sie bisher nicht in gleichem Maße besaß; cs zeigte sich, daß cs eine
Menge Kunstformcn gebe, in denen man seine Persönlichkeit besser znm
Ausdruck bringen kann, als in den strengen alten Formen. Unser
Kunstleben bekam neue Anregung! Nicht mehr besteht ein Streit
darüber, ob man in der Gothik oder Antike bauen solle, sondern inan
legte das lfauptgewicht auf den Geist, auf das Eigenartige, die Um-
gestaltung des Alten. — In diesem Sinne arbeitete Semper, der mit
Bewußtsein verinied, die Alten zn kopieren, und Vorbilder immer nur
dazu benützt hatte, Neues aus ihnen zn entwickeln. Und dazu kam
die erwachende Freude an der deutschen Renaissance. Man lebte sich
in jene etwas spießbürgerliche Eigenart ein, welche diese Renaissance
hatte, in die Zimmereinrichtungen, die gemüthlichen Gefen, die vielerlei
Formen, welche für die Umgestaltung des Kunstgewerbcs von höchster
Wichtigkeit sind, man übertrug sic sogar aus monumentale Bauten
und machte dabei die unangenehme Erfahrung, daß mit der deutschen
Renaissance im Monumentalbau im Grunde genommen nichts anzu-
fangen sei, daß man, eben Neues auch aus dieser alten Kunst nicht
schaffen könne, denn die deutsche Renaissance hat die Ligenthümlichkeit,
eine kleinbürgerliche zu sein, sic hat weder eine große Architektur noch
eine große Malerei, sondern ist nur im Kleinen groß.
Damit war aber noch lange nicht die Stilreihe erschöpft, in der
man während des verfließenden Jahrhunderts Anregung suchte. Die
Kunstgeschichte führte uns sehr bald zum Rococo. wir lernten wieder
eine neue Auffassung der antiken Kunst kennen, nahmen sie aber schon
mit ungleich größerer Harmlosigkeit, nicht als unbedingt gütiges Vorbild
hin. Es wurde schon viel weniger darüber gestritten, ob Barock, ob
Rococo Berechtigung habe oder reicht, sondern man sagte sich einfach:
warum sollen wir diese Stile nicht auch für uns verwenden? wenn
wir heute in eine Hauptstadt künstlerischen Schaffens kommen, z. B.
nach Berlin, so findet man, daß man dort heute schon das Rococo und
Barock herzlich satt hat, und daß jene Kunstentwicklnng, die verschiedenen
Völkern zwei Jahrhunderte lang Anregung bot, von »ns innerhalb
5 Jahren gründlich durchgekostet, bis zur Ucbersättigung genosscr,
worden sirid.
Als Zwischenpause kam das Japanische, eine wunderbare Kunst,
von der wir sehr viel gelernt haben. Sie hat scheinbar gar keinen
Idealismus, stellt die Dinge in nackter Natürlichkeit dar, wie sie sind.
Sie hat auch eigentlich keine Drnamentik; nicht im mindesten gab sie
sich Mühe, Flächen systematisch abzutheilen, sondern diese wurden da-
durch geschmückt, daß man Schmetterlinge oder Blümchen darauf
scheinbar willkürlich verstreute. Kurz, die japanische Kunst bot die
Negirung aller bisher gütigen Kunstgesetze; und trotzdem machte man
sich sofort daran, japanisch zn entwerfen, zn empfinden und japanisch
künstlerisch zu denken.
So haben wir denn ein Formen-Menu von einer Ausdehnung
vor uns ansgehäuft, wie es keine Zeit der Weltgeschichte darbictet.
wir müssen, wenn wir wirklich Künstler a la mocle sein wollen, sowohl
japanisch wie mittelalterlich entwerfen können. Jeder muß bauen, und
wenn er etwas auf sich hält, zum mindesten einen jüdischen Tempel bauen
können; kurz, er muß vielseitig sein. Das ist das Resultat der Kunst-
bestrebungen der letzten 90 Jahre, von der Einseitigkeit des Empire
sind wir zur Beherrschung aller Kunstperioden übergangen. Diese
Vielseitigkeit ist aber nach vielen Punkten hin eine sehr zweifelhafte.
Ein gewandter Künstler, der sich in den Kunstgewerbemuseen und vor
Bildwerken umgethan hat, der schafft zwar in jedem Stil leicht ein
Werk, welches Allen gefällt, dem Alle znjubeln. wir beglückwünschen
dann den Mann als talentvoll, der sich z. B. so schnell in den japan-
ischen Geschmack hineingefunden hat und selbst in diesem Geschmack sofort
etwas leisten kann. Es frägt sich aber nur, wie kommende Zeiten
solche Erzeugnisse betrachten werden. Ebenso ist es mit den europäischen
Stilen, von München ist z. B. die „echte"' deutsche Renaissance aus-
gegangen. Ganz Europa produzirtc damals im Stil des \6. Jahr-
hunderts und alle Welt war sich darüber klar, daß dieser Stil des
t6. Jahrhunderts in München so meisterhaft reprodnzirt werde, daß
die Leute jener Zeit nur aufzuleben brauchten, um sich in unseren
altdeutschen wirthsstuben unserer modernen Einrichtungen wieder wohlig
und daheim zu fühlen. Es ist aber den Werken, die jo ganz im Stile
älterer Zeit fein sollten, doch etwas aus unserer Zeit auf den weg
gegeben, etwas, das wir sofort erkennen. Bringen es doch selbst die
Seitenansicht des auf Tafel 24 7 Sc 8) abgebildeten Kneixbuffetr
von Karl Bauer.
Fälscher, welche sich die Mühe geben, in sklavischer weise mit allen
Hilfsmitteln moderner Technik alte werke zu kopieren, nicht dahin,
daß eine solche Fälschung über ;c> Jahre hinaus unentdeckt bleibt, weil
so viel von der Individualität des Fälschers in das werk eindringt, daß es
sich mit der» alten werke trotz aller Bemühungen nicht vollkommen deckt.
V
Zeitschrift des bayer. Aunstgewerbe-Vereins München.
J892 Heft 9 & 10. (Bg. 2.)