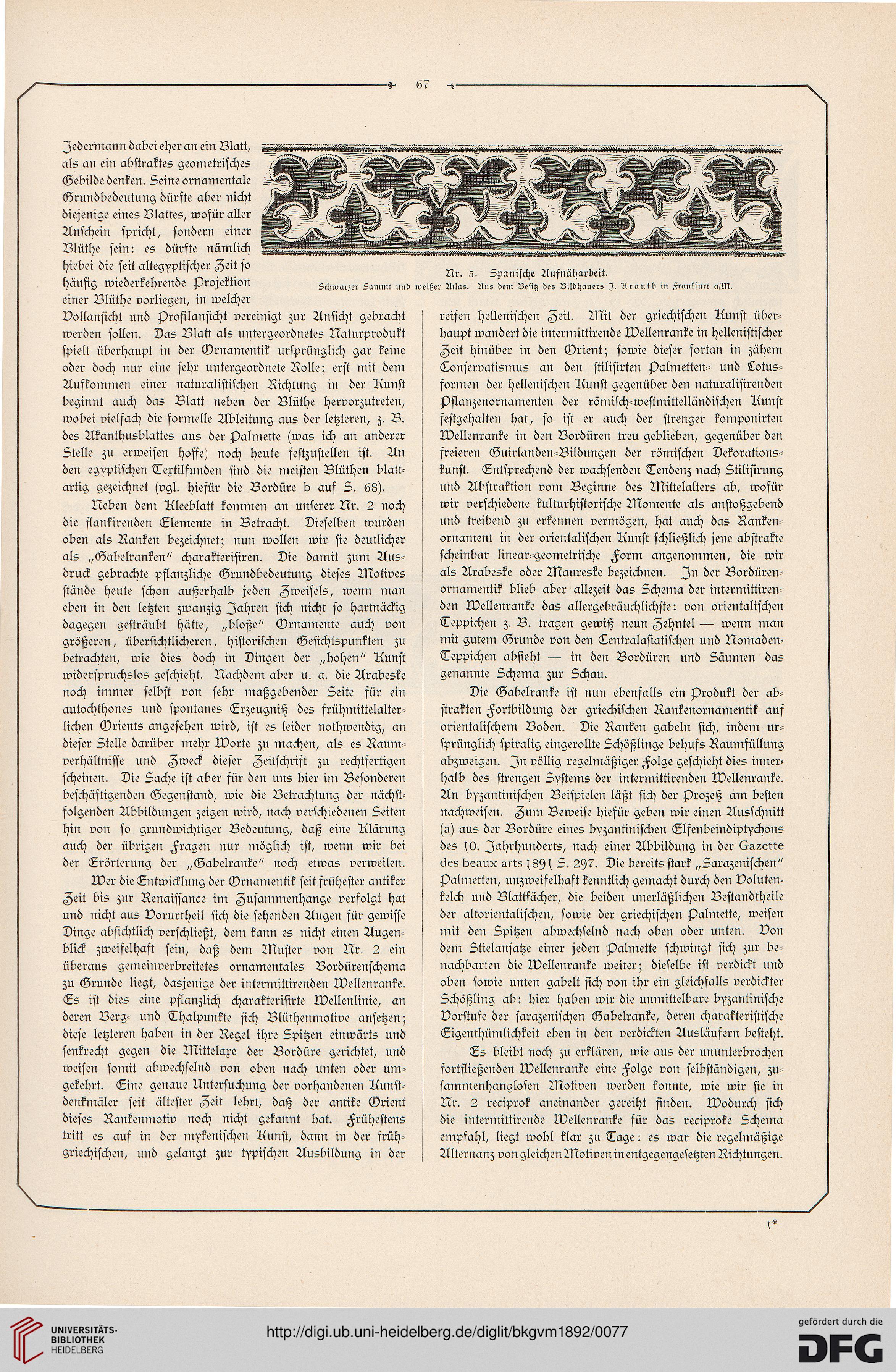Nr. 5. Spanische Aufnäharbeit.
Schwarzer Sammt und weißer Alias, Aus deni Besitz des Bildhauers 3. Arauth in Frankfurt a/M.
Zedermann dabei eher an ein Blatt,
als an ein abstraktes geometrisches
Gebilde denken. Leine ornamentale
Grundbedeutung dürfte aber nicht
diejenige eines Blattes, wofür aller
Anschein spricht, sondern einer
Blüthe sein: es dürfte nämlich
hiebei die seit altegyptischer Zeit so
häufig wiederkehrende Projektion
einer Blüthe vorliegen, in welcher
Vollansicht und Profilansicht vereinigt zur Ansicht gebracht
werden sollen. Das Blatt als untergeordnetes Naturprodukt
spielt überhaupt in der Ornamentik ursprünglich gar keine
oder doch nur eine sehr untergeordnete Rolle; erst mit den:
Aufkommen einer naturalistischen Richtung in der Ruiist
beginnt auch das Blatt neben der Blüthe hervorzutreten,
wobei vielfach die formelle Ableitung aus der letzteren, z. B.
des Akanthusblattes aus der Palinette (was ich an anderer
Stelle zu erweisen hoffe) noch heute festzustellen ist. An
den egyptischen Textilfunden sind die meisten Blüthen blalt-
artig gezeichnet (vgl. hiefür die Bordüre b auf 5. 68).
Neben den: "Kleeblatt kommen an unserer Nr. 2 noch
die flankirenden Elemente in Betracht. Dieselben wurden
oben als Ranken bezeichnet; nun wollen wir sie deullicher
als „Gabelranken" charakterisiren. Die damit zuin Aus-
druck gebrachte pflanzliche Grundbedeutung dieses Wotives
stände heute schon außerhalb jeden Zweifels, wenn man
eben in den letzten zwanzig Zähren sich nicht so hartnäckig
dagegen gesträubt hätte, „bloße" Ornamente auch von
größeren, übersichtlicheren, historischen Gesichtspunkten zu
betrachten, wie dies doch in Dingen der „hohen" Aunst
widerspruchslos geschieht. Nachdem aber u. a. die Arabeske
noch immer selbst von sehr maßgebender Leite für ein
autochthones und spontanes Erzeugniß des frühmittelalter-
lichen Orients angesehen wird, ist es leider nothwcndig, an
dieser Stelle darüber mehr Worte zu machen, als cs Raum
Verhältnisse und Zweck dieser Zeitschrift zu rechtfertigen
scheinen. Die Lache ist aber für den uns hier im Besonderen
beschäftigenden Gegenstand, wie die Betrachtung der nächst-
folgenden Abbildungen zeigen wird, nach verschiedenen Leiten
hin von so grundwichtiger Bedeutung, daß eine Rlärung
auch der übrigen Fragen nur möglich ist, wenn wir bei
der Erörterung der „Gabelranke" noch etwas verweilen.
Wer die Entwicklung der Ornamentik seit frühester antiker
Zeit bis zur Renaissance im Zusammenhänge verfolgt hat
und nicht aus Vorurtheil sich die sehenden Augen für gewisse
Dinge absichtlich verschließt, dem kann es nicht einen Augen
blick zweifelhaft sein, daß dem Wüster von Nr. 2 ein
überaus gemeinverbreitetes ornamentales Bordürenschema
zu Grunde liegt, dasjenige der intermittirenden Wellenranke.
Es ist dies eine pflanzlich charaktcrisirte Wellenlinie, an
deren Berg- und Thalpunkte sich Blüthenmotive ansetzen;
diese letzteren haben in der Regel ihre Spitzen einwärts und
senkrecht gegen die Wittelaxe der Bordüre gerichtet, und
weisen sonnt abwechselnd von oben nach unten oder um-
gekehrt. Eine genaue Untersuchung der vorhandenen Aunst-
denkmäler seit ältester Zeit lehrt, daß der antike Orient
dieses Rankenmotiv noch nicht gekannt hat. Frühestens
tritt es auf in der mykenifchen Aunst, dann in der früh-
griechischen, und gelangt zur typischen Ausbildung in der
reifen hellenischen Zeit. Wit der griechischen Aunst über-
haupt wandert die intermittirende Wellenranke in hellenistischer
Zeit hinüber in den Orient; sowie dieser fortan in zähem
Lonservatismus an den stilisirten Palmetten und Lotus-
formen der hellenischen Aunst gegenüber den naturalisirenden
Pflanzenornamenten der römisch-westnüttelländischen Aunst
festgehalten hat, so ist er auch der strenger koinponirten
Wellenranke in den Bordüren treu geblieben, gegenüber den
freieren Guirlanden Bildungen der römischen Dekorations-
kunst. Entsprechend der wachsenden Tendenz nach Ltilisirung
und Abstraktion von: Beginne des Wittelalters ab, wofür
wir verschiedene kulturhistorische Womente als anstoßgebend
und treibend zu erkennen vermögen, hat auch das Ranken
ornament in der orientalischen Aunst schließlich jene abstrakte
scheinbar linear-geometrische Form angenommen, die wir
als Arabeske oder Waureske bezeichnen. Zn der Bordüren-
ornamentik blieb aber allezeit das Lcheina der intermittiren
den Wellenranke das allergebräuchlichste: von orientalischen
Teppichen z. B. tragen gewiß neun Zehntel — wenn man
mit gutem Grunde von den Tentralasiatischen und Nomaden-
Tcppichen absieht — in den Bordüren und Säumen das
genannte Schema zur Schau.
Die Gabelranke ist nun ebenfalls ein Produkt der ab-
strakten Fortbildung der griechischen Rankenornamentik aus
orientalischem Boden. Die Ranken gabeln sich, indem ur-
sprünglich spiralig eingerollte Schößlinge behufs Raumfüllung
abzweigen. Zn völlig regelmäßiger Folge geschieht dies inner-
halb des strengen Systems der intermittirenden Wellenranke.
An byzantinischen Beispielen läßt sich der Prozeß am besten
Nachweisen. Zum Beweise hiefür geben wir einen Ausschnitt
(a) aus der Bordüre eines byzantinischen Elfenbeindiptychons
des f0. Zahrhunderts, nach einer Abbildung in der Gazette
des beaux arts ^8f>l 5. 29". Die bereits stark „Sarazenischen"
Palmetten, unzweifelhaft kenntlich geinacht durch den Voluten-
kelch und Blattsächer, die beiden unerläßlichen Bestandtheile
der altorientalischen, sowie der griechischen palmette, weisen
mit den Spitzen abwechselnd nach oben oder unten. Von
dem Stielansatze einer jeden palmette schwingt sich zur be
nachbarten die Wellenranke weiter; dieselbe ist verdickt und
oben sowie unten gabelt sich von ihr ein gleichfalls verdickter
Schößling ab: hier haben wir die unmittelbare byzantinische
Vorstufe der sarazenischen Gabelranke, deren charakteristische
Eigenthümlichkeit eben in den verdickten Ausläufern besteht.
Es bleibt noch zu erklären, wie aus der ununterbrochen
fortfließenden Wellenranke eine Folge von selbständigen, zu
samntenhanglosen Motiven werden konnte, wie wir sie in
Nr. 2 reciprok aneinander gereiht finden. Wodurch sich
die intermittirende Wcllenranke für das reciprokc Schema
empfahl, liegt wohl klar zu Tage: es war die regelnräßige
Alternanz von gleichen Motiven in entgegengesetzten Richtungen.
Schwarzer Sammt und weißer Alias, Aus deni Besitz des Bildhauers 3. Arauth in Frankfurt a/M.
Zedermann dabei eher an ein Blatt,
als an ein abstraktes geometrisches
Gebilde denken. Leine ornamentale
Grundbedeutung dürfte aber nicht
diejenige eines Blattes, wofür aller
Anschein spricht, sondern einer
Blüthe sein: es dürfte nämlich
hiebei die seit altegyptischer Zeit so
häufig wiederkehrende Projektion
einer Blüthe vorliegen, in welcher
Vollansicht und Profilansicht vereinigt zur Ansicht gebracht
werden sollen. Das Blatt als untergeordnetes Naturprodukt
spielt überhaupt in der Ornamentik ursprünglich gar keine
oder doch nur eine sehr untergeordnete Rolle; erst mit den:
Aufkommen einer naturalistischen Richtung in der Ruiist
beginnt auch das Blatt neben der Blüthe hervorzutreten,
wobei vielfach die formelle Ableitung aus der letzteren, z. B.
des Akanthusblattes aus der Palinette (was ich an anderer
Stelle zu erweisen hoffe) noch heute festzustellen ist. An
den egyptischen Textilfunden sind die meisten Blüthen blalt-
artig gezeichnet (vgl. hiefür die Bordüre b auf 5. 68).
Neben den: "Kleeblatt kommen an unserer Nr. 2 noch
die flankirenden Elemente in Betracht. Dieselben wurden
oben als Ranken bezeichnet; nun wollen wir sie deullicher
als „Gabelranken" charakterisiren. Die damit zuin Aus-
druck gebrachte pflanzliche Grundbedeutung dieses Wotives
stände heute schon außerhalb jeden Zweifels, wenn man
eben in den letzten zwanzig Zähren sich nicht so hartnäckig
dagegen gesträubt hätte, „bloße" Ornamente auch von
größeren, übersichtlicheren, historischen Gesichtspunkten zu
betrachten, wie dies doch in Dingen der „hohen" Aunst
widerspruchslos geschieht. Nachdem aber u. a. die Arabeske
noch immer selbst von sehr maßgebender Leite für ein
autochthones und spontanes Erzeugniß des frühmittelalter-
lichen Orients angesehen wird, ist es leider nothwcndig, an
dieser Stelle darüber mehr Worte zu machen, als cs Raum
Verhältnisse und Zweck dieser Zeitschrift zu rechtfertigen
scheinen. Die Lache ist aber für den uns hier im Besonderen
beschäftigenden Gegenstand, wie die Betrachtung der nächst-
folgenden Abbildungen zeigen wird, nach verschiedenen Leiten
hin von so grundwichtiger Bedeutung, daß eine Rlärung
auch der übrigen Fragen nur möglich ist, wenn wir bei
der Erörterung der „Gabelranke" noch etwas verweilen.
Wer die Entwicklung der Ornamentik seit frühester antiker
Zeit bis zur Renaissance im Zusammenhänge verfolgt hat
und nicht aus Vorurtheil sich die sehenden Augen für gewisse
Dinge absichtlich verschließt, dem kann es nicht einen Augen
blick zweifelhaft sein, daß dem Wüster von Nr. 2 ein
überaus gemeinverbreitetes ornamentales Bordürenschema
zu Grunde liegt, dasjenige der intermittirenden Wellenranke.
Es ist dies eine pflanzlich charaktcrisirte Wellenlinie, an
deren Berg- und Thalpunkte sich Blüthenmotive ansetzen;
diese letzteren haben in der Regel ihre Spitzen einwärts und
senkrecht gegen die Wittelaxe der Bordüre gerichtet, und
weisen sonnt abwechselnd von oben nach unten oder um-
gekehrt. Eine genaue Untersuchung der vorhandenen Aunst-
denkmäler seit ältester Zeit lehrt, daß der antike Orient
dieses Rankenmotiv noch nicht gekannt hat. Frühestens
tritt es auf in der mykenifchen Aunst, dann in der früh-
griechischen, und gelangt zur typischen Ausbildung in der
reifen hellenischen Zeit. Wit der griechischen Aunst über-
haupt wandert die intermittirende Wellenranke in hellenistischer
Zeit hinüber in den Orient; sowie dieser fortan in zähem
Lonservatismus an den stilisirten Palmetten und Lotus-
formen der hellenischen Aunst gegenüber den naturalisirenden
Pflanzenornamenten der römisch-westnüttelländischen Aunst
festgehalten hat, so ist er auch der strenger koinponirten
Wellenranke in den Bordüren treu geblieben, gegenüber den
freieren Guirlanden Bildungen der römischen Dekorations-
kunst. Entsprechend der wachsenden Tendenz nach Ltilisirung
und Abstraktion von: Beginne des Wittelalters ab, wofür
wir verschiedene kulturhistorische Womente als anstoßgebend
und treibend zu erkennen vermögen, hat auch das Ranken
ornament in der orientalischen Aunst schließlich jene abstrakte
scheinbar linear-geometrische Form angenommen, die wir
als Arabeske oder Waureske bezeichnen. Zn der Bordüren-
ornamentik blieb aber allezeit das Lcheina der intermittiren
den Wellenranke das allergebräuchlichste: von orientalischen
Teppichen z. B. tragen gewiß neun Zehntel — wenn man
mit gutem Grunde von den Tentralasiatischen und Nomaden-
Tcppichen absieht — in den Bordüren und Säumen das
genannte Schema zur Schau.
Die Gabelranke ist nun ebenfalls ein Produkt der ab-
strakten Fortbildung der griechischen Rankenornamentik aus
orientalischem Boden. Die Ranken gabeln sich, indem ur-
sprünglich spiralig eingerollte Schößlinge behufs Raumfüllung
abzweigen. Zn völlig regelmäßiger Folge geschieht dies inner-
halb des strengen Systems der intermittirenden Wellenranke.
An byzantinischen Beispielen läßt sich der Prozeß am besten
Nachweisen. Zum Beweise hiefür geben wir einen Ausschnitt
(a) aus der Bordüre eines byzantinischen Elfenbeindiptychons
des f0. Zahrhunderts, nach einer Abbildung in der Gazette
des beaux arts ^8f>l 5. 29". Die bereits stark „Sarazenischen"
Palmetten, unzweifelhaft kenntlich geinacht durch den Voluten-
kelch und Blattsächer, die beiden unerläßlichen Bestandtheile
der altorientalischen, sowie der griechischen palmette, weisen
mit den Spitzen abwechselnd nach oben oder unten. Von
dem Stielansatze einer jeden palmette schwingt sich zur be
nachbarten die Wellenranke weiter; dieselbe ist verdickt und
oben sowie unten gabelt sich von ihr ein gleichfalls verdickter
Schößling ab: hier haben wir die unmittelbare byzantinische
Vorstufe der sarazenischen Gabelranke, deren charakteristische
Eigenthümlichkeit eben in den verdickten Ausläufern besteht.
Es bleibt noch zu erklären, wie aus der ununterbrochen
fortfließenden Wellenranke eine Folge von selbständigen, zu
samntenhanglosen Motiven werden konnte, wie wir sie in
Nr. 2 reciprok aneinander gereiht finden. Wodurch sich
die intermittirende Wcllenranke für das reciprokc Schema
empfahl, liegt wohl klar zu Tage: es war die regelnräßige
Alternanz von gleichen Motiven in entgegengesetzten Richtungen.