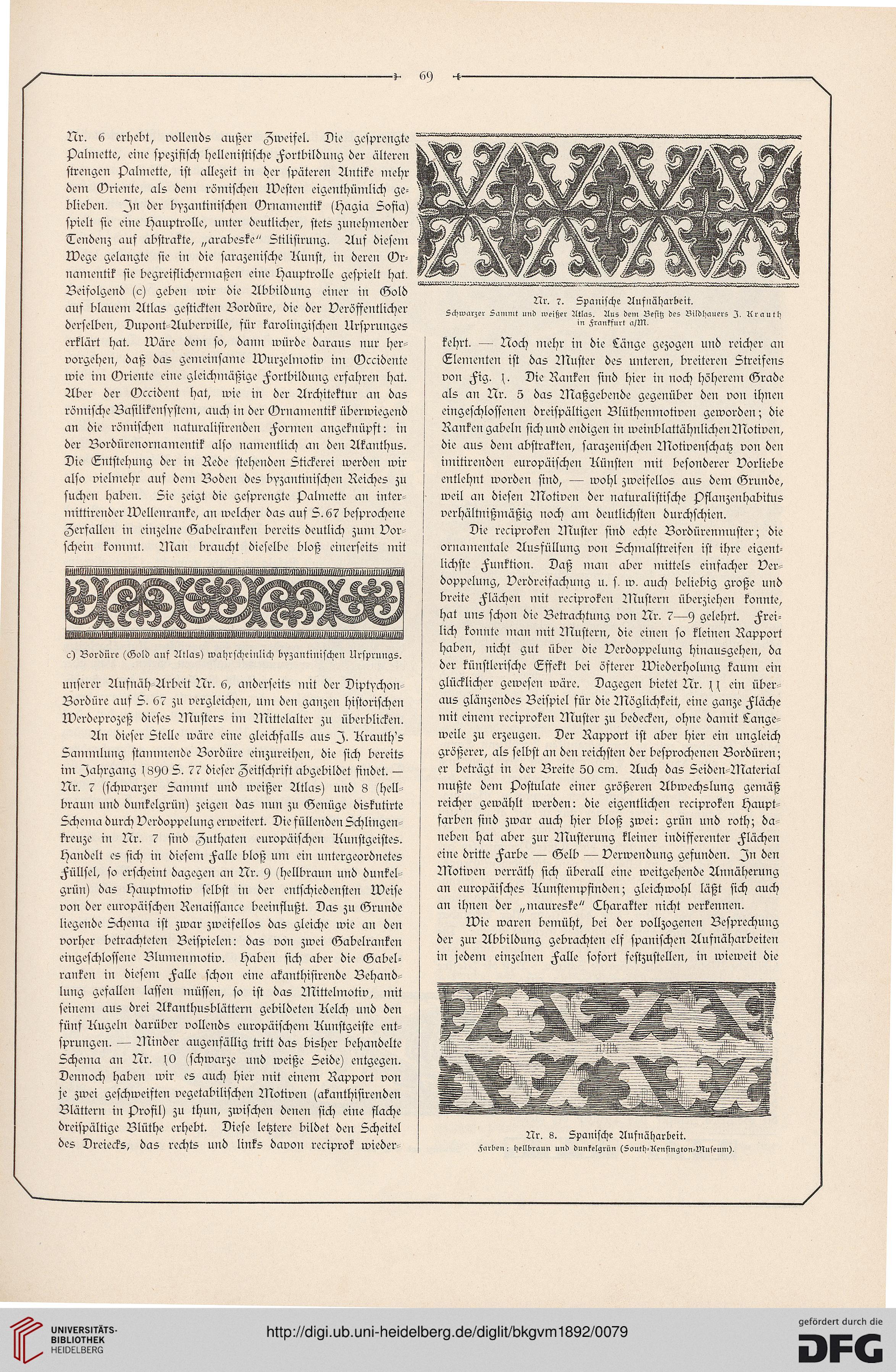Nr. 6 erhebt, vollends außer Zweifel. Die gesprengte
Palmette, eine spezifisch hellenistische Fortbildung der älteren
strengen palmette, ist allezeit in der späteren Antike mehr
dein Griente, als den: rönrischen Westen eigenthümlich ge-
blieben. In der byzantinischen Ornamentik (pagia Sofia)
spielt sie eine pauptrolle, unter deutlicher, stets zunehmender
Tendenz auf abstrakte, „arabeske" Stilisirung. Auf diesen:
Wege gelangte sie in die sarazenische Aunst, in deren Gr-
nanwntik sie begreifiichermaßen eine pauptrolle gespielt hat.
Beifolgend (c) geben wir die Abbildung einer in Gold
aus blauem Atlas gestickten Bordüre, die der Verösfentlicher
derselben, Dupont Auberville, für karolingischen Ursprunges
erklärt hat. Wäre dem so, dann würde daraus nur her-
vorgehen, daß das gemeinsame Wurzelmotiv hu Occidente
wie im Griente eine gleichmäßige Fortbildung erfahren hat.
Aber der Gccident hat, wie in der Architektur an das
römische Basilikensystem, auch in der Ornamentik überwiegend
an die römischen naturalisirenden Formen angeknüpst: in
der Bordürenornamentik also namentlich an den Akanthus.
Die Entstehung der in Rede stehenden Stickerei werden wir
also vielmehr auf dem Boden des byzantinischen Reiches zu
suchen haben. Sie zeigt die gesprengte Palmette an inter-
inittirender Wellenranke, an welcher das auf 5.67 besprochene
Zerfallen in einzelne Gabelranken bereits deutlich zun: Vor-
schein kommt. Man braucht dieselbe bloß einerseits mit
c) Bordüre (Gold auf Atlas) wahrscheinlich byzantinischen Ursprungs.
unserer Ausnäh Arbeit Nr. 6, anderseits mit der Diptychon
Bordüre auf S. 67 zu vergleichen, um den ganzen historischen
Werdeprozeß dieses Musters im Mittelalter zu überblicken.
An dieser Stelle wäre eine gleichfalls aus I. Arauth's
Sammlung stammende Bordüre einzureihen, die sich bereits
int Jahrgang l8ß0 5. 77 dieser Zeitschrift abgebildet findet. —
Nr. 7 (schwarzer Sammt und weißer Atlas) und 8 (hell-
brauit lind dunkelgrün) zeigen das nun zu Genüge diskutirte
Schenca durch Verdoppelung erweitert. Die füllenden Schlingen
kreuze in Nr. 7 sind Zuthateir europäischen Aunstgeistes.
pandelt es sich in diesem Falle bloß um ein untergeordnetes
Füllsel, so erscheint dagegeit an Nr. 9 (hellbraun und dunkel-
grün) das pauptmotiv selbst in der entschiedensten Weise
von der europäischen Renaissance beeinflußt. Das zu Grunde
liegende Schema ist zwar zweifellos das gleiche wie an den
vorher betrachteten Beispielen: das von zwei Gabelranken
eingeschlosieite Blumenmotiv, paben sich aber die Gabel-
ranken in diesem Falle schon eine akanthisirende Behand-
lung gefallen lassen müssen, so ist das Mittelmotiv, mit
seinem aus drei Akanthusblättern gebildeten Reich und den
fünf Äugeln darüber vollends europäischem Aunstgeiste ent-
sprungen. — Minder augenfällig tritt das bisher behandelte
Schema an Nr. (0 (schwarze und weiße Seide) entgegen.
Dennoch haben wir es auch hier mit einem Rapport von
je zwei geschweiften vegetabilischen Motiven (akanthisirenden
Blättern in Profil) zu thun, zwischen denen sich eine flache
dreispältige Blüthe erhebt. Diese letztere bildet den Scheitel
des Dreiecks, das rechts und links davon rcciprok wieder
Nr. 7. Spanische Aufnäharbeit.
Schwarzer Samftit und weißer Atlas. Aus deni Besitz des Bildhauers I. Arauth
in Frankfurt a/M.
kehrt. — Noch mehr in die Länge gezogen und reicher an
Elementen ist das Muster des miteren, breiteren Streifens
von Fig. f. Die Ranken sind hier in noch höherem Grade
als an Nr. 5 das Maßgebende gegenüber den von ihneit
eingeschlossenen dreispältigen Blüthenmotiven geworden; die
Ranken gabeln sich und endigen in weinblattähnlichen Motiven,
die aus den: abstrakten, sarazenischen Motivenschatz von den
imitirenden europäischen Aünsten mit besonderer Vorliebe
entlehnt worden sind, — wohl zweifellos aus dem Grunde,
weil an diesen Motiven der naturalistische psianzenhabitus
verhältnißmäßig noch am deutlichsten durchschien.
Die reciproken Muster sind echte Bordürenmuster; die
ornamentale Ausfüllung von Schmalstreifen ist ihre eigent-
lichste Funktion. Daß inan aber mittels einfacher Ver-
doppelung, Verdreifachung u. s. w. auch beliebig große und
breite Flächen mit reciproken Mustern überziehen konnte,
hat uns schon die Betrachtung von Nr. 7—9 gelehrt. Frei-
lich konnte inan mit Mustern, die einen so kleinen Rapport
haben, nicht gut über die Verdoppeluiig hinausgehen, da
der künstlerische Effekt bei öfterer Wiederholung kaum ein
glücklicher gewesen wäre. Dagegen bietet Nr. \ \ ein über-
aus glänzendes Beispiel für die Möglichkeit, eine ganze Fläche
mit einen: reciproken Muster zu bedecken, ohne damit Lange-
weile zu erzeugen. Der Rapport ist aber hier ein ungleich
größerer, als selbst an den reichsten der besprochenen Bordüren;
er beträgt in der Breite 50 cm. Auch das Seiden-Material
n:ußte dem Postulats einer größeren Abwechslung gemäß
reicher gewählt werden: die eigentlichen reciproken paupt
farben sind zwar auch hier bloß zwei: grün und roth; da-
neben hat aber zur Musterung kleiner indifferenter Flächen
eine dritte Farbe — Gelb — Verwendung gefunden. In den
Motiven verräth sich überall eine weitgehende Annäherung
an europäisches Aunsten:pfinden; gleichwohl läßt sich auch
an ihnen der „maureske" Eharakter nicht verkennen.
Wie waren bemüht, bei der vollzogenen Besprechung
der zur Abbildung gebrachten elf spanischen Aufnäharbeiten
in jedem einzelnen Falle sofort sestzustellen, in wieweit die
Nr. 8. Spanische Aufnäharbeit.
Farben: hellbraun und dunkelgrün (Soutb-Aensington-Museum).
Palmette, eine spezifisch hellenistische Fortbildung der älteren
strengen palmette, ist allezeit in der späteren Antike mehr
dein Griente, als den: rönrischen Westen eigenthümlich ge-
blieben. In der byzantinischen Ornamentik (pagia Sofia)
spielt sie eine pauptrolle, unter deutlicher, stets zunehmender
Tendenz auf abstrakte, „arabeske" Stilisirung. Auf diesen:
Wege gelangte sie in die sarazenische Aunst, in deren Gr-
nanwntik sie begreifiichermaßen eine pauptrolle gespielt hat.
Beifolgend (c) geben wir die Abbildung einer in Gold
aus blauem Atlas gestickten Bordüre, die der Verösfentlicher
derselben, Dupont Auberville, für karolingischen Ursprunges
erklärt hat. Wäre dem so, dann würde daraus nur her-
vorgehen, daß das gemeinsame Wurzelmotiv hu Occidente
wie im Griente eine gleichmäßige Fortbildung erfahren hat.
Aber der Gccident hat, wie in der Architektur an das
römische Basilikensystem, auch in der Ornamentik überwiegend
an die römischen naturalisirenden Formen angeknüpst: in
der Bordürenornamentik also namentlich an den Akanthus.
Die Entstehung der in Rede stehenden Stickerei werden wir
also vielmehr auf dem Boden des byzantinischen Reiches zu
suchen haben. Sie zeigt die gesprengte Palmette an inter-
inittirender Wellenranke, an welcher das auf 5.67 besprochene
Zerfallen in einzelne Gabelranken bereits deutlich zun: Vor-
schein kommt. Man braucht dieselbe bloß einerseits mit
c) Bordüre (Gold auf Atlas) wahrscheinlich byzantinischen Ursprungs.
unserer Ausnäh Arbeit Nr. 6, anderseits mit der Diptychon
Bordüre auf S. 67 zu vergleichen, um den ganzen historischen
Werdeprozeß dieses Musters im Mittelalter zu überblicken.
An dieser Stelle wäre eine gleichfalls aus I. Arauth's
Sammlung stammende Bordüre einzureihen, die sich bereits
int Jahrgang l8ß0 5. 77 dieser Zeitschrift abgebildet findet. —
Nr. 7 (schwarzer Sammt und weißer Atlas) und 8 (hell-
brauit lind dunkelgrün) zeigen das nun zu Genüge diskutirte
Schenca durch Verdoppelung erweitert. Die füllenden Schlingen
kreuze in Nr. 7 sind Zuthateir europäischen Aunstgeistes.
pandelt es sich in diesem Falle bloß um ein untergeordnetes
Füllsel, so erscheint dagegeit an Nr. 9 (hellbraun und dunkel-
grün) das pauptmotiv selbst in der entschiedensten Weise
von der europäischen Renaissance beeinflußt. Das zu Grunde
liegende Schema ist zwar zweifellos das gleiche wie an den
vorher betrachteten Beispielen: das von zwei Gabelranken
eingeschlosieite Blumenmotiv, paben sich aber die Gabel-
ranken in diesem Falle schon eine akanthisirende Behand-
lung gefallen lassen müssen, so ist das Mittelmotiv, mit
seinem aus drei Akanthusblättern gebildeten Reich und den
fünf Äugeln darüber vollends europäischem Aunstgeiste ent-
sprungen. — Minder augenfällig tritt das bisher behandelte
Schema an Nr. (0 (schwarze und weiße Seide) entgegen.
Dennoch haben wir es auch hier mit einem Rapport von
je zwei geschweiften vegetabilischen Motiven (akanthisirenden
Blättern in Profil) zu thun, zwischen denen sich eine flache
dreispältige Blüthe erhebt. Diese letztere bildet den Scheitel
des Dreiecks, das rechts und links davon rcciprok wieder
Nr. 7. Spanische Aufnäharbeit.
Schwarzer Samftit und weißer Atlas. Aus deni Besitz des Bildhauers I. Arauth
in Frankfurt a/M.
kehrt. — Noch mehr in die Länge gezogen und reicher an
Elementen ist das Muster des miteren, breiteren Streifens
von Fig. f. Die Ranken sind hier in noch höherem Grade
als an Nr. 5 das Maßgebende gegenüber den von ihneit
eingeschlossenen dreispältigen Blüthenmotiven geworden; die
Ranken gabeln sich und endigen in weinblattähnlichen Motiven,
die aus den: abstrakten, sarazenischen Motivenschatz von den
imitirenden europäischen Aünsten mit besonderer Vorliebe
entlehnt worden sind, — wohl zweifellos aus dem Grunde,
weil an diesen Motiven der naturalistische psianzenhabitus
verhältnißmäßig noch am deutlichsten durchschien.
Die reciproken Muster sind echte Bordürenmuster; die
ornamentale Ausfüllung von Schmalstreifen ist ihre eigent-
lichste Funktion. Daß inan aber mittels einfacher Ver-
doppelung, Verdreifachung u. s. w. auch beliebig große und
breite Flächen mit reciproken Mustern überziehen konnte,
hat uns schon die Betrachtung von Nr. 7—9 gelehrt. Frei-
lich konnte inan mit Mustern, die einen so kleinen Rapport
haben, nicht gut über die Verdoppeluiig hinausgehen, da
der künstlerische Effekt bei öfterer Wiederholung kaum ein
glücklicher gewesen wäre. Dagegen bietet Nr. \ \ ein über-
aus glänzendes Beispiel für die Möglichkeit, eine ganze Fläche
mit einen: reciproken Muster zu bedecken, ohne damit Lange-
weile zu erzeugen. Der Rapport ist aber hier ein ungleich
größerer, als selbst an den reichsten der besprochenen Bordüren;
er beträgt in der Breite 50 cm. Auch das Seiden-Material
n:ußte dem Postulats einer größeren Abwechslung gemäß
reicher gewählt werden: die eigentlichen reciproken paupt
farben sind zwar auch hier bloß zwei: grün und roth; da-
neben hat aber zur Musterung kleiner indifferenter Flächen
eine dritte Farbe — Gelb — Verwendung gefunden. In den
Motiven verräth sich überall eine weitgehende Annäherung
an europäisches Aunsten:pfinden; gleichwohl läßt sich auch
an ihnen der „maureske" Eharakter nicht verkennen.
Wie waren bemüht, bei der vollzogenen Besprechung
der zur Abbildung gebrachten elf spanischen Aufnäharbeiten
in jedem einzelnen Falle sofort sestzustellen, in wieweit die
Nr. 8. Spanische Aufnäharbeit.
Farben: hellbraun und dunkelgrün (Soutb-Aensington-Museum).