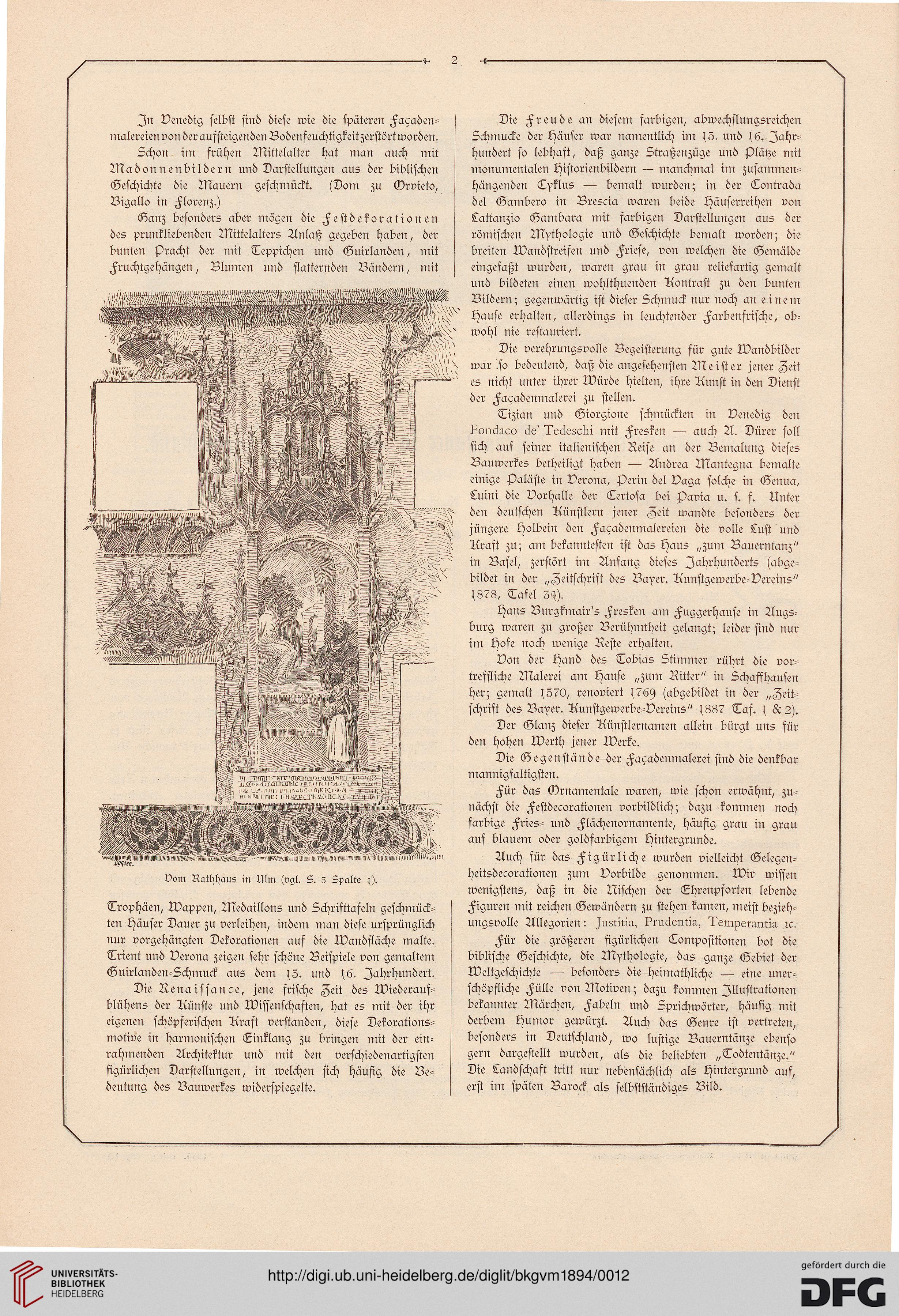2
4'
3n Venedig selbst sind diese wie die späteren Facaden-
malereien von der aussteigenden Bodenfeuchtigkeitzerstörtworden.
Schon im frühen Mittelalter hat man auch mit
Madonnenbildern und Darstellungen aus der biblischen
Geschichte die Mauern geschmückt. (Dom zu Vrvieto,
Bigallo in Florenz.)
Ganz besonders aber mögen die Festdekorationen
des prunkliebenden Mittelalters Anlaß gegeben haben, der
bunten Pracht der mit Teppichen und Guirlanden, mit
Fruchtgehängen, Blumen und flatternden Bändern, mit
vom Rathhaus in Ulm (vgl. S. 3 Spalte ().
Trophäen, Mappen, Medaillons und Schrifttafeln geschmück-
ten päuser Dauer zu verleihen, indem inan diese ursprünglich
nur vorgehängten Dekorationen auf die Mandfläche malte.
Trient und Verona zeigen sehr schöne Beispiele von gemaltem
Guirlanden-Schmuck aus dem i(5. und f6. Jahrhundert.
Die Renaissance, jene frische Zeit des Wiederauf-
blühens der Künste und Wissenschaften, hat es mit der ihr
eigenen schöpferischen Kraft verstanden, diese Dekorations-
motivs in harmonischen Einklang zu bringen mit der ein-
rahmenden Architektur und tnit den verschiedenartigsten
flgürlichen Darstellungen, in welchen sich häuflg die Be-
deutung des Bauwerkes widerspiegelte.
Die Freude an diesem farbigen, abwechslungsreichen
Schmucke der päuser war namentlich im J5. und l 6. Jahr-
hundert so lebhaft, daß ganze Straßenzüge und Plätze mit
monumentalen Historienbildern — manchmal im zusammen-
hängenden Tyklus — bemalt wurden; in der Tontrada
del Gambero in Brescia waren beide Häuserreihen von
Lattanzio Gambara mit farbigen Darstellungen aus der
römischen Mythologie und Geschichte bemalt worden; die
breiten Mandstreifen und Friese, von welchen die Geinälde
eingefaßt wurden, waren grau in grau reliefartig gernalt
und bildeten einen wohlthuenden Kontrast zu den bunten
Bildern; gegenwärtig ist dieser Schmuck nur noch an einem
Pause erhalten, allerdings in leuchtender Farbenfrische, ob-
wohl nie restauriert.
Die verehrungsvolle Begeisterung für gute Wandbilder
war ,so bedeutend, daß die angesehensten Meister jener Zeit
es nicht unter ihrer Würde hielten, ihre Kunst in den Dienst
der Facadenmalerei zu stellen.
Tizian und Giorgione schmückten in Venedig den
Pondaco de’ Tedeschi mit Fresken — auch A. Dürer soll
sich auf seiner italienischen Reise an der Bemalung dieses
Bauwerkes betheiligt haben — Andrea Mantegna bemalte
einige Paläste in Verona, Perin del Vaga solche in Genua,
Suirti die Vorhalle der Tertosa bei pavia u. s. f. Unter
den deutschen Künstlern jener Zeit wandte besonders der
jüngere Polbein den Facadenmalereien die volle Lust und
Kraft zu; am bekanntesten ist das paus „zum Bauerntanz"
in Bafel, zerstört im Anfang dieses Jahrhunderts (abge-
bildet in der „Zeitschrift des Bayer. Kunstgewerbe-Vereins"
s878, Tafel 3-P.
pans Burgkmair's Fresken am Fuggerhause in Augs-
burg waren zu großer Berühmtheit gelangt; leider sind nur
im Pose noch wenige Reste erhalten.
Von der pand des Tobias Stimmer rührt die vor-
treffliche Malerei an: Pause „zun: Ritter" in Schaffhausen
her; gemalt (570, renoviert s76ft (abgebildet in der „Zeit-
schrift des Bayer. Kunstgewerbe-Vereins" j887 Taf. f öc 2).
Der Glanz dieser Künstlernamen allein bürgt uns für
den hohen Werth jener Werke.
Die Gegenstände der Facadenmalerei sind die denkbar
n:annigfaltigsten.
Für das Ornamentale waren, wie schon erwähnt, zu-
nächst die Festdecorationen vorbildlich; dazu kommen noch
farbige Fries- und Flächenornamente, häuflg grau in grau
auf blauem oder goldfarbigem pintergrunde.
Auch für das Figürliche wurden vielleicht Gelegcn-
hcitsdecorationen zum Vorbilde genomn:en. Wir wissen
wenigstens, daß in die Nischen der Ehrenpforten lebende
Figuren mit reichen Gewändern zu stehen kamen, meist bezieh-
ungsvolle Allegorien: Justitia, Prudentia, Temperantia rc.
Für die größeren figürlichen Eoinpofltionen bot die
biblische Geschichte, die Mythologie, das ganze Gebiet der
Weltgeschichte — besonders die heimathliche — eine uner-
schöpfliche Fülle von Biotiven; dazu kommen Illustrationen
bekannter Märchen, Fabeln und Sprichwörter, häufig mit
derbem pumor gewürzt. Auch das Genre ist vertreten,
besonders in Deutschland, wo lustige Bauerntänze ebenso
gern dargestellt wurden, als die beliebten „Todtentänze."
Die Landschaft tritt nur nebensächlich als pintergrund auf,
erst in: späten Barock als selbstständiges Bild.
4'
3n Venedig selbst sind diese wie die späteren Facaden-
malereien von der aussteigenden Bodenfeuchtigkeitzerstörtworden.
Schon im frühen Mittelalter hat man auch mit
Madonnenbildern und Darstellungen aus der biblischen
Geschichte die Mauern geschmückt. (Dom zu Vrvieto,
Bigallo in Florenz.)
Ganz besonders aber mögen die Festdekorationen
des prunkliebenden Mittelalters Anlaß gegeben haben, der
bunten Pracht der mit Teppichen und Guirlanden, mit
Fruchtgehängen, Blumen und flatternden Bändern, mit
vom Rathhaus in Ulm (vgl. S. 3 Spalte ().
Trophäen, Mappen, Medaillons und Schrifttafeln geschmück-
ten päuser Dauer zu verleihen, indem inan diese ursprünglich
nur vorgehängten Dekorationen auf die Mandfläche malte.
Trient und Verona zeigen sehr schöne Beispiele von gemaltem
Guirlanden-Schmuck aus dem i(5. und f6. Jahrhundert.
Die Renaissance, jene frische Zeit des Wiederauf-
blühens der Künste und Wissenschaften, hat es mit der ihr
eigenen schöpferischen Kraft verstanden, diese Dekorations-
motivs in harmonischen Einklang zu bringen mit der ein-
rahmenden Architektur und tnit den verschiedenartigsten
flgürlichen Darstellungen, in welchen sich häuflg die Be-
deutung des Bauwerkes widerspiegelte.
Die Freude an diesem farbigen, abwechslungsreichen
Schmucke der päuser war namentlich im J5. und l 6. Jahr-
hundert so lebhaft, daß ganze Straßenzüge und Plätze mit
monumentalen Historienbildern — manchmal im zusammen-
hängenden Tyklus — bemalt wurden; in der Tontrada
del Gambero in Brescia waren beide Häuserreihen von
Lattanzio Gambara mit farbigen Darstellungen aus der
römischen Mythologie und Geschichte bemalt worden; die
breiten Mandstreifen und Friese, von welchen die Geinälde
eingefaßt wurden, waren grau in grau reliefartig gernalt
und bildeten einen wohlthuenden Kontrast zu den bunten
Bildern; gegenwärtig ist dieser Schmuck nur noch an einem
Pause erhalten, allerdings in leuchtender Farbenfrische, ob-
wohl nie restauriert.
Die verehrungsvolle Begeisterung für gute Wandbilder
war ,so bedeutend, daß die angesehensten Meister jener Zeit
es nicht unter ihrer Würde hielten, ihre Kunst in den Dienst
der Facadenmalerei zu stellen.
Tizian und Giorgione schmückten in Venedig den
Pondaco de’ Tedeschi mit Fresken — auch A. Dürer soll
sich auf seiner italienischen Reise an der Bemalung dieses
Bauwerkes betheiligt haben — Andrea Mantegna bemalte
einige Paläste in Verona, Perin del Vaga solche in Genua,
Suirti die Vorhalle der Tertosa bei pavia u. s. f. Unter
den deutschen Künstlern jener Zeit wandte besonders der
jüngere Polbein den Facadenmalereien die volle Lust und
Kraft zu; am bekanntesten ist das paus „zum Bauerntanz"
in Bafel, zerstört im Anfang dieses Jahrhunderts (abge-
bildet in der „Zeitschrift des Bayer. Kunstgewerbe-Vereins"
s878, Tafel 3-P.
pans Burgkmair's Fresken am Fuggerhause in Augs-
burg waren zu großer Berühmtheit gelangt; leider sind nur
im Pose noch wenige Reste erhalten.
Von der pand des Tobias Stimmer rührt die vor-
treffliche Malerei an: Pause „zun: Ritter" in Schaffhausen
her; gemalt (570, renoviert s76ft (abgebildet in der „Zeit-
schrift des Bayer. Kunstgewerbe-Vereins" j887 Taf. f öc 2).
Der Glanz dieser Künstlernamen allein bürgt uns für
den hohen Werth jener Werke.
Die Gegenstände der Facadenmalerei sind die denkbar
n:annigfaltigsten.
Für das Ornamentale waren, wie schon erwähnt, zu-
nächst die Festdecorationen vorbildlich; dazu kommen noch
farbige Fries- und Flächenornamente, häuflg grau in grau
auf blauem oder goldfarbigem pintergrunde.
Auch für das Figürliche wurden vielleicht Gelegcn-
hcitsdecorationen zum Vorbilde genomn:en. Wir wissen
wenigstens, daß in die Nischen der Ehrenpforten lebende
Figuren mit reichen Gewändern zu stehen kamen, meist bezieh-
ungsvolle Allegorien: Justitia, Prudentia, Temperantia rc.
Für die größeren figürlichen Eoinpofltionen bot die
biblische Geschichte, die Mythologie, das ganze Gebiet der
Weltgeschichte — besonders die heimathliche — eine uner-
schöpfliche Fülle von Biotiven; dazu kommen Illustrationen
bekannter Märchen, Fabeln und Sprichwörter, häufig mit
derbem pumor gewürzt. Auch das Genre ist vertreten,
besonders in Deutschland, wo lustige Bauerntänze ebenso
gern dargestellt wurden, als die beliebten „Todtentänze."
Die Landschaft tritt nur nebensächlich als pintergrund auf,
erst in: späten Barock als selbstständiges Bild.