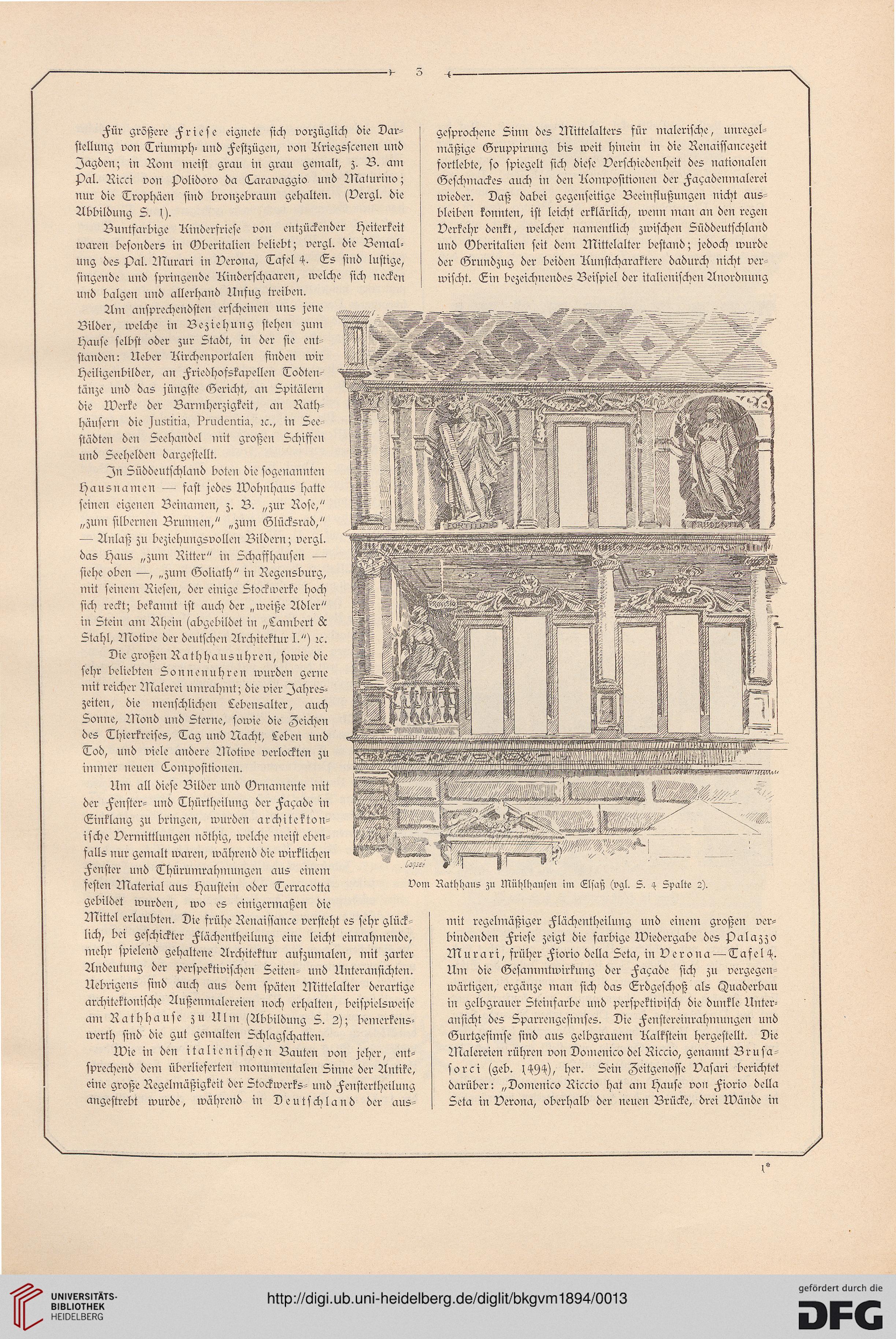Air größere Friese eignete sich vorzüglich die Dar-
stellung von Triumph- und Festzügen, von Uriegsscenen und
Jagden; in Rom meist grau in grau gemalt, z. B. ain
Pal. Ricci von Polidoro da Taravaggio und Malurino;
nur die Trophäen sind bronzebraun gehalten. (Pergl. die
Abbildung S. H).
Buntfarbige Uinderfriese von entzückender peiterkeit
waren besonders in Oberitalien beliebt; vergl. die Beinal-
ung des Pal. Murari in Verona, Tafel Ts sind lustige,
singende und springende Uinderschaaren, welche sich necken
und balgen und allerhand Unfug treiben.
Ain ansprechendsten erscheinen uns jene
Bilder, welche in Beziehung stehen zunr
Pause selbst oder zur Stadt, in der sie ent-
standen: Ueber Airchenportalen finden wir
peiligenbilder, an Friedhofskapellen Todten-
tänze und das jüngste Gericht, an Spitälern
die Werke der Barmherzigkeit, an Rath-
häusern die chistiria, Prudentia, ic,, in See-
städten den Seehandel mit großen Schiffen
und Seehelden dargestellt.
In Süddeutschland boten die sogenannten
Pausnamen — fast jedes Wohnhaus hatte
seinen eigenen Beinamen, z. B. „zur Rose,"
„zunr silbernen Brunnen," „zunr Glücksrad,"
— Anlaß zu beziehungsvollen Bildern; vergl.
das paus „zum Ritter" in Schaffhausen —
siehe oben —, „zum Goliath" in Regensburg,
mit seinenr Riesen, der einige Stockwerke hoch
sich reckt; bekannt ist auch der „weiße Adler"
in Stein anr Rhein (abgebildet in „Lambert &
Stahl, Motive der deutschen Architektur I.") rc.
Die großen Rathhausuhren, sowie die
sehr beliebten Sonnenuhren wurden gerrre
mit reicher Malerei umrahint; die vier Jahres-
zeiten, die menschlichen Lebensalter, auch
Sonne, Mond rnrd Sterne, sowie die Zeichen
des Thierkreises, Tag und Nacht, Leben und
Tod, und viele andere Motive verlockten zu
immer neuen Tompositionen.
Um all diese Bilder und Ornamente init
der Fenster- und Thürtheilung der Facade in
Einklang zu bringen, wurden architekton-
ische Vermittlungen nöthig, welche meist eben-
falls nur gemalt waren, während die wirklichen
Fenster und Thürumrahmungen aus einem
festen Material aus paustein oder Terracottä
gebildet wurden, wo es einigermaßen die
Buttel erlaubten. Die frühe Renaissance versteht es sehr glück-
lich, bei geschickter Flächentheilung eine leicht einrahmende,
inehr spielend gehaltene Architektur aufzumalen, init zarter
Andeutung der perspektivischen Seiten- und Unteransichten.
Uebrigens sind auch aus dem späteii Mittelalter derartige
architektonische Außenmalereien noch erhalten, beispielsweise
am Rathhause zu Ulm (Abbildung S. 2); bemerkens-
werth sind die gut genialten Schlagschatten.
Wie in den italienischen Bauten voii jeher, ent-
sprechend dein überlieferten monuinentalen Sinne der Aiitike,
eine große Regelmäßigkeit der Stockwerks- uiid Fenstertheilung
angestrebt wurde, während in Deutschland der
gesprochene Sinn des Mittelalters für malerische, unregel-
mäßige Gruppirung bis weit hinein in die Renaissancezeit
fortlebte, so spiegelt sich diese Verschiedenheit des nationalen
Geschiiiackes auch iit den Aompositionen der Facadenmalerei
wieder. Daß dabei gegenseitige Beeinflußungen nicht aus-
bleiben konnten, ist leicht erklärlich, wenn man an den regen
Verkehr denkt, welcher namentlich zwischen Süddeutschland
und Oberitalien seit dem Mittelalter bestand; jedoch wurde
der Grundzug der beiden Uunstcharaktere dadurch nicht ver-
wischt. Tin bezeichnendes Beispiel der italienischen Anordnung
aus-
Ooin Rathhaus zu Mühlhausen im Elsaß (vgl. S. 4 Spalte 2).
mit regelmäßiger Flächentheilung uitd einem großen ver-
bindenden Friese zeigt die farbige Wiedergabe des Palazzo
Murari, früher Fiorio della Seta, in Verona — Tafelp
Um die Gesammtwirkung der Facade sich zu vergegen-
wärtigen, ergänze man sich das Erdgeschoß als ^uaderbau
in gelbgrauer Steinfarbe uitd perspektivisch die dunkle Unter-
ansicht des Sparrengesimses. Die Fenstereinrahtnungen und
Gurtgesimse sind aus gelbgrauenr Ualkstein hergestellt. Die
Malereien rühren von Domenico del Riccio, genannt Brusa-
sorci (geb. her. Sein Zeitgenosse Vasari berichtet
darüber: „Domenico Riccio hat am Pause von Fiorio della
Seta in Verona, oberhalb der neuen Brücke,, drei Wände in
stellung von Triumph- und Festzügen, von Uriegsscenen und
Jagden; in Rom meist grau in grau gemalt, z. B. ain
Pal. Ricci von Polidoro da Taravaggio und Malurino;
nur die Trophäen sind bronzebraun gehalten. (Pergl. die
Abbildung S. H).
Buntfarbige Uinderfriese von entzückender peiterkeit
waren besonders in Oberitalien beliebt; vergl. die Beinal-
ung des Pal. Murari in Verona, Tafel Ts sind lustige,
singende und springende Uinderschaaren, welche sich necken
und balgen und allerhand Unfug treiben.
Ain ansprechendsten erscheinen uns jene
Bilder, welche in Beziehung stehen zunr
Pause selbst oder zur Stadt, in der sie ent-
standen: Ueber Airchenportalen finden wir
peiligenbilder, an Friedhofskapellen Todten-
tänze und das jüngste Gericht, an Spitälern
die Werke der Barmherzigkeit, an Rath-
häusern die chistiria, Prudentia, ic,, in See-
städten den Seehandel mit großen Schiffen
und Seehelden dargestellt.
In Süddeutschland boten die sogenannten
Pausnamen — fast jedes Wohnhaus hatte
seinen eigenen Beinamen, z. B. „zur Rose,"
„zunr silbernen Brunnen," „zunr Glücksrad,"
— Anlaß zu beziehungsvollen Bildern; vergl.
das paus „zum Ritter" in Schaffhausen —
siehe oben —, „zum Goliath" in Regensburg,
mit seinenr Riesen, der einige Stockwerke hoch
sich reckt; bekannt ist auch der „weiße Adler"
in Stein anr Rhein (abgebildet in „Lambert &
Stahl, Motive der deutschen Architektur I.") rc.
Die großen Rathhausuhren, sowie die
sehr beliebten Sonnenuhren wurden gerrre
mit reicher Malerei umrahint; die vier Jahres-
zeiten, die menschlichen Lebensalter, auch
Sonne, Mond rnrd Sterne, sowie die Zeichen
des Thierkreises, Tag und Nacht, Leben und
Tod, und viele andere Motive verlockten zu
immer neuen Tompositionen.
Um all diese Bilder und Ornamente init
der Fenster- und Thürtheilung der Facade in
Einklang zu bringen, wurden architekton-
ische Vermittlungen nöthig, welche meist eben-
falls nur gemalt waren, während die wirklichen
Fenster und Thürumrahmungen aus einem
festen Material aus paustein oder Terracottä
gebildet wurden, wo es einigermaßen die
Buttel erlaubten. Die frühe Renaissance versteht es sehr glück-
lich, bei geschickter Flächentheilung eine leicht einrahmende,
inehr spielend gehaltene Architektur aufzumalen, init zarter
Andeutung der perspektivischen Seiten- und Unteransichten.
Uebrigens sind auch aus dem späteii Mittelalter derartige
architektonische Außenmalereien noch erhalten, beispielsweise
am Rathhause zu Ulm (Abbildung S. 2); bemerkens-
werth sind die gut genialten Schlagschatten.
Wie in den italienischen Bauten voii jeher, ent-
sprechend dein überlieferten monuinentalen Sinne der Aiitike,
eine große Regelmäßigkeit der Stockwerks- uiid Fenstertheilung
angestrebt wurde, während in Deutschland der
gesprochene Sinn des Mittelalters für malerische, unregel-
mäßige Gruppirung bis weit hinein in die Renaissancezeit
fortlebte, so spiegelt sich diese Verschiedenheit des nationalen
Geschiiiackes auch iit den Aompositionen der Facadenmalerei
wieder. Daß dabei gegenseitige Beeinflußungen nicht aus-
bleiben konnten, ist leicht erklärlich, wenn man an den regen
Verkehr denkt, welcher namentlich zwischen Süddeutschland
und Oberitalien seit dem Mittelalter bestand; jedoch wurde
der Grundzug der beiden Uunstcharaktere dadurch nicht ver-
wischt. Tin bezeichnendes Beispiel der italienischen Anordnung
aus-
Ooin Rathhaus zu Mühlhausen im Elsaß (vgl. S. 4 Spalte 2).
mit regelmäßiger Flächentheilung uitd einem großen ver-
bindenden Friese zeigt die farbige Wiedergabe des Palazzo
Murari, früher Fiorio della Seta, in Verona — Tafelp
Um die Gesammtwirkung der Facade sich zu vergegen-
wärtigen, ergänze man sich das Erdgeschoß als ^uaderbau
in gelbgrauer Steinfarbe uitd perspektivisch die dunkle Unter-
ansicht des Sparrengesimses. Die Fenstereinrahtnungen und
Gurtgesimse sind aus gelbgrauenr Ualkstein hergestellt. Die
Malereien rühren von Domenico del Riccio, genannt Brusa-
sorci (geb. her. Sein Zeitgenosse Vasari berichtet
darüber: „Domenico Riccio hat am Pause von Fiorio della
Seta in Verona, oberhalb der neuen Brücke,, drei Wände in