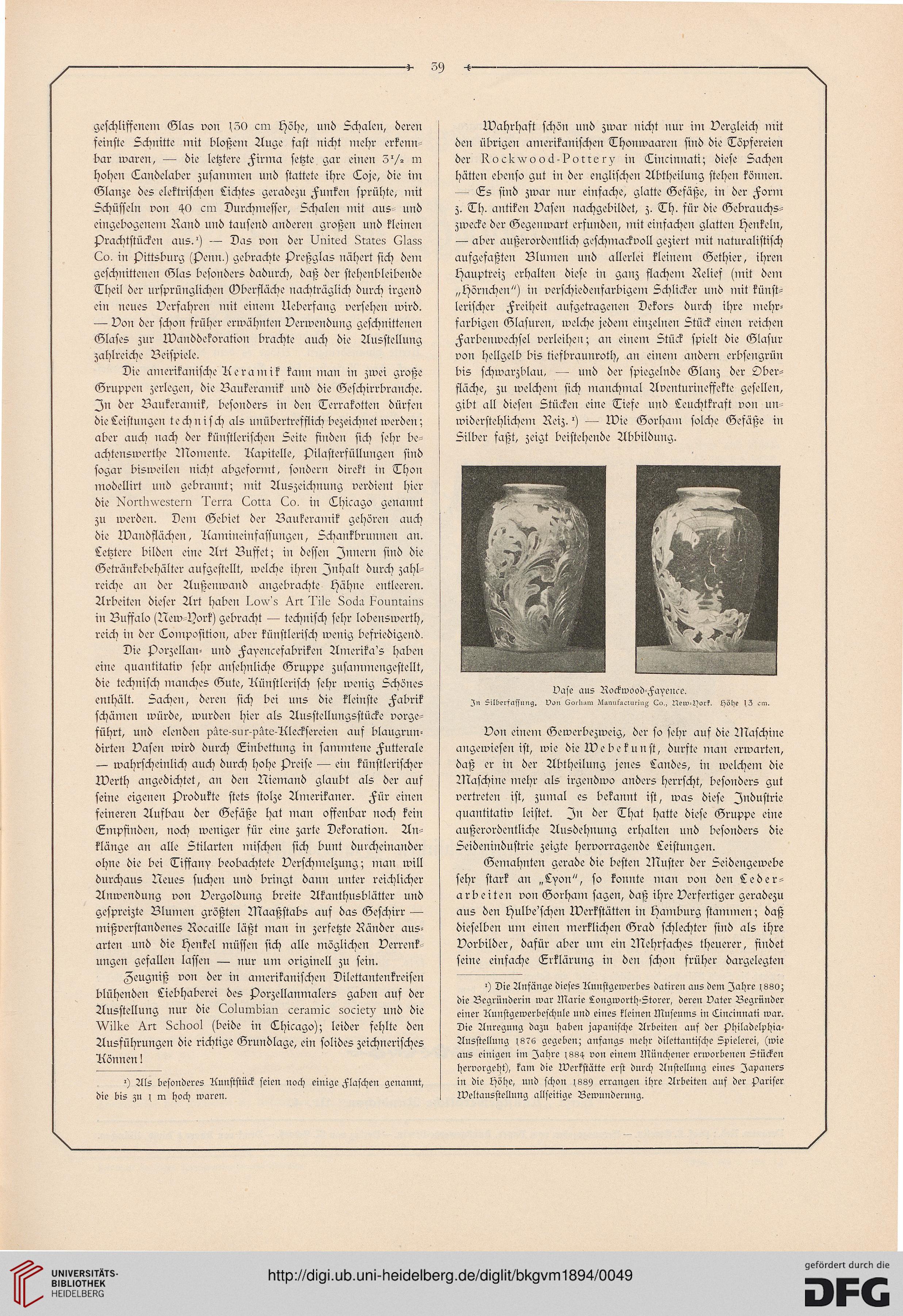/
4- 39
\
geschliffenem Glas von f30 cm höhe, und Schalen, deren
feinste Schnitte mit bloßem Auge fast nicht mehr erkenn-
bar waren, — die letztere Firma setzte gar einen 3'/- m
hohen Tandelaber zusammen und stattete ihre Gose, die tm
Glanze des elektrischen Lichtes geradezu Funken sprühte, mit
Schüsseln von 40 cm Durchmesser, Schalen mit aus- und
eingebogenem Rand und tausend anderen großen und kleinen
Prachtstücken aus.') — Das von der United States Glass
Co. in Pittsburg (penn.) gebrachte Preßglas nähert sich dem
geschnittenen Glas besonders dadurch, daß der stehenbleibende
Theil der ursprünglichen Oberfläche nachträglich durch irgend
ein neues Verfahren mit einem Ueberfang versehen wird.
— Von der schon früher erwähnten Verwendung geschnittenen
Glases zur Wanddekoration brachte auch die Ausstellung
zahlreiche Beispiele.
Die amerikanische Aeramik kann man in zwei große
Gruppen zerlegen, die Baukeramik und die Geschirrbranche.
In der Baukermnik, besonders in den Terrakotten dürfen
die Leistungen technisch als unübertrefflich bezeichnet werden:
aber auch nach der künstlerischen Seite finden sich sehr be-
achtenswertste Aloinente. Rapitelle, Pilasterfüllungen sind
sogar bisweilen nicht abgeformt, sondern direkt in Thon
modellirt und gebrannt; mit Auszeichnung verdient hier
die Northwestern Terra Cotta Co. in Thicago genannt
zu werden. Dem Gebiet der Baukeramik gehören auch
die Wandflächen, Ramineinfassungen, Schankbrunnen an.
Letztere bilden eine Art Buffet; in dessen Innern sind die
Getränkebehälter aufgestellt, welche ihren Inhalt durch zahl-
reiche an der Außenwand angebrachte pähne entleeren.
Arbeiten dieser Art haben Low s Art Tile Soda Fountains
in Buffalo (New-Pork) gebracht — technisch sehr lobenswertst,
reich in der Tomposition, aber künstlerisch wenig befriedigend.
Die Porzellan- und Fayencefabriken Amerika's haben
eine quantitativ sehr ansehnliche Gruppe zusammengestellt,
die technisch manches Gute, Rünstlcrisch sehr wenig Schönes
enthält. Sachen, deren sich bei uns die kleinste Fabrik
schämen würde, wurden hier als Ausstellungsstücke vorge-
führt, und elenden pate-su r-pate-Rlsckfsreien auf blaugrun-
dirten Vasen wird durch Einbettung in sammtene Futterale
— wahrscheinlich auch durch hohe Preise — ein künstlerischer
Werth angedichtet, an den Niemand glaubt als der auf
seine eigenen Produkte stets stolze Amerikaner. Für einen
feineren Ausbau der Gefäße hat inan offenbar noch kein
Empfinden, noch weniger für eine zarte Dekoration. An-
klänge ait alle Stilarten mischen sich bunt durcheinander
ohne die bei Tiffany beobachtete Verschmelzung; man will
durchaus Neues suchen und bringt dann unter reichlicher
Anwendung von Vergoldung breite Akanthusblätter und
gespreizte Blumen größten Maaßstabs auf das Geschirr —
mißverstandenes Rocaille läßt man in zersetzte Ränder aus-
arten und die penkel müssen sich alle möglichen Verrenk-
ungen gefallen lassen — nur um originell zu sein.
Zeugniß von der in amerikanischen Dilettantenkreisen
blühenden Liebhaberei des Porzellanmalers gaben auf der
Ausstellung nur die Columbian ceramic society und die
Wilke Art School (beide in Thicago); leider fehlte den
Ausführungen die richtige Grundlage, ein solides zeichnerisches
Rönnen!
-) Als besonderes. Aunststück seien noch einige Flaschen genormt,
die bis zn ; m hoch waren.
X_
Wahrhaft schön und zwar nicht nur im Vergleich mit
den übrigen amerikanischen Thonwaaren siitd die Töpfereien
der Rockwood-Pottery in Tincinnati; diese Sachen
hätten ebenso gut in der englischen Abtheilung stehen können.
Es sind zwar nur einfache, glatte Gefäße, in der Form
z. Th. antiken Vasen nachgebildet, z. Th. für die Gebrauchs-
zwecke der Gegenwart erfunden, mit einfachen glatten penkeln,
— aber außerordentlich geschmackvoll geziert nrit naturalistisch
aufgesaßten Blurnen und allerlei kleinem Gethier, ihren
Pauptreiz erhalten diese in ganz flachem Relief (ntit dem
„pörnchen") in verschiedenfarbigem Schlicker und nrit künst-
lerischer Freiheit aufgetragenen Dekors durch ihre mehr-
farbigen Glasuren, welche jedem einzelnen Stück einen reichen
Farbenwechsel verleihen; an einem Stück spielt die Glasur
von hellgelb bis tiefbraunroth, an einem andern erbsengrün
bis schwarzblau, — und der spiegelnde Glanz der Ober-
fläche, zu welchem sich manchmal Aventurineffekte gesellen,
gibt all diesen Stücken eine Tiefe und Leuchtkraft von un-
widerstehlichein Reiz. *) — Wie Gorham solche Gefäße in
Silber saßt, zeigt beistehende Abbildung.
Vase aus Rockwood-Fayence.
In Gilbet fassnng. Don Gorham Manufacturing Co., Nerv-^ork. Höhe J3 cm.
Von einem Gewerbezweig, der so sehr auf die Maschine
angewiesen ist, wie die Webekunst, durfte man erwarten,
daß er in der Abtheilung jenes Landes, in welchem die
Maschine mehr als irgendwo anders herrscht, besonders gut
vertreten ist, zumal es bekamtt ist, was diese Industrie
quantitativ leistet. In der That hatte diese Gruppe eilte
außerordentliche Ausdehnung erhalten und besonders die
Seidenindustrie zeigte hervorragende Leistungen.
Gemahnten gerade die besten Wüster der Seidengewebe
sehr stark an „Lyon", so konnte man von den Leder-
arbeiten von Gorham sagen, daß ihre Verfertiger geradezu
aus den lhulbe'schen Werkstätten in Hamburg stammen; daß
dieselben um eilten merklichen Grad schlechter sind als ihre
Vorbilder, dafür aber um ein Mehrfaches theuerer, flitdet
feine einfache Erklärung in den fchoit früher dargelegten
9 Die Anfänge dieses Aunstgewerbes datiren aus dem Jahre ;880;
die Begründerin war Marie Longworth-Storer, deren Vater Begründer
einer Aunstgewerbeschulo und eines kleinen Museums nt Cincinnati war.
Die Anregung dazu haben japanische Arbeiten auf der Philadelphia-
Ausstellung ;876 gegeben; anfangs mehr dilettantische Spielerei, (wie
aus einigen im Jahre ;88<t von einem Münchener erworbenen Stücken
hervorgcht), kam die Werkstätte erst durch Anstellung eines Japaners
in die bjöhe, und schon ;88J errangen ihre Arbeiten auf der pariser
Weltausstellung allseitige Bewunderung.
/
4- 39
\
geschliffenem Glas von f30 cm höhe, und Schalen, deren
feinste Schnitte mit bloßem Auge fast nicht mehr erkenn-
bar waren, — die letztere Firma setzte gar einen 3'/- m
hohen Tandelaber zusammen und stattete ihre Gose, die tm
Glanze des elektrischen Lichtes geradezu Funken sprühte, mit
Schüsseln von 40 cm Durchmesser, Schalen mit aus- und
eingebogenem Rand und tausend anderen großen und kleinen
Prachtstücken aus.') — Das von der United States Glass
Co. in Pittsburg (penn.) gebrachte Preßglas nähert sich dem
geschnittenen Glas besonders dadurch, daß der stehenbleibende
Theil der ursprünglichen Oberfläche nachträglich durch irgend
ein neues Verfahren mit einem Ueberfang versehen wird.
— Von der schon früher erwähnten Verwendung geschnittenen
Glases zur Wanddekoration brachte auch die Ausstellung
zahlreiche Beispiele.
Die amerikanische Aeramik kann man in zwei große
Gruppen zerlegen, die Baukeramik und die Geschirrbranche.
In der Baukermnik, besonders in den Terrakotten dürfen
die Leistungen technisch als unübertrefflich bezeichnet werden:
aber auch nach der künstlerischen Seite finden sich sehr be-
achtenswertste Aloinente. Rapitelle, Pilasterfüllungen sind
sogar bisweilen nicht abgeformt, sondern direkt in Thon
modellirt und gebrannt; mit Auszeichnung verdient hier
die Northwestern Terra Cotta Co. in Thicago genannt
zu werden. Dem Gebiet der Baukeramik gehören auch
die Wandflächen, Ramineinfassungen, Schankbrunnen an.
Letztere bilden eine Art Buffet; in dessen Innern sind die
Getränkebehälter aufgestellt, welche ihren Inhalt durch zahl-
reiche an der Außenwand angebrachte pähne entleeren.
Arbeiten dieser Art haben Low s Art Tile Soda Fountains
in Buffalo (New-Pork) gebracht — technisch sehr lobenswertst,
reich in der Tomposition, aber künstlerisch wenig befriedigend.
Die Porzellan- und Fayencefabriken Amerika's haben
eine quantitativ sehr ansehnliche Gruppe zusammengestellt,
die technisch manches Gute, Rünstlcrisch sehr wenig Schönes
enthält. Sachen, deren sich bei uns die kleinste Fabrik
schämen würde, wurden hier als Ausstellungsstücke vorge-
führt, und elenden pate-su r-pate-Rlsckfsreien auf blaugrun-
dirten Vasen wird durch Einbettung in sammtene Futterale
— wahrscheinlich auch durch hohe Preise — ein künstlerischer
Werth angedichtet, an den Niemand glaubt als der auf
seine eigenen Produkte stets stolze Amerikaner. Für einen
feineren Ausbau der Gefäße hat inan offenbar noch kein
Empfinden, noch weniger für eine zarte Dekoration. An-
klänge ait alle Stilarten mischen sich bunt durcheinander
ohne die bei Tiffany beobachtete Verschmelzung; man will
durchaus Neues suchen und bringt dann unter reichlicher
Anwendung von Vergoldung breite Akanthusblätter und
gespreizte Blumen größten Maaßstabs auf das Geschirr —
mißverstandenes Rocaille läßt man in zersetzte Ränder aus-
arten und die penkel müssen sich alle möglichen Verrenk-
ungen gefallen lassen — nur um originell zu sein.
Zeugniß von der in amerikanischen Dilettantenkreisen
blühenden Liebhaberei des Porzellanmalers gaben auf der
Ausstellung nur die Columbian ceramic society und die
Wilke Art School (beide in Thicago); leider fehlte den
Ausführungen die richtige Grundlage, ein solides zeichnerisches
Rönnen!
-) Als besonderes. Aunststück seien noch einige Flaschen genormt,
die bis zn ; m hoch waren.
X_
Wahrhaft schön und zwar nicht nur im Vergleich mit
den übrigen amerikanischen Thonwaaren siitd die Töpfereien
der Rockwood-Pottery in Tincinnati; diese Sachen
hätten ebenso gut in der englischen Abtheilung stehen können.
Es sind zwar nur einfache, glatte Gefäße, in der Form
z. Th. antiken Vasen nachgebildet, z. Th. für die Gebrauchs-
zwecke der Gegenwart erfunden, mit einfachen glatten penkeln,
— aber außerordentlich geschmackvoll geziert nrit naturalistisch
aufgesaßten Blurnen und allerlei kleinem Gethier, ihren
Pauptreiz erhalten diese in ganz flachem Relief (ntit dem
„pörnchen") in verschiedenfarbigem Schlicker und nrit künst-
lerischer Freiheit aufgetragenen Dekors durch ihre mehr-
farbigen Glasuren, welche jedem einzelnen Stück einen reichen
Farbenwechsel verleihen; an einem Stück spielt die Glasur
von hellgelb bis tiefbraunroth, an einem andern erbsengrün
bis schwarzblau, — und der spiegelnde Glanz der Ober-
fläche, zu welchem sich manchmal Aventurineffekte gesellen,
gibt all diesen Stücken eine Tiefe und Leuchtkraft von un-
widerstehlichein Reiz. *) — Wie Gorham solche Gefäße in
Silber saßt, zeigt beistehende Abbildung.
Vase aus Rockwood-Fayence.
In Gilbet fassnng. Don Gorham Manufacturing Co., Nerv-^ork. Höhe J3 cm.
Von einem Gewerbezweig, der so sehr auf die Maschine
angewiesen ist, wie die Webekunst, durfte man erwarten,
daß er in der Abtheilung jenes Landes, in welchem die
Maschine mehr als irgendwo anders herrscht, besonders gut
vertreten ist, zumal es bekamtt ist, was diese Industrie
quantitativ leistet. In der That hatte diese Gruppe eilte
außerordentliche Ausdehnung erhalten und besonders die
Seidenindustrie zeigte hervorragende Leistungen.
Gemahnten gerade die besten Wüster der Seidengewebe
sehr stark an „Lyon", so konnte man von den Leder-
arbeiten von Gorham sagen, daß ihre Verfertiger geradezu
aus den lhulbe'schen Werkstätten in Hamburg stammen; daß
dieselben um eilten merklichen Grad schlechter sind als ihre
Vorbilder, dafür aber um ein Mehrfaches theuerer, flitdet
feine einfache Erklärung in den fchoit früher dargelegten
9 Die Anfänge dieses Aunstgewerbes datiren aus dem Jahre ;880;
die Begründerin war Marie Longworth-Storer, deren Vater Begründer
einer Aunstgewerbeschulo und eines kleinen Museums nt Cincinnati war.
Die Anregung dazu haben japanische Arbeiten auf der Philadelphia-
Ausstellung ;876 gegeben; anfangs mehr dilettantische Spielerei, (wie
aus einigen im Jahre ;88<t von einem Münchener erworbenen Stücken
hervorgcht), kam die Werkstätte erst durch Anstellung eines Japaners
in die bjöhe, und schon ;88J errangen ihre Arbeiten auf der pariser
Weltausstellung allseitige Bewunderung.
/