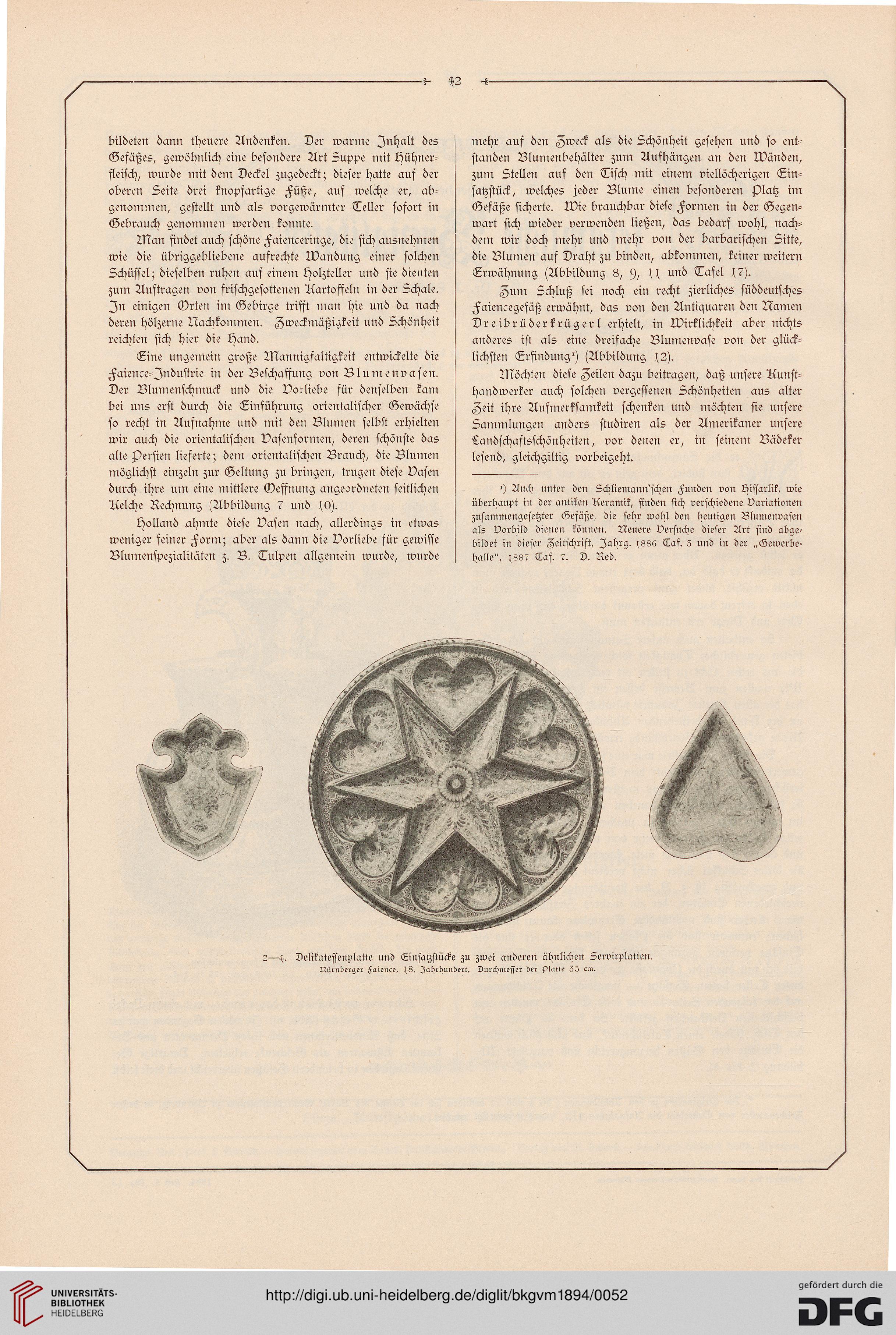■5- ^2 •*
\
bildeten dann theuere Andenken. Der warme Inhalt des
Gefäßes, gewöhnlich eine besondere Art Suppe mit pühner-
fleisch, wurde mit den: Deckel zugedeckt; dieser hatte auf der
oberen Seite drei knopsartige Füße, aus welche er, ab-
genommen, gestellt und als vorgewärmter Teller sofort in
Gebrauch genommen werden konnte.
Man findet auch schöne Faienceringe, die sich ausnehmen
wie die übriggebliebene aufrechte Wandung einer solchen
Schüssel; dieselben ruhen auf einem polzteller und sie dienten
zunr Aufträgen von frischgesottenen Aartoffeln in der Schale.
In einigen Vrten im Gebirge trifft man hie und da nach
deren hölzerne Nachkommen. Zweckmäßigkeit und Schönheit
reichten sich hier die pand.
Tine ungemein große Mannigfaltigkeit entwickelte die
Faience-Industrie in der Beschaffung von Blumenvasen.
Der Blumenschmuck und die Vorliebe für denselben kam
bei uns erst durch die Einführung orientalischer Gewächse
so recht in Ausnahme uud mit den Blumen selbst erhielten
wir auch die orientalischen Vasenformen, deren schönste das
alte Persien lieferte; dem orientalischen Brauch, die Blumen
möglichst einzeln zur Geltung zu bringen, trugen diese Vasen
durch ihre um eine mittlere Oeffnung angeordneten seitlichen
Aelche Rechnung (Abbildung 7 und HO).
polland ahmte diese Vasen nach, allerdings in etwas
weniger feiner Form; aber als dann die Vorliebe für gewisse
Blumenspezialitäten z. B. Tulpen allgemein wurde, wurde
mehr auf den Zweck als die Schönheit gesehen und so ent-
standen Blumenbehälter zuin Aushängen an den Wänden,
zum Stellen aus den Tisch mit einem viellöcherigen Ein-
satzstück, welches jeder Blume einen besonderen Platz im
Gefäße sicherte. Wie brauchbar diese Formen in der Gegen-
wart sich wieder verwenden ließen, das bedarf wohl, nach-
dem wir doch mehr und mehr von der barbarischen Sitte,
die Blumen auf Draht zu binden, abkommen, keiner weitern
Erwähnung (Abbildung 8, st, U und Tafel s7).
Zum Schluß sei noch ein recht zierliches süddeutsches
Faiencegefäß erwähnt, das von den Antiquaren den Nanien
Dreibrüderkrügerl erhielt, in Wirklichkeit aber nichts
anderes ist als eine dreifache Blumenvase von der glück-
lichsten Erfindung') (Abbildung s2).
Möchten diese Zeilen dazu beitragen, daß unsere Aunst-
handwerker auch solchen vergessenen Schönheiten aus alter
Zeit ihre Aufmerksamkeit schenken und möchten sie unsere
Lainmlungen anders studiren als der Amerikaner unsere
Landschaftsschönheiten, vor denen er, in seinen: Bädeker
lesend, gleichgiltig vorbeigeht.
st Auch unter den Schliemann'schen Funden von Vissarlik, wie
überhaupt in der antiken Keramik, finden sich verschiedene Variationen
zusammengesetzter Gesäße, die sehr wohl den heutigen Blumenvasen
als Vorbild dienen können. Neuere Versuche dieser Art sind abge-
bildet in dieser Zeitschrift, Iahrg. ;886 Taf. 3 und in der „Gewerbe-
hallest ;887 Taf. 7. D. Red.
2—Velikatessenxlatte und Linsatzstücke zu zwei anderen ähnlichen Servirplatten.
Nürnberger Faience, ^8. Jahrhundert. Durchmesser der Platte 35 cm.
\
bildeten dann theuere Andenken. Der warme Inhalt des
Gefäßes, gewöhnlich eine besondere Art Suppe mit pühner-
fleisch, wurde mit den: Deckel zugedeckt; dieser hatte auf der
oberen Seite drei knopsartige Füße, aus welche er, ab-
genommen, gestellt und als vorgewärmter Teller sofort in
Gebrauch genommen werden konnte.
Man findet auch schöne Faienceringe, die sich ausnehmen
wie die übriggebliebene aufrechte Wandung einer solchen
Schüssel; dieselben ruhen auf einem polzteller und sie dienten
zunr Aufträgen von frischgesottenen Aartoffeln in der Schale.
In einigen Vrten im Gebirge trifft man hie und da nach
deren hölzerne Nachkommen. Zweckmäßigkeit und Schönheit
reichten sich hier die pand.
Tine ungemein große Mannigfaltigkeit entwickelte die
Faience-Industrie in der Beschaffung von Blumenvasen.
Der Blumenschmuck und die Vorliebe für denselben kam
bei uns erst durch die Einführung orientalischer Gewächse
so recht in Ausnahme uud mit den Blumen selbst erhielten
wir auch die orientalischen Vasenformen, deren schönste das
alte Persien lieferte; dem orientalischen Brauch, die Blumen
möglichst einzeln zur Geltung zu bringen, trugen diese Vasen
durch ihre um eine mittlere Oeffnung angeordneten seitlichen
Aelche Rechnung (Abbildung 7 und HO).
polland ahmte diese Vasen nach, allerdings in etwas
weniger feiner Form; aber als dann die Vorliebe für gewisse
Blumenspezialitäten z. B. Tulpen allgemein wurde, wurde
mehr auf den Zweck als die Schönheit gesehen und so ent-
standen Blumenbehälter zuin Aushängen an den Wänden,
zum Stellen aus den Tisch mit einem viellöcherigen Ein-
satzstück, welches jeder Blume einen besonderen Platz im
Gefäße sicherte. Wie brauchbar diese Formen in der Gegen-
wart sich wieder verwenden ließen, das bedarf wohl, nach-
dem wir doch mehr und mehr von der barbarischen Sitte,
die Blumen auf Draht zu binden, abkommen, keiner weitern
Erwähnung (Abbildung 8, st, U und Tafel s7).
Zum Schluß sei noch ein recht zierliches süddeutsches
Faiencegefäß erwähnt, das von den Antiquaren den Nanien
Dreibrüderkrügerl erhielt, in Wirklichkeit aber nichts
anderes ist als eine dreifache Blumenvase von der glück-
lichsten Erfindung') (Abbildung s2).
Möchten diese Zeilen dazu beitragen, daß unsere Aunst-
handwerker auch solchen vergessenen Schönheiten aus alter
Zeit ihre Aufmerksamkeit schenken und möchten sie unsere
Lainmlungen anders studiren als der Amerikaner unsere
Landschaftsschönheiten, vor denen er, in seinen: Bädeker
lesend, gleichgiltig vorbeigeht.
st Auch unter den Schliemann'schen Funden von Vissarlik, wie
überhaupt in der antiken Keramik, finden sich verschiedene Variationen
zusammengesetzter Gesäße, die sehr wohl den heutigen Blumenvasen
als Vorbild dienen können. Neuere Versuche dieser Art sind abge-
bildet in dieser Zeitschrift, Iahrg. ;886 Taf. 3 und in der „Gewerbe-
hallest ;887 Taf. 7. D. Red.
2—Velikatessenxlatte und Linsatzstücke zu zwei anderen ähnlichen Servirplatten.
Nürnberger Faience, ^8. Jahrhundert. Durchmesser der Platte 35 cm.