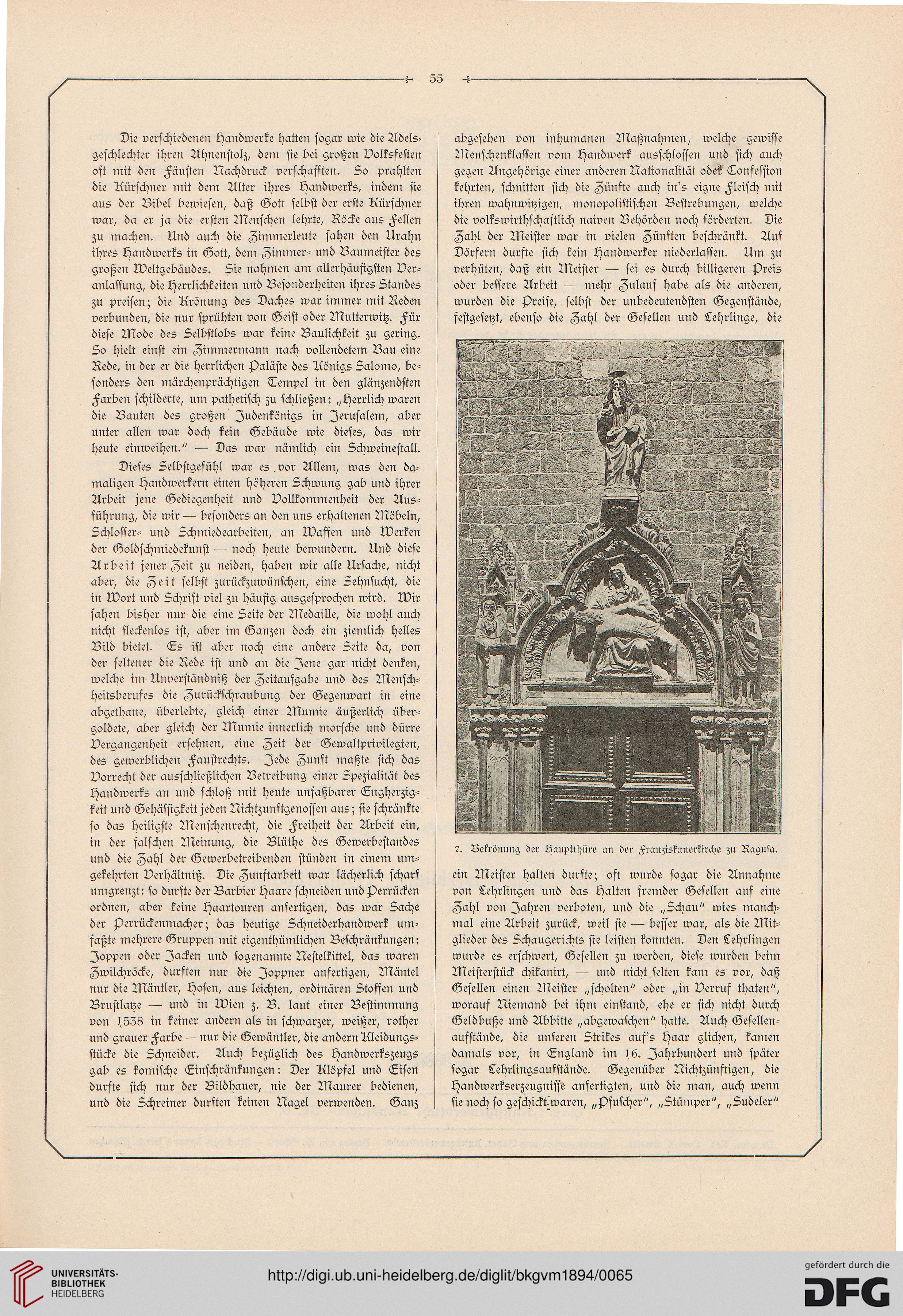Sie verschiedenen Handwerke hatten sogar wie die Adels-
geschlechter ihren Ahnenstolz, dein sie bei großen Volksfesten
oft mit den Fäusten Nachdruck verschafften. So prahlten
die Kürschner mit dem Alter ihres Handwerks, indem sie
aus der Bibel bewiesen, daß Gott selbst der erste Kürschner
war, da er ja die ersten Menschen lehrte, Böcke aus Fellen
zu machen. Und auch die Zimmerleute sahen den Urahn
ihres Handwerks in Gott, den: Zimmer- und Baumeister des
großen U)eltgebäudes. Sie nahmen an: allerhäufigsten Ver-
anlassung, die Herrlichkeiten und Besonderheiten ihres Standes
zu preisen; die Krönung des Daches war immer mit Reden
verbunden, die nur sprühten von Geist oder Mutterwitz. Für
diese Mode des Selbstlobs war keine Baulichkeit zu gering.
So hielt einst ein Zimmermann nach vollendetem Bau eine
Rede, in der er die herrlichen Paläste des Königs Salomo, be-
sonders den märchenprächtigen Tempel in den glänzendsten
Farben schilderte, um pathetisch zu schließen: „Herrlich waren
die Bauten des großen Zudenkönigs in Jerusalem, aber
unter allen war doch kein Gebäude wie dieses, das wir
heute einweihen." — Das war nämlich ein Schweinestall.
Dieses Selbstgefühl war es vor Allem, was den da-
maligen Handwerkern einen höheren Schwung gab und ihrer
Arbeit jene Gediegenheit und Vollkommenheit der Aus-
führung, die wir — besonders an den uns erhaltenen Möbeln,
Schlosser- und Schmiedearbeiten, an Waffen und Werken
der Goldschiniedekunst — noch heute bewundern. Und diese
Arbeit jener Zeit zu neiden, haben wir alle Ursache, nicht
aber, die Zeit selbst zurückzuwünschen, eine Sehnsucht, die
in Wort und Schrift viel zu häufig ausgesprochen wird. Wir
sahen bisher nur die eine Seite der Medaille, die wohl auch
nicht fleckenlos ist, aber iin Ganzen doch ein ziemlich Helles
Bild bietet. Es ist aber noch eine andere Seite da, von
der seltener die Rede ist und an die Jene gar nicht denken,
welche im Unverständniß der Zeitaufgabe und des Mensch-
heitsberufes die Zurückschraubung der Gegenwart in eine
abgethane, überlebte, gleich einer Mumie äußerlich über-
goldete, aber gleich der Mumie innerlich morsche und dürre
Vergangenheit ersehnen, eine Zeit der Gewaltprivilegien,
des gewerblichen Faustrechts. Jede Zunft maßte sich das
Vorrecht der ausschließlichen Betreibung einer Spezialität des
Handwerks an und schloß mit heute unfaßbarer Engherzig-
keit und Gehässigkeit jeden Nichtzunftgenossen aus; sie schränkte
so das heiligste Menschenrecht, die Freiheit der Arbeit ein,
in der falschen Meinung, die Blüthe des Gewerbestandes
und die Zahl der Gewerbetreibenden stünden in einem um-
gekehrten Verhältniß. Die Zunftarbeit war lächerlich scharf
umgrenzt: so durfte der Barbier Haare schneiden und Perrücken
ordnen, aber keine Haartouren anfertigen, das war Sache
der Perrückenmacher; das heutige Schneiderhandwerk um-
faßte mehrere Gruppen mit eigenthüinlichen Beschränkungen:
Joppen oder Zacken und sogenannte Nestelkittel, das waren
Zwilchröcke, durften nur die Zoppner anfertigen, Mäntel
nur die Mäntler, Hosen, aus leichten, ordinären Stoffen und
Brustlätze — und in Wien z. B. laut einer Bestimmung
von j538 in keiner andern als in schwarzer, weißer, rother
und grauer Farbe — nur die Gewäntler, die andern Kleidungs-
stücke die Schneider. Auch bezüglich des Handwerkszeugs
gab es kölnische Einschränkungen: Der Klöpfel und Eisen
durfte sich nur der Bildhauer, nie der Maurer bedienen,
und die Schreiner durften keinen Nagel verwenden. Ganz
abgesehen von inhumanen Maßnahmen, welche gewisse
Menschenklassen von: Handwerk ausschlossen und sich auch
gegen Angehörige einer anderen Nationalität odeL Eonfession
kehrten, schnitten sich die Zünfte auch in's eigne Fleisch mit
ihren wahnwitzigen, monopolistischen Bestrebungen, welche
die volkswirthschaftlich naiven Behörden noch förderten. Die
Zahl der Meister war in vielen Zünften beschränkt. Auf
Dörfern durfte sich kein Handwerker niederlassen. Um zu
verhüten, daß ein Meister — sei es durch billigeren Preis
oder bessere Arbeit — mehr Zulauf habe als die anderen,
wurden die Preise, selbst der unbedeutendsten Gegenstände,
festgesetzt, ebenso die Zahl der Gesellen und Lehrlinge, die
»\?*j
7. Bekrönung der hauptthüre an der Franziskanerkirche zn Ragusa.
ein Meister halten durfte; oft wurde sogar die Annahme
von Lehrlingen und das Halten fremder Gesellen auf eine
Zahl von Zähren verboten, und die „Schau" wies manch-
mal eine Arbeit zurück, weil sie — besser war, als die Mit-
glieder des Schaugerichts sie leisten konnten. Den Lehrlingen
wurde es erschwert, Gesellen zu werden, diese wurden beim
Meisterstück chikanirt, — und nicht selten kanr es vor, daß
Gesellen einen Meister „schölten" oder „in Verruf thaten",
worauf Niemand bei ihn: einstand, ehe er sich nicht durch
Geldbuße und Abbitte „abgewaschen" hatte. Auch Gesellen-
aufstände, die unseren Strikes auf's Haar glichen, kanren
danrals vor, in England in: f6. Zahrhundert und später
sogar Lehrlingsausstände. Gegenüber Nichtzünstigen, die
Handwerkserzeugnisse anfertigten, und die man, auch wenn
sie noch so geschickflwaren, „Pfuscher", „Stümper", „Sudeler"
geschlechter ihren Ahnenstolz, dein sie bei großen Volksfesten
oft mit den Fäusten Nachdruck verschafften. So prahlten
die Kürschner mit dem Alter ihres Handwerks, indem sie
aus der Bibel bewiesen, daß Gott selbst der erste Kürschner
war, da er ja die ersten Menschen lehrte, Böcke aus Fellen
zu machen. Und auch die Zimmerleute sahen den Urahn
ihres Handwerks in Gott, den: Zimmer- und Baumeister des
großen U)eltgebäudes. Sie nahmen an: allerhäufigsten Ver-
anlassung, die Herrlichkeiten und Besonderheiten ihres Standes
zu preisen; die Krönung des Daches war immer mit Reden
verbunden, die nur sprühten von Geist oder Mutterwitz. Für
diese Mode des Selbstlobs war keine Baulichkeit zu gering.
So hielt einst ein Zimmermann nach vollendetem Bau eine
Rede, in der er die herrlichen Paläste des Königs Salomo, be-
sonders den märchenprächtigen Tempel in den glänzendsten
Farben schilderte, um pathetisch zu schließen: „Herrlich waren
die Bauten des großen Zudenkönigs in Jerusalem, aber
unter allen war doch kein Gebäude wie dieses, das wir
heute einweihen." — Das war nämlich ein Schweinestall.
Dieses Selbstgefühl war es vor Allem, was den da-
maligen Handwerkern einen höheren Schwung gab und ihrer
Arbeit jene Gediegenheit und Vollkommenheit der Aus-
führung, die wir — besonders an den uns erhaltenen Möbeln,
Schlosser- und Schmiedearbeiten, an Waffen und Werken
der Goldschiniedekunst — noch heute bewundern. Und diese
Arbeit jener Zeit zu neiden, haben wir alle Ursache, nicht
aber, die Zeit selbst zurückzuwünschen, eine Sehnsucht, die
in Wort und Schrift viel zu häufig ausgesprochen wird. Wir
sahen bisher nur die eine Seite der Medaille, die wohl auch
nicht fleckenlos ist, aber iin Ganzen doch ein ziemlich Helles
Bild bietet. Es ist aber noch eine andere Seite da, von
der seltener die Rede ist und an die Jene gar nicht denken,
welche im Unverständniß der Zeitaufgabe und des Mensch-
heitsberufes die Zurückschraubung der Gegenwart in eine
abgethane, überlebte, gleich einer Mumie äußerlich über-
goldete, aber gleich der Mumie innerlich morsche und dürre
Vergangenheit ersehnen, eine Zeit der Gewaltprivilegien,
des gewerblichen Faustrechts. Jede Zunft maßte sich das
Vorrecht der ausschließlichen Betreibung einer Spezialität des
Handwerks an und schloß mit heute unfaßbarer Engherzig-
keit und Gehässigkeit jeden Nichtzunftgenossen aus; sie schränkte
so das heiligste Menschenrecht, die Freiheit der Arbeit ein,
in der falschen Meinung, die Blüthe des Gewerbestandes
und die Zahl der Gewerbetreibenden stünden in einem um-
gekehrten Verhältniß. Die Zunftarbeit war lächerlich scharf
umgrenzt: so durfte der Barbier Haare schneiden und Perrücken
ordnen, aber keine Haartouren anfertigen, das war Sache
der Perrückenmacher; das heutige Schneiderhandwerk um-
faßte mehrere Gruppen mit eigenthüinlichen Beschränkungen:
Joppen oder Zacken und sogenannte Nestelkittel, das waren
Zwilchröcke, durften nur die Zoppner anfertigen, Mäntel
nur die Mäntler, Hosen, aus leichten, ordinären Stoffen und
Brustlätze — und in Wien z. B. laut einer Bestimmung
von j538 in keiner andern als in schwarzer, weißer, rother
und grauer Farbe — nur die Gewäntler, die andern Kleidungs-
stücke die Schneider. Auch bezüglich des Handwerkszeugs
gab es kölnische Einschränkungen: Der Klöpfel und Eisen
durfte sich nur der Bildhauer, nie der Maurer bedienen,
und die Schreiner durften keinen Nagel verwenden. Ganz
abgesehen von inhumanen Maßnahmen, welche gewisse
Menschenklassen von: Handwerk ausschlossen und sich auch
gegen Angehörige einer anderen Nationalität odeL Eonfession
kehrten, schnitten sich die Zünfte auch in's eigne Fleisch mit
ihren wahnwitzigen, monopolistischen Bestrebungen, welche
die volkswirthschaftlich naiven Behörden noch förderten. Die
Zahl der Meister war in vielen Zünften beschränkt. Auf
Dörfern durfte sich kein Handwerker niederlassen. Um zu
verhüten, daß ein Meister — sei es durch billigeren Preis
oder bessere Arbeit — mehr Zulauf habe als die anderen,
wurden die Preise, selbst der unbedeutendsten Gegenstände,
festgesetzt, ebenso die Zahl der Gesellen und Lehrlinge, die
»\?*j
7. Bekrönung der hauptthüre an der Franziskanerkirche zn Ragusa.
ein Meister halten durfte; oft wurde sogar die Annahme
von Lehrlingen und das Halten fremder Gesellen auf eine
Zahl von Zähren verboten, und die „Schau" wies manch-
mal eine Arbeit zurück, weil sie — besser war, als die Mit-
glieder des Schaugerichts sie leisten konnten. Den Lehrlingen
wurde es erschwert, Gesellen zu werden, diese wurden beim
Meisterstück chikanirt, — und nicht selten kanr es vor, daß
Gesellen einen Meister „schölten" oder „in Verruf thaten",
worauf Niemand bei ihn: einstand, ehe er sich nicht durch
Geldbuße und Abbitte „abgewaschen" hatte. Auch Gesellen-
aufstände, die unseren Strikes auf's Haar glichen, kanren
danrals vor, in England in: f6. Zahrhundert und später
sogar Lehrlingsausstände. Gegenüber Nichtzünstigen, die
Handwerkserzeugnisse anfertigten, und die man, auch wenn
sie noch so geschickflwaren, „Pfuscher", „Stümper", „Sudeler"