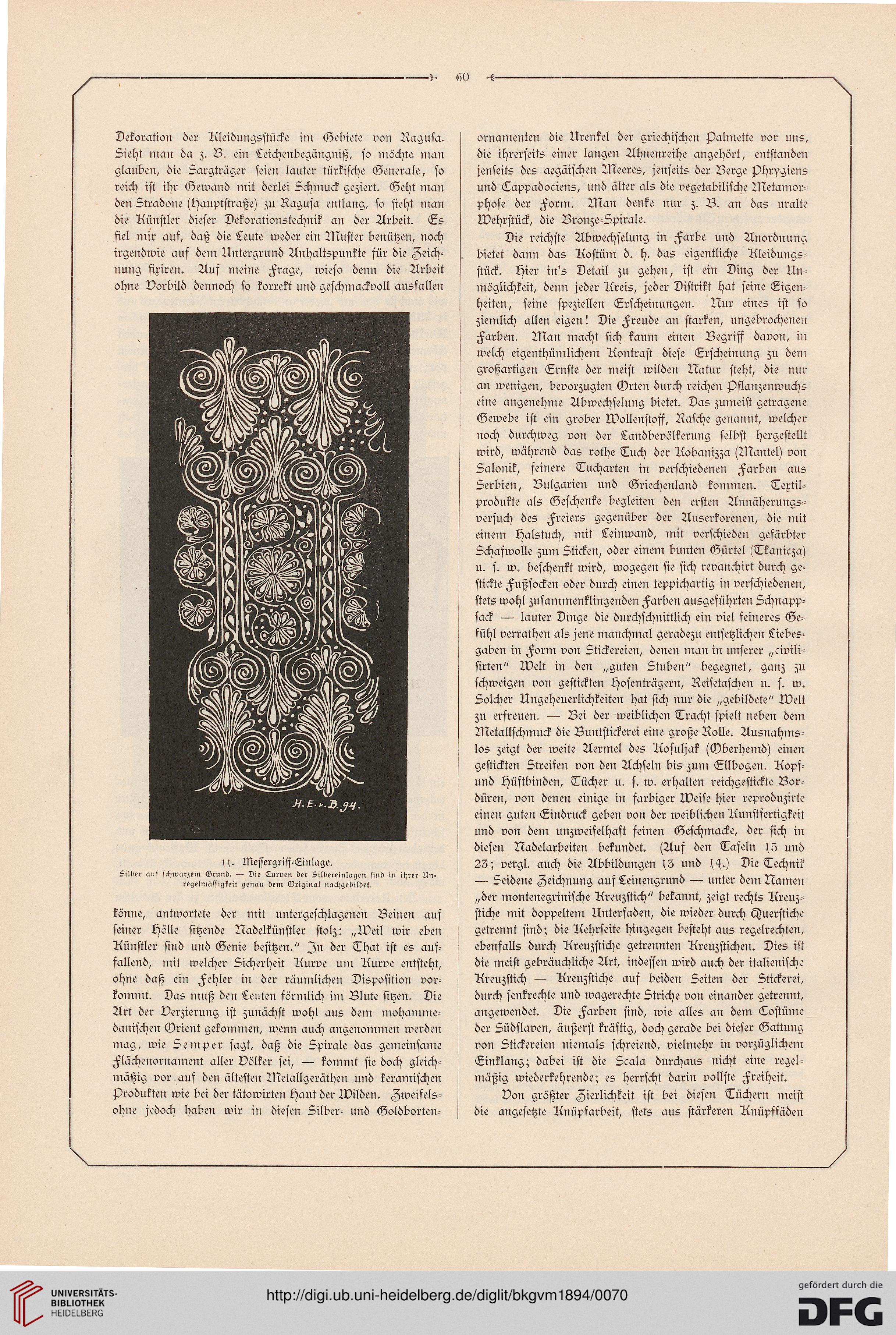■t- 60 -£■
/
\
Dekoration der Kleidungsstücke im Gebiete von Ragusa.
Sieht man da z. B. ein Leichenbegängniß, so möchte man
glauben, die Sargträger seien lauter türkische Generale, so
reich ist ihr Gewand mit derlei Schmuck geziert. Geht inan
den Stradone Hauptstraße) zu Ragusa entlang, so sieht man
die Aünstler dieser Dekorationstechnik an der Arbeit. (Es
fiel mir auf, daß die Leute weder ein Muster benützen, noch
irgendwie auf dem Untergrund Anhaltspunkte für die Zeich-
nung fixiren. Auf meine Frage, wieso denn die Arbeit
ohne Vorbild dennoch so korrekt und geschmackvoll ausfallen
l ;. Meffergriff-Linlage.
Silber auf schwarzem Grund. — Die Lurven der Silbereinlagen sind in ihrer Un-
regelmässigkeit genau dem Original nachgebildet.
könne, antwortete der mit untergeschlagenen Beinen auf
seiner Hölle sitzende Nadelkünstler stolz: „N)eil wir eben
Aünstler sind und Genie besitzen." In der That ist es auf-
fallend, mit welcher Sicherheit Aurve um Aurve entsteht,
ohne daß ein Fehler in der räumlichen Disposition vor-
konmit. Das muß den Leuten förmlich im Blute sitzen. Die
Art der Verzierung ist zunächst wohl aus dem mohamme
dänischen Grient gekommen, wenn auch angenommen werden
mag, wie Semper sagt, daß die Spirale das gemeinsame
Flächenornament aller Völker sei, — kommt sie doch gleich-
mäßig vor auf den ältesten Metallgeräthen und keramischen
Produkten wie bei der tätowirten haut der Wilden. Zweifels-
ohne jedoch haben wir in diesen Silber- und Goldborten-
ornamenten die Urenkel der griechischen Palmette vor uns,
die ihrerseits einer langen Ahnenreihe angehört, entstanden
jenseits des aegäischen Meeres, jenseits der Berge Phrygiens
und Tappadociens, und älter als die vegetabilische Metamor-
phose der Form. Man denke nur z. B. an das uralte
Wehrstück, die Bronze-Spirale.
Die reichste Abwechselung in Farbe und Anordnung
bietet dann das Aostüm d. h. das eigentliche Aleidungs-
stück. hier in's Detail zu gehen, ist ein Ding der Un-
möglichkeit, denn jeder Areis, jeder Distrikt hat seine Eigen-
heiten, seine speziellen Erscheinungen. Nur eines ist so
ziemlich allen eigen I Die Freude an starken, ungebrochenen
Farben. Man macht sich kauin einen Begriff davon, in
welch eigenthümlichem Aontrast diese Erscheinung zu den;
großartigen Erliste der meist wilden Natur steht, die nur
an wenigen, bevorzugten Grten durch reichen Pflanzenwuchs
eine angenehme Abwechseluiig bietet. Das zumeist getragene
Gewebe ist ein grober Wollenstoff, Rasche genannt, welcher
noch durchweg von der Landbevölkerung selbst hergestellt
wird, während das rothe Tuch der Aobanizza (Mantel) von
Saloiiik, feinere Tucharten in verschiedenen Farben aus
Serbien, Bulgarien und Griechenland kommen. Textil-
produkte als Geschenke begleiten den ersten Annäherungs-
versuch des Freiers gegenüber der Auserkorenen, die mit
einem Halstuch, mit Leinwand, mit verschieden gefärbter
Schafwolle zum Sticken, oder einem bunten Gürtel (Tkanicza)
u. s. w. beschenkt wird, wogegen sie sich revanchirt durch ge-
stickte Fußsocken oder durch einen teppichartig in verschiedenen,
stets wohl zusammenklingenden Farben ausgeführten Schnapp-
sack — lauter Dinge die durchschnittlich ein viel feineres Ge-
fühl verrathen als jene manchinal geradezu entsetzlichen Liebes-
gaben in Form von Stickereien, denen man in unserer „civili
sirten" Welt in den „guten Stuben" begegnet, ganz zu
schweigen von gestickten Hosenträgern, Reisetaschen u. s. w.
Solcher Ungeheuerlichkeiten hat sich nur die „gebildete" Welt
zu erfreuen. — Bei der weiblichen Tracht spielt neben dem
Metallschmuck die Buntstickerei eine große Rolle. Ausnahms-
los zeigt der weite Aermel des Aofuljak (Oberhemd) einen
gestickten Streifen von den Achseln bis zum Ellbogen. Aopf-
und hüftbinden, Tücher u. s. w. erhalten reichgestickte Bor-
düren, von denen einige in farbiger Weise hier reproduzirte
einen guten Eindruck geben von der weiblichen Aunstfertigkeit
und von dem unzweifelhaft feinen Geschmacke, der sich in
diesen Nadelarbeiten bekundet. (Auf den Tafeln \5 und
23; vergl. auch die Abbildungen s3 und sH.) Die Technik
—• Seidene Zeichnung auf Leinengrund — unter dem Namen
„der montenegrinische Areuzstich" bekannt, zeigt rechts Areuz-
stiche mit doppeltem Unterfaden, die wieder durch (Huersticbe
getrennt sind; die Aehrfeite hingegen besteht aus regelrechten,
ebenfalls durch Areuzstiche getrennten Areuzstichen. Dies ist
die meist gebräuchliche Art, indessen wird auch der italienische
Areuzstich — Areuzstiche auf beiden Seiten der Stickerei,
durch senkrechte und wagerechte Striche von einander getrennt,
angewendet. Die Farben sind, wie alles an dem Tostüme
der Südslaven, äußerst kräftig, doch gerade bei dieser Gattung
von Stickereien niemals schreiend, vielmehr in vorzüglichem
Einklang; dabei ist die Scala durchaus nicht eine regel-
mäßig wiederkehrende; es herrscht darin vollste Freiheit.
Von größter Zierlichkeit ist bei diesen Tüchern meist
die angesetzte Anüpfarbeit, stets aus stärkeren Anüpffäden
X
/
\
Dekoration der Kleidungsstücke im Gebiete von Ragusa.
Sieht man da z. B. ein Leichenbegängniß, so möchte man
glauben, die Sargträger seien lauter türkische Generale, so
reich ist ihr Gewand mit derlei Schmuck geziert. Geht inan
den Stradone Hauptstraße) zu Ragusa entlang, so sieht man
die Aünstler dieser Dekorationstechnik an der Arbeit. (Es
fiel mir auf, daß die Leute weder ein Muster benützen, noch
irgendwie auf dem Untergrund Anhaltspunkte für die Zeich-
nung fixiren. Auf meine Frage, wieso denn die Arbeit
ohne Vorbild dennoch so korrekt und geschmackvoll ausfallen
l ;. Meffergriff-Linlage.
Silber auf schwarzem Grund. — Die Lurven der Silbereinlagen sind in ihrer Un-
regelmässigkeit genau dem Original nachgebildet.
könne, antwortete der mit untergeschlagenen Beinen auf
seiner Hölle sitzende Nadelkünstler stolz: „N)eil wir eben
Aünstler sind und Genie besitzen." In der That ist es auf-
fallend, mit welcher Sicherheit Aurve um Aurve entsteht,
ohne daß ein Fehler in der räumlichen Disposition vor-
konmit. Das muß den Leuten förmlich im Blute sitzen. Die
Art der Verzierung ist zunächst wohl aus dem mohamme
dänischen Grient gekommen, wenn auch angenommen werden
mag, wie Semper sagt, daß die Spirale das gemeinsame
Flächenornament aller Völker sei, — kommt sie doch gleich-
mäßig vor auf den ältesten Metallgeräthen und keramischen
Produkten wie bei der tätowirten haut der Wilden. Zweifels-
ohne jedoch haben wir in diesen Silber- und Goldborten-
ornamenten die Urenkel der griechischen Palmette vor uns,
die ihrerseits einer langen Ahnenreihe angehört, entstanden
jenseits des aegäischen Meeres, jenseits der Berge Phrygiens
und Tappadociens, und älter als die vegetabilische Metamor-
phose der Form. Man denke nur z. B. an das uralte
Wehrstück, die Bronze-Spirale.
Die reichste Abwechselung in Farbe und Anordnung
bietet dann das Aostüm d. h. das eigentliche Aleidungs-
stück. hier in's Detail zu gehen, ist ein Ding der Un-
möglichkeit, denn jeder Areis, jeder Distrikt hat seine Eigen-
heiten, seine speziellen Erscheinungen. Nur eines ist so
ziemlich allen eigen I Die Freude an starken, ungebrochenen
Farben. Man macht sich kauin einen Begriff davon, in
welch eigenthümlichem Aontrast diese Erscheinung zu den;
großartigen Erliste der meist wilden Natur steht, die nur
an wenigen, bevorzugten Grten durch reichen Pflanzenwuchs
eine angenehme Abwechseluiig bietet. Das zumeist getragene
Gewebe ist ein grober Wollenstoff, Rasche genannt, welcher
noch durchweg von der Landbevölkerung selbst hergestellt
wird, während das rothe Tuch der Aobanizza (Mantel) von
Saloiiik, feinere Tucharten in verschiedenen Farben aus
Serbien, Bulgarien und Griechenland kommen. Textil-
produkte als Geschenke begleiten den ersten Annäherungs-
versuch des Freiers gegenüber der Auserkorenen, die mit
einem Halstuch, mit Leinwand, mit verschieden gefärbter
Schafwolle zum Sticken, oder einem bunten Gürtel (Tkanicza)
u. s. w. beschenkt wird, wogegen sie sich revanchirt durch ge-
stickte Fußsocken oder durch einen teppichartig in verschiedenen,
stets wohl zusammenklingenden Farben ausgeführten Schnapp-
sack — lauter Dinge die durchschnittlich ein viel feineres Ge-
fühl verrathen als jene manchinal geradezu entsetzlichen Liebes-
gaben in Form von Stickereien, denen man in unserer „civili
sirten" Welt in den „guten Stuben" begegnet, ganz zu
schweigen von gestickten Hosenträgern, Reisetaschen u. s. w.
Solcher Ungeheuerlichkeiten hat sich nur die „gebildete" Welt
zu erfreuen. — Bei der weiblichen Tracht spielt neben dem
Metallschmuck die Buntstickerei eine große Rolle. Ausnahms-
los zeigt der weite Aermel des Aofuljak (Oberhemd) einen
gestickten Streifen von den Achseln bis zum Ellbogen. Aopf-
und hüftbinden, Tücher u. s. w. erhalten reichgestickte Bor-
düren, von denen einige in farbiger Weise hier reproduzirte
einen guten Eindruck geben von der weiblichen Aunstfertigkeit
und von dem unzweifelhaft feinen Geschmacke, der sich in
diesen Nadelarbeiten bekundet. (Auf den Tafeln \5 und
23; vergl. auch die Abbildungen s3 und sH.) Die Technik
—• Seidene Zeichnung auf Leinengrund — unter dem Namen
„der montenegrinische Areuzstich" bekannt, zeigt rechts Areuz-
stiche mit doppeltem Unterfaden, die wieder durch (Huersticbe
getrennt sind; die Aehrfeite hingegen besteht aus regelrechten,
ebenfalls durch Areuzstiche getrennten Areuzstichen. Dies ist
die meist gebräuchliche Art, indessen wird auch der italienische
Areuzstich — Areuzstiche auf beiden Seiten der Stickerei,
durch senkrechte und wagerechte Striche von einander getrennt,
angewendet. Die Farben sind, wie alles an dem Tostüme
der Südslaven, äußerst kräftig, doch gerade bei dieser Gattung
von Stickereien niemals schreiend, vielmehr in vorzüglichem
Einklang; dabei ist die Scala durchaus nicht eine regel-
mäßig wiederkehrende; es herrscht darin vollste Freiheit.
Von größter Zierlichkeit ist bei diesen Tüchern meist
die angesetzte Anüpfarbeit, stets aus stärkeren Anüpffäden
X