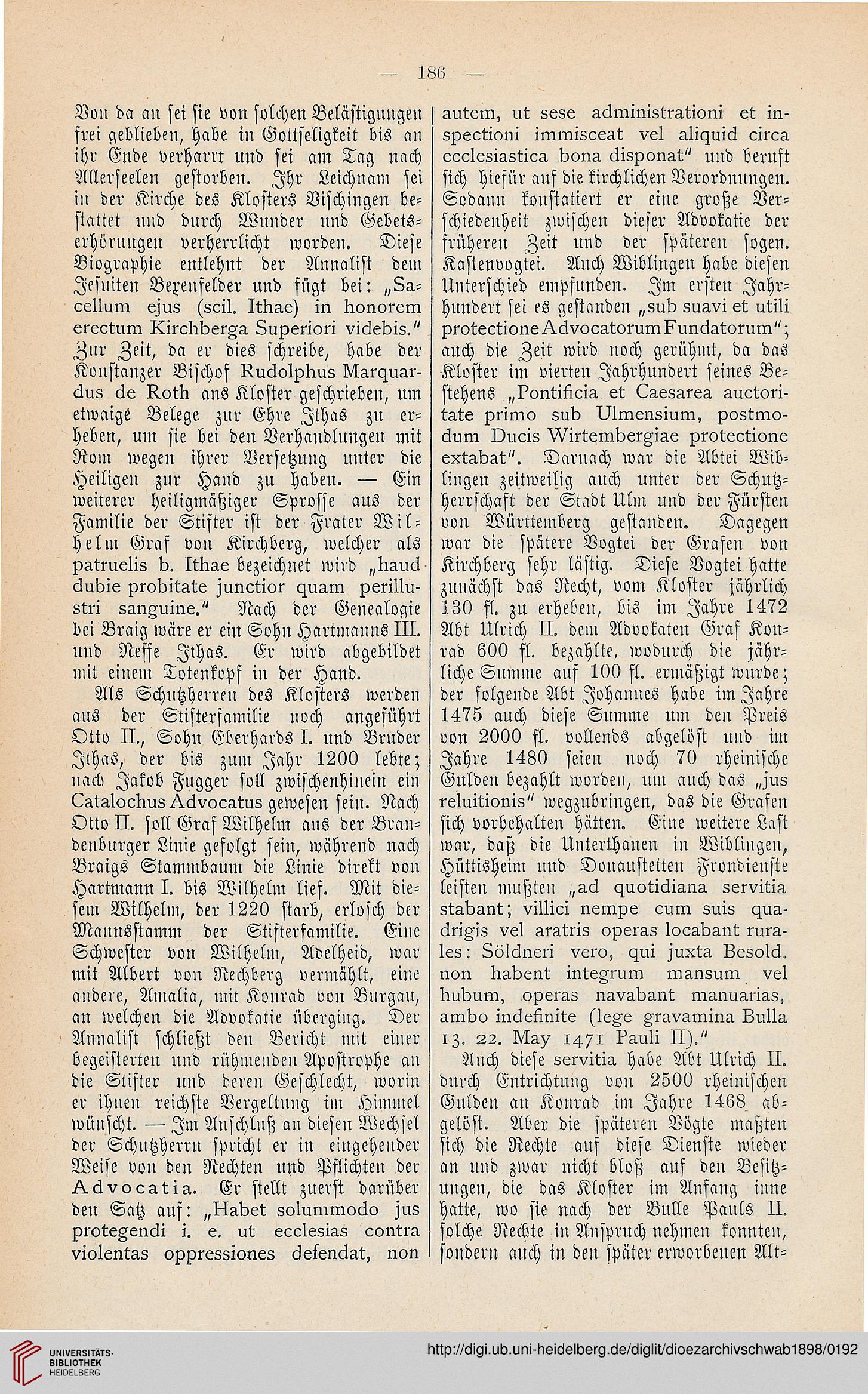Von da an sei sie von solchen Belästigungen
frei geblieben, habe in Gottseligkeit bis an
ihr Ende verharrt und sei am Tag nach
Allerseelen gestorben. Ihr Leichnam sei
in der Kirche des Klosters Vischingen be-
stattet und durch Wunder und Gebets-
erhörnngen verherrlicht worden. Diese
Biographie entlehnt der Annalist dem
Jesuiten Bexenfelder und fügt bei: „La-
cellum ejus (scil. Itbae) in Irouorem
erectum XircbberAa 5up>eriori videbis."
Zur Zeit, da er dies schreibe, habe der
Konstanzer Bischof Budolplrus lVlarczuar-
6ns 6s Botb ans Kloster geschrieben, um
etwaige Belege zur Ehre Jthas zu er-
heben, um sie bei den Verhandlungen mit
Rom wegen ihrer Versetzung unter die
Heiligen zur Hand zu haben. — Ein
weiterer heiligmäßiger Sprosse ans der
Familie der Stifter ist der Frater Wil-
helm Graf von Kirchberg, welcher als
patruelis b. Itbae bezeichnet wird „baud
dubie probitate junctior cpuam perillu-
stri sauZuine." Nach der Genealogie
bei Braig wäre er ein Sohn Hartmanns lll.
und Neffe Jthas. Er wird abgebildet
mit einem Totenkopf in der Hand.
Als Schntzherren des Klosters werden
ans der Stifterfamilie noch angeführt
Otto 11., Sohn Eberhards I. und Bruder
JthaS, der bis zum Jahr 1200 lebte;
naeb Jakob Fugger soll zwischenhinein ein
Latalocbus TVdvocatus gewesen sein. Nach
Otto 11. soll Graf Wilhelm ans der Bran-
denburger Linie gefolgt sein, während nach
Braigs Stammbaum die Linie direkt von
Hartmann I. bis Wilhelm lief. Mit die-
sem Wilhelm, der 1220 starb, erlosch der
Mannsstamm der Stiftersamilie. Eine
Schwester von Wilhelm, Adelheid, war
mit Albert von Rechberg vermählt, eine
andere, Amalia, mi! Konrad von Bnrgan,
an welchen die Advokalie überging. Der
Annalist schließt den Bericht mit einer
begeisterten und rühmenden Apostrophe an
die Stifter und deren Geschlecht, worin
er ihnen reichste Vergeltung im Himmel
wünscht. -— Im Anschluß an diesen Wechsel
der Schutzherrn spricht er in eingehender
Weise von den Rechten und Pflichten der
^.dvocatia. Er stellt zuerst darüber
den Satz auf: „Habet solummodo sus
proteZeudi i. e. uv ecclesias contra
violsntas oppressiones dekendat, non
autem, ut sese administrationi et in-
spectioni immisceat vel alic^uid circa
ecclesiastica bona disponat" und beruft
sich hiefür auf die kirchlichen Verordnungen.
Sodann konstatiert er eine große Ver-
schiedenheit zwischen dieser Advokatie der
früheren Zeit und der späteren sogen.
Kastenvoglei. Auch Wiblingen habe diesen
Unterschied empfunden. Im ersten Jahr-
hundert sei es gestanden „sub suavi et utili
protectione^dvocatorumBundatorum";
auch die Zeit wird noch gerühmt, da das
Kloster im vierten Jahrhundert seines Be-
stehens „Bontilrcia et Eaesarea auctori-
tate xwimo sub Idlmensium, postmo-
dum Oucis Vdirtember^iae protectione
extabat". Darnach war die Abtei Wib-
lingen zeitweilig auch unter der Schutz-
herrschaft der Stadt Ulm und der Fürsten
von Württemberg gestanden. Dagegen
war die spätere Vogtei der Grafen von
Kirchberg sehr lästig. Diese Vogtei hatte
zunächst das Recht, vom Kloster jährlich
130 fl. zu erheben, bis im Jahre 1472
Abt Ulrich II. dem Advokaten Graf Kon-
rad 600 fl. bezahlte, wodurch die jähr-
liche Summe auf 100 fl. ermäßigt wurde;
der folgende Abt Johannes habe im Jahre
1475 auch diese Summe um den Preis
von 2000 fl. vollends abgelöst und im
Jahre 1480 seien noch 70 rheinische
Gulden bezahlt worden, um auch das „jus
reluitionis" wegzubringen, das die Grafen
sich Vorbehalten hätten. Eine weitere Last
war, daß die Unterthanen in Wiblingen,
Hüttisheim und Donaustetten Frondienste
leisten mußten „a6 c^uotidiana servitia
stabant; viliici nempe cum suis c^ua-
dri^is vel aratris operas locabairt rura-
les: Lüldnsri vero, c^ui juxta Besold,
non babent inteZrum mansum vel
bubum, operas navabant manuarias,
ambo indelrnite (leZe Aravamina Bulla
iz. 22. lVlax I4?l Bauli II)."
Auch diese servitia habe Abt Ulrich II.
durch Entrichtung von 2500 rheinischen
Gulden an Konrad im Jahre 1468 ab-
gelöst. Aber die späteren Vögte maßten
sich die Rechte auf diese Dienste Wieder-
au und zwar nicht bloß auf den Besitz-
ungen, die das Kloster im Anfang inue
hatte, wo sie nach der Bulle Pauls II.
solche Reckte in Anspruch nehmen konnten,
sondern auch in den später erworbenen Alt-
frei geblieben, habe in Gottseligkeit bis an
ihr Ende verharrt und sei am Tag nach
Allerseelen gestorben. Ihr Leichnam sei
in der Kirche des Klosters Vischingen be-
stattet und durch Wunder und Gebets-
erhörnngen verherrlicht worden. Diese
Biographie entlehnt der Annalist dem
Jesuiten Bexenfelder und fügt bei: „La-
cellum ejus (scil. Itbae) in Irouorem
erectum XircbberAa 5up>eriori videbis."
Zur Zeit, da er dies schreibe, habe der
Konstanzer Bischof Budolplrus lVlarczuar-
6ns 6s Botb ans Kloster geschrieben, um
etwaige Belege zur Ehre Jthas zu er-
heben, um sie bei den Verhandlungen mit
Rom wegen ihrer Versetzung unter die
Heiligen zur Hand zu haben. — Ein
weiterer heiligmäßiger Sprosse ans der
Familie der Stifter ist der Frater Wil-
helm Graf von Kirchberg, welcher als
patruelis b. Itbae bezeichnet wird „baud
dubie probitate junctior cpuam perillu-
stri sauZuine." Nach der Genealogie
bei Braig wäre er ein Sohn Hartmanns lll.
und Neffe Jthas. Er wird abgebildet
mit einem Totenkopf in der Hand.
Als Schntzherren des Klosters werden
ans der Stifterfamilie noch angeführt
Otto 11., Sohn Eberhards I. und Bruder
JthaS, der bis zum Jahr 1200 lebte;
naeb Jakob Fugger soll zwischenhinein ein
Latalocbus TVdvocatus gewesen sein. Nach
Otto 11. soll Graf Wilhelm ans der Bran-
denburger Linie gefolgt sein, während nach
Braigs Stammbaum die Linie direkt von
Hartmann I. bis Wilhelm lief. Mit die-
sem Wilhelm, der 1220 starb, erlosch der
Mannsstamm der Stiftersamilie. Eine
Schwester von Wilhelm, Adelheid, war
mit Albert von Rechberg vermählt, eine
andere, Amalia, mi! Konrad von Bnrgan,
an welchen die Advokalie überging. Der
Annalist schließt den Bericht mit einer
begeisterten und rühmenden Apostrophe an
die Stifter und deren Geschlecht, worin
er ihnen reichste Vergeltung im Himmel
wünscht. -— Im Anschluß an diesen Wechsel
der Schutzherrn spricht er in eingehender
Weise von den Rechten und Pflichten der
^.dvocatia. Er stellt zuerst darüber
den Satz auf: „Habet solummodo sus
proteZeudi i. e. uv ecclesias contra
violsntas oppressiones dekendat, non
autem, ut sese administrationi et in-
spectioni immisceat vel alic^uid circa
ecclesiastica bona disponat" und beruft
sich hiefür auf die kirchlichen Verordnungen.
Sodann konstatiert er eine große Ver-
schiedenheit zwischen dieser Advokatie der
früheren Zeit und der späteren sogen.
Kastenvoglei. Auch Wiblingen habe diesen
Unterschied empfunden. Im ersten Jahr-
hundert sei es gestanden „sub suavi et utili
protectione^dvocatorumBundatorum";
auch die Zeit wird noch gerühmt, da das
Kloster im vierten Jahrhundert seines Be-
stehens „Bontilrcia et Eaesarea auctori-
tate xwimo sub Idlmensium, postmo-
dum Oucis Vdirtember^iae protectione
extabat". Darnach war die Abtei Wib-
lingen zeitweilig auch unter der Schutz-
herrschaft der Stadt Ulm und der Fürsten
von Württemberg gestanden. Dagegen
war die spätere Vogtei der Grafen von
Kirchberg sehr lästig. Diese Vogtei hatte
zunächst das Recht, vom Kloster jährlich
130 fl. zu erheben, bis im Jahre 1472
Abt Ulrich II. dem Advokaten Graf Kon-
rad 600 fl. bezahlte, wodurch die jähr-
liche Summe auf 100 fl. ermäßigt wurde;
der folgende Abt Johannes habe im Jahre
1475 auch diese Summe um den Preis
von 2000 fl. vollends abgelöst und im
Jahre 1480 seien noch 70 rheinische
Gulden bezahlt worden, um auch das „jus
reluitionis" wegzubringen, das die Grafen
sich Vorbehalten hätten. Eine weitere Last
war, daß die Unterthanen in Wiblingen,
Hüttisheim und Donaustetten Frondienste
leisten mußten „a6 c^uotidiana servitia
stabant; viliici nempe cum suis c^ua-
dri^is vel aratris operas locabairt rura-
les: Lüldnsri vero, c^ui juxta Besold,
non babent inteZrum mansum vel
bubum, operas navabant manuarias,
ambo indelrnite (leZe Aravamina Bulla
iz. 22. lVlax I4?l Bauli II)."
Auch diese servitia habe Abt Ulrich II.
durch Entrichtung von 2500 rheinischen
Gulden an Konrad im Jahre 1468 ab-
gelöst. Aber die späteren Vögte maßten
sich die Rechte auf diese Dienste Wieder-
au und zwar nicht bloß auf den Besitz-
ungen, die das Kloster im Anfang inue
hatte, wo sie nach der Bulle Pauls II.
solche Reckte in Anspruch nehmen konnten,
sondern auch in den später erworbenen Alt-