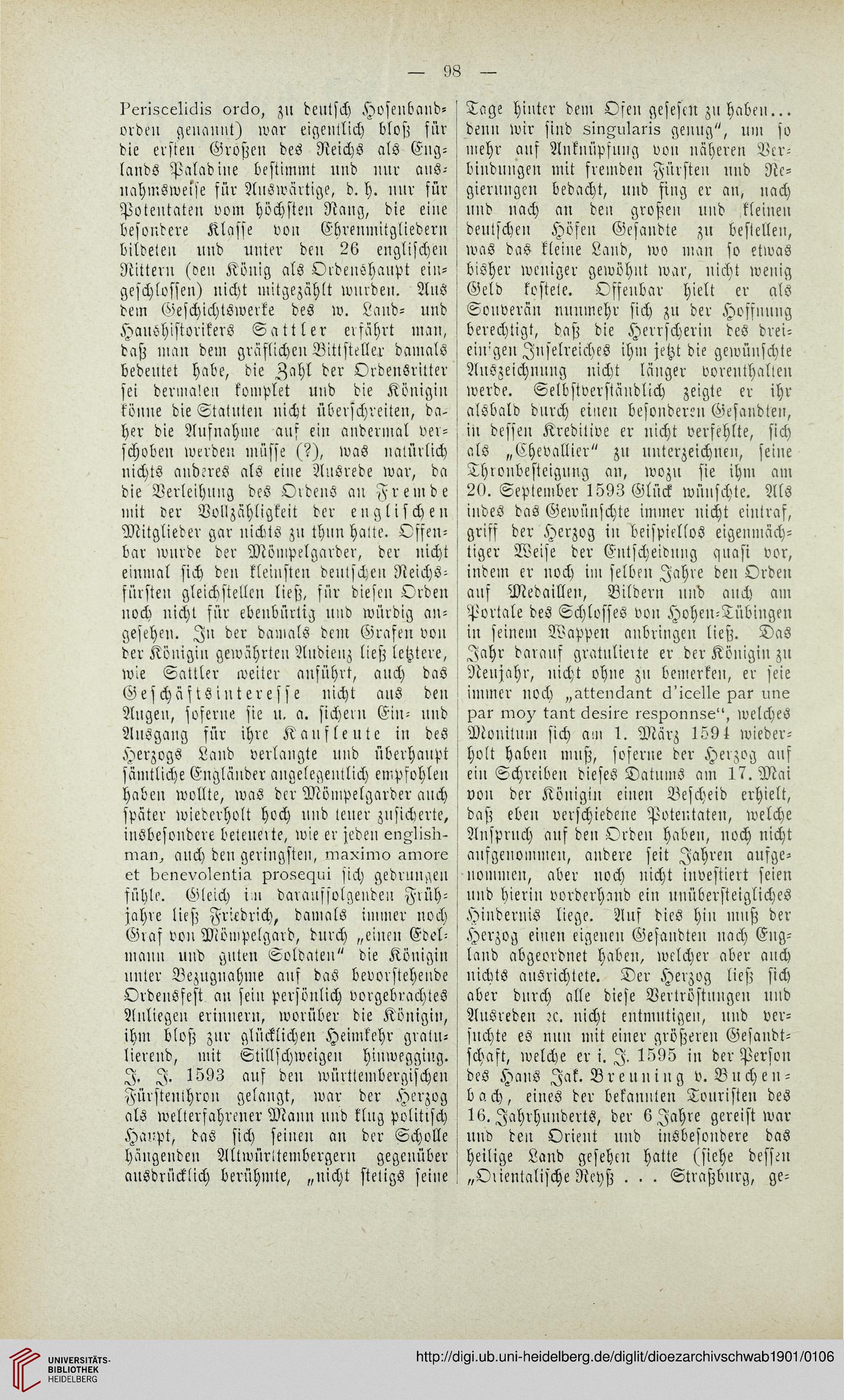98
?eri3Le1i6is orclo, zu deutsch Hosenband-
orden genanilt) war eigentlich bloß für
die ersteu Großen des Reichs als Eng-
lands Paladine bestimmt und nur aus-
nahmsweise für Auswärtige, d. h. nur für
Potentaten vom höchsten Rang, die eine
besondere Klasse von Ehrenmitgliedern
bildeten und unter den 26 englischen
Rittern (den König als Ordenshanpt ein-
geschlossen) nicht mitgezählt wurden. Ans
dem Geschichtswerke des w. Land- und
Hanshistorikers Sattler erfährt man,
daß man dem gräflichen Bittsteller damals
bedeutet habe, die Zahl der Ordensritter
sei dermalen komplet und die Königin
könne die Statuten nicht überschreiten, da-
her die Aufnahme ans ein andermal ver-
schoben werden müsse (?), was natürlich
nichts anderes als eine Ausrede war, da
die Verleihung des Ordens all Fremde
mit der Vollzähligkeit der englischen
Mitglieder gar nichts zu thnn halte. Offen-
bar wurde der Mömpelgarder, der nicht
einmal sich den kleinsten deutschen Neichs-
fürsten gleichstellcn ließ, für diesen Orden
noch nicht für ebenbürtig und würdig an-
gesehen. In der damals dem Grafen von
der Königin gewährten Audienz ließ letztere,
wie Sattler weiter anführt, auch das
Geschäftsinteresse nicht ans den
Angell, foferne sie u. a. sichern Ein- und
Ansgang für ihre Kanflente in des
Herzogs Land verlangte lind überhaupt
sämtliche Engländer angelegentlich empfohlen
haben wollte, was der Mömpelgarder auch
später wiederholt hoch lind lener znsicherte,
insbesondere beteuerte, wie er jeden en^lisn-
mnn, auch den geringsten, rrmximo rrmore
et denevolentin pro8ecgui sich gedrungen
fühle. Gleich im darauffolgenden Früh-
jahre ließ Friedrich, damals immer noch
Graf voll Mömpelgard, durch „einen Edel-
mann und guten Soldaten" die Königin
unter Bezugnahme ans das bevorstehende
Ordensfest an sein persönlich vorgebrachtes
Anliegen erinnern, worüber die Königin,
ihm bloß zur glücklichen Heimkehr gratu-
lierend, mit Stillschweigen hinwegging.
I. I. 1593 auf den württembergischen
Fürstenthron gelangt, war der Herzog
als welterfahrener Mann und klug politisch
Haupt, das sich seinen an der Scholle
hängenden Altwüritembergern gegenüber
ausdrücklich berühmte, „nicht stetigs seine
Tage hinter dem Ofen gesescn zu haben...
denn wir sind 8inAulnri3 genug", um so
mehr ans Anknüpfung von näheren Ver-
bindungen mit fremden Fürsteil und Ne-
gierungen bedacht, und fing er an, nach
und nach an den großen und kleinen
deutschen Höfen Gesandte zu bestellen,
was das kleine Land, wo man so etwas
bisher welliger gewöhnt war, nicht wenig
Geld kostete. Offenbar hielt er als
Souverän nunmehr sich zu der Hoffnung
berechtigt, daß die Herrscherin des drei-
einigen Jnselreiches ihm jetzt die gewünschte
Auszeichnung nicht länger vorenthalten
werde. Selbstverständlich zeigte er ihr
alsbald durch einen besonderen Gesandten,
in dessen Kreditive er nicht verfehlte, sich
als „Chevallier" zu unterzeichnen, seine
Thronbesteigung an, wozu sie ihm am
20. September 1593 Glück wünschte. Als
indes das Gewünschte immer nicht eintraf,
griff der Herzog in beispiellos eigenmäch-
tiger Weise der Entscheidung quasi vor,
indem er noch im selben Jahre den Orden
ans Medaillen, Bildern und auch am
Portale des Schlosses von Hohen-Tübingen
in seinem Wappen anbringen ließ. Das
Jahr darauf gratnlielte er der Königin zu
Neujahr, nicht ohne zu bemerken, er feie
immer noch „attenckant cl'icelle par uns
par tunt ckesire regponnse", welches
Monitum sich am 1. März 1591 wieder-
holt haben muß, soferne der Herzog ans
ein Schreiben dieses Datums am 17. Mai
voll der Köiligin einen Bescheid erhielt,
daß eben verschiedene Potentaten, welche
Anspruch auf den Orden haben, noch nicht
ausgenommen, andere seit Jahren ausge-
nommen, aber noch nicht investiert seien
lind hierin vorderhand ein nnübersteigliches
Hindernis liege. Ans dies hin muß der
Herzog einen eigenen Gesandten nach Eng-
land abgeordnet haben, welcher aber auch
nichts ansrichtete. Der Herzog ließ sich
aber durch alle diese Vertröstungen und
Ausreden re. nicht entmutigen, und ver-
suchte es nun mit einer größeren Gesandt-
schaft, welche er i. I. 1595 in der Person
des Hans Jak. Breuning v. Büchen-
bach, eines der bekannten Touristen des
16. Jahrhunderts, der 6 Jahre gereist war
und den Orient und insbesondere das
heilige Land gesehcn hatte (siehe dessen
„Olientalische Reyß . . . Straßbnrg, ge-
?eri3Le1i6is orclo, zu deutsch Hosenband-
orden genanilt) war eigentlich bloß für
die ersteu Großen des Reichs als Eng-
lands Paladine bestimmt und nur aus-
nahmsweise für Auswärtige, d. h. nur für
Potentaten vom höchsten Rang, die eine
besondere Klasse von Ehrenmitgliedern
bildeten und unter den 26 englischen
Rittern (den König als Ordenshanpt ein-
geschlossen) nicht mitgezählt wurden. Ans
dem Geschichtswerke des w. Land- und
Hanshistorikers Sattler erfährt man,
daß man dem gräflichen Bittsteller damals
bedeutet habe, die Zahl der Ordensritter
sei dermalen komplet und die Königin
könne die Statuten nicht überschreiten, da-
her die Aufnahme ans ein andermal ver-
schoben werden müsse (?), was natürlich
nichts anderes als eine Ausrede war, da
die Verleihung des Ordens all Fremde
mit der Vollzähligkeit der englischen
Mitglieder gar nichts zu thnn halte. Offen-
bar wurde der Mömpelgarder, der nicht
einmal sich den kleinsten deutschen Neichs-
fürsten gleichstellcn ließ, für diesen Orden
noch nicht für ebenbürtig und würdig an-
gesehen. In der damals dem Grafen von
der Königin gewährten Audienz ließ letztere,
wie Sattler weiter anführt, auch das
Geschäftsinteresse nicht ans den
Angell, foferne sie u. a. sichern Ein- und
Ansgang für ihre Kanflente in des
Herzogs Land verlangte lind überhaupt
sämtliche Engländer angelegentlich empfohlen
haben wollte, was der Mömpelgarder auch
später wiederholt hoch lind lener znsicherte,
insbesondere beteuerte, wie er jeden en^lisn-
mnn, auch den geringsten, rrmximo rrmore
et denevolentin pro8ecgui sich gedrungen
fühle. Gleich im darauffolgenden Früh-
jahre ließ Friedrich, damals immer noch
Graf voll Mömpelgard, durch „einen Edel-
mann und guten Soldaten" die Königin
unter Bezugnahme ans das bevorstehende
Ordensfest an sein persönlich vorgebrachtes
Anliegen erinnern, worüber die Königin,
ihm bloß zur glücklichen Heimkehr gratu-
lierend, mit Stillschweigen hinwegging.
I. I. 1593 auf den württembergischen
Fürstenthron gelangt, war der Herzog
als welterfahrener Mann und klug politisch
Haupt, das sich seinen an der Scholle
hängenden Altwüritembergern gegenüber
ausdrücklich berühmte, „nicht stetigs seine
Tage hinter dem Ofen gesescn zu haben...
denn wir sind 8inAulnri3 genug", um so
mehr ans Anknüpfung von näheren Ver-
bindungen mit fremden Fürsteil und Ne-
gierungen bedacht, und fing er an, nach
und nach an den großen und kleinen
deutschen Höfen Gesandte zu bestellen,
was das kleine Land, wo man so etwas
bisher welliger gewöhnt war, nicht wenig
Geld kostete. Offenbar hielt er als
Souverän nunmehr sich zu der Hoffnung
berechtigt, daß die Herrscherin des drei-
einigen Jnselreiches ihm jetzt die gewünschte
Auszeichnung nicht länger vorenthalten
werde. Selbstverständlich zeigte er ihr
alsbald durch einen besonderen Gesandten,
in dessen Kreditive er nicht verfehlte, sich
als „Chevallier" zu unterzeichnen, seine
Thronbesteigung an, wozu sie ihm am
20. September 1593 Glück wünschte. Als
indes das Gewünschte immer nicht eintraf,
griff der Herzog in beispiellos eigenmäch-
tiger Weise der Entscheidung quasi vor,
indem er noch im selben Jahre den Orden
ans Medaillen, Bildern und auch am
Portale des Schlosses von Hohen-Tübingen
in seinem Wappen anbringen ließ. Das
Jahr darauf gratnlielte er der Königin zu
Neujahr, nicht ohne zu bemerken, er feie
immer noch „attenckant cl'icelle par uns
par tunt ckesire regponnse", welches
Monitum sich am 1. März 1591 wieder-
holt haben muß, soferne der Herzog ans
ein Schreiben dieses Datums am 17. Mai
voll der Köiligin einen Bescheid erhielt,
daß eben verschiedene Potentaten, welche
Anspruch auf den Orden haben, noch nicht
ausgenommen, andere seit Jahren ausge-
nommen, aber noch nicht investiert seien
lind hierin vorderhand ein nnübersteigliches
Hindernis liege. Ans dies hin muß der
Herzog einen eigenen Gesandten nach Eng-
land abgeordnet haben, welcher aber auch
nichts ansrichtete. Der Herzog ließ sich
aber durch alle diese Vertröstungen und
Ausreden re. nicht entmutigen, und ver-
suchte es nun mit einer größeren Gesandt-
schaft, welche er i. I. 1595 in der Person
des Hans Jak. Breuning v. Büchen-
bach, eines der bekannten Touristen des
16. Jahrhunderts, der 6 Jahre gereist war
und den Orient und insbesondere das
heilige Land gesehcn hatte (siehe dessen
„Olientalische Reyß . . . Straßbnrg, ge-