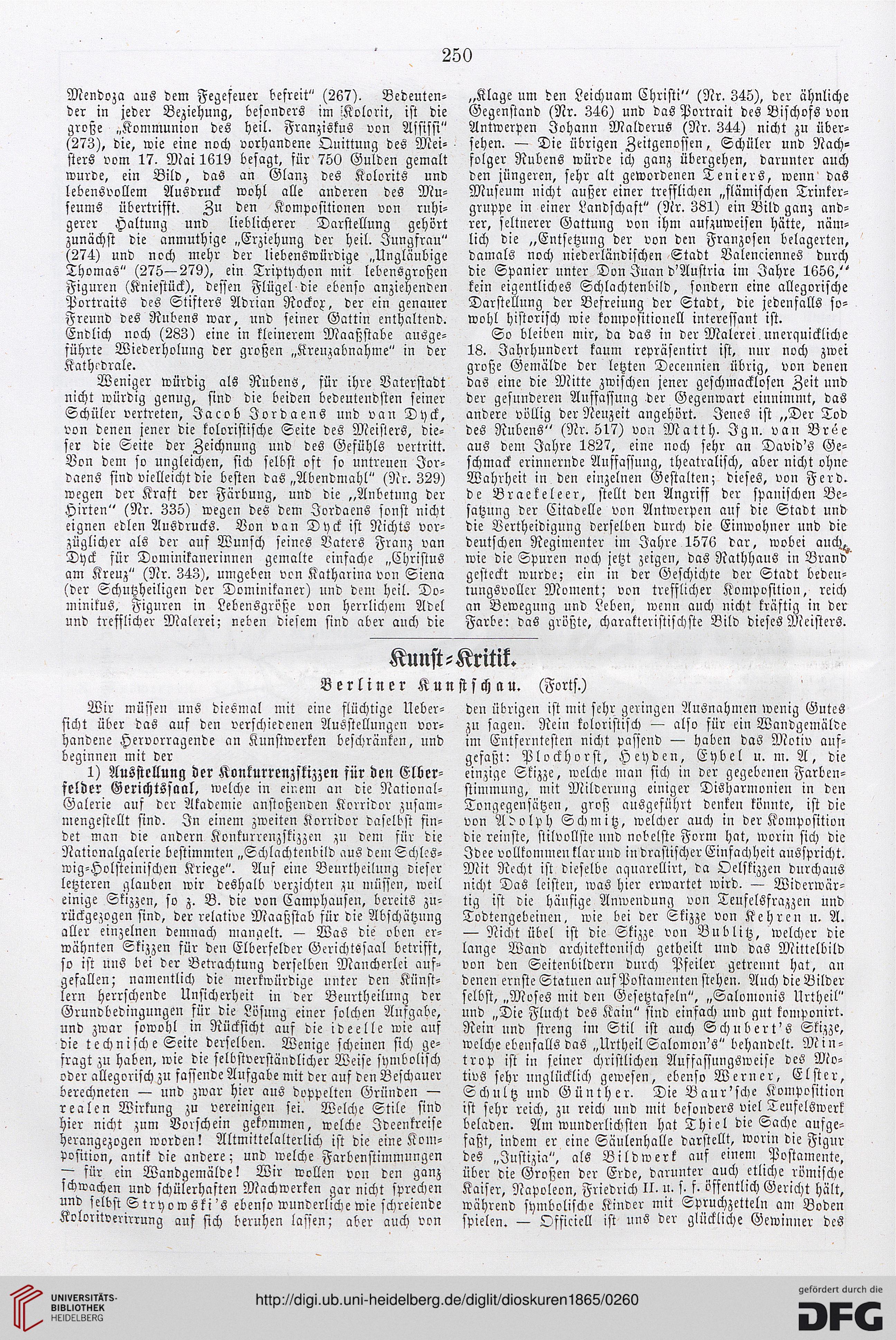250
Mendoza aus dem Fegefeuer befreit" (267). Bedeuten-
der in jeder Beziehung, besonders im Kolorit, ist die
große ,,Kommunion des heil. Franziskus von Assissi"
(273) , die, wie eine noch vorhandene Quittung des Mei-
sters vom 17. Mai 1619 besagt, für 750 Gulden gemalt
wurde, ein Bild, das an Glanz des Kolorits und
lebensvollem Ausdruck wohl alle anderen des Mu-
seums übertrifft. Zu den Kompositionen von ruhi-
gerer Haltung und lieblicherer Darstellung gehört
zunächst die anmuthige „Erziehung der heil. Jungfrau"
(274) und noch mehr der liebenswürdige „Ungläubige
Thomas" (275—279), ein Triptychon mit lebensgroßen
Figuren (Kniestück), dessen Flügel die ebenso anziehenden
Portraits des Stifters Adrian Rockox, der ein genauer
Freund des Rubens war, und seiner Gattin enthaltend.
Endlich noch (283) eine in kleinerem Maaßstabe ausge-
führte Wiederholung der großen „Kreuzabnahme" in der
Kathedrale.
Weniger würdig als Rubens, für ihre Vaterstadt
nicht würdig genug, sind die beiden bedeutendsten seiner
Schüler vertreten, Jacob Jordaens und van Dyck,
von denen jener die koloristische Seite des Meisters, die-
ser die Seite der Zeichnung und des Gefühls vertritt.
Von dem so ungleichen, sich selbst oft so untreuen Jor-
daens sind vielleicht die besten das „Abendmahl" (Nr. 329)
wegen der Kraft der Färbung, und die „Anbetung der
Hirten" (Nr. 335) wegen des dem Jordaens sonst nicht
eignen edlen Ausdrucks. Von van Dyck ist Nichts vor-
züglicher als der auf Wunsch seines Vaters Franz van
Dyck für Dominikanerinnen gemalte einfache „Christus
am Kreuz" (Nr. 343), umgeben von Katharina von Siena
(der Schutzheiligen der Dominikaner) und dem heil. Do-
minikus, Figuren in Lebensgröße von herrlichem Adel
und trefflicher Malerei; neben diesem sind aber auch die
Kunst
Berliner tu
Wir müssen uns diesmal mit eine flüchtige Ueber-
sicht über das auf den verschiedenen Ausstellungen vor-
handene Hervorragende an Kunstwerken beschränken, und
beginnen mit der
1) Ausstellung der Konkurrenzskizzen für den Elber-
felder Gerichtssaal, welche in einem an die National-
Galerie aus der Akademie anstoßenden Korridor zusani-
mengestellt sind. In einem zweiten Korridor daselbst fin-
det man die andern Konkurrenzskizzen zu dem für die
Nationalgalerie bestimmten „Schlachtenbild aus dem Schles-
wig-Holsteinischen Kriege". Auf eine Beurtheilung dieser
letzteren glauben wir deshalb verzichten zu müssen, weil
einige Skizzen, so z. B. die von Camphausen, bereits zu-
rückgezogen sind, der relative Maaßstab für die Abschätzung
aller einzelnen demnach mangelt. — Was die oben er-
wähnten Skizzen für den Elberfelder Gerichtssaal betrifft,
so ist uns bei der Betrachtung derselben Mancherlei aus-
gefallen; namentlich die merkwürdige unter den Künst-
lern herrschende Unsicherheit in der Beurtheilung der
Grundbedingungen für die Lösung einer solchen Aufgabe,
und zwar sowohl in Rücksicht auf die ideelle wie auf
die technische Seite derselben. Wenige scheinen sich ge-
fragt zu haben, wie die selbstverständlicher Weise symbolisch
oder allegorisch zu fassende Aufgabe mit der auf den Beschauer-
berechneten — und zwar hier aus doppelten Gründen —
realen Wirkung zu vereinigen sei. 28eld)e Stile sind
hier nicht zum Vorschein gekommen, welche Jdeenkreise
herangezogen worden! Altmittelalterlich ist die eine Kom-
position, antik die andere; und welche Farbenstimmungen
— für ein Wandgemälde! Wir wollen von den ganz
schwachen und schülerhaften Machwerken gar nicht sprechen
und selbst S tryow ski 's ebenso wunderliche wie schreiende
Koloritverirrung auf sich beruhen lassen; aber auch von
„Klage um den Leichnam Christi" (Nr. 345), der ähnliche
Gegenstand (Nr. 346) und das Portrait des Bischofs von
Antwerpen Johann MalderuS (Nr. 344) nicht zu über-
sehen. — Die übrigen Zeitgenossen, Schüler und Nach-
folger Rubens würde ich ganz übergehen, darunter auch
ben jüngeren, sehr alt gewordenen Teniers, wenn das
Museum nicht außer einer trefflichen „flämischen Trinker-
gruppe in einer Landschaft" (Nr. 381) ein Bild ganz and-
rer, seltnerer Gattung von ihm aufzuweisen hätte, näm-
lich die „Entsetzung der von den Franzosen belagerten,
damals noch niederländischen Stadt Balenciennes durch
die Spanier unter Don Juan d'Austria im Jahre 1656,"
kein eigentliches Schlachtenbild, sondern eine allegorische
Darstellung der Befreiung der Stadt, die jedenfalls so-
wohl historisch wie kompositiouell interessant ist.
So bleiben mir, da das in der Malerei unerquickliche
18. Jahrhundert kaum repräsentirt ist, nur noch zwei
große Gemälde der letzten Decennien übrig, von denen
das eine die Mitte zwischen jener geschmacklosen Zeit und
der gesunderen Auffassung der Gegenwart einnimmt, das
andere völlig der Neuzeit angehört. Jenes ist „Der Tod
des Rubens" (Nr. 517) von Matth. Jgn. van Bröe
aus dem Jahre 1827, eine noch sehr an David's Ge-
schmack erinnernde Auffassung, theatralisch, aber nicht ohne
Wahrheit in den einzelnen Gestalten; dieses, von Ferd.
de Braekeleer, stellt den Angriff der spanischen Be-
satzung der Citadelle von Antwerpen ans die Stadt und
die Bertheidigung derselben durch die Einwohner und die
deutschen Regimenter im Jahre 1576 dar, wobei anch^
wie die Spuren noch jetzt zeigen, das Rathhaus in Brand '
gesteckt wurde; ein in der Geschichte der Stadt beden-
lungsvoller Moment; von trefflicher Komposition, reich
an Bewegung und Leben, wenn auch nicht kräftig in der
Farbe: das größte, charakteristischste Bild dieses Meisters.
Kritik.
st s dj a u. (Forts.)
den übrigen ist mit sehr geringen Ausnahmen wenig Gutes
zu sagen. Rein koloristisch — also für ein Wandgemälde
im Entferntesten nicht passend — haben das Motiv auf-
gefaßt: Plockhorst, Heyden, Eybel u. m. A, die
einzige Skizze, welche man sich in der gegebenen Farbeu-
stimmung, mit Milderung einiger Disharmonien in den
Tongegensätzen, groß ausgeführt denken könnte, ist die
von Adolph Schmitz, welcher auch in der Komposition
die reinste, stilvollste und nobelste Forni hat, worin sich die
Idee vollkommen klar und in drastischer Einfachheit ansspricht.
Mit Recht ist dieselbe aquarellirt, da Oelskizzen durchaus
nicht Das leisten, was hier erwartet wird. — Widerwär-
tig ist die häufige Anwendung von Tcufelsfrazzen und
Todtengebeinen, wie bei der Skizze von Kehren u. A.
— Nicht übel ist die Skizze von Bublitz, welcher die
lange Wand architektonisch getheilt und daS Mittelbild
von den Seitenbildern durch Pfeiler getrennt hat, an
denen ernste Statuen aufPostamenten stehen. Auch die Bilder
selbst, „Moses mit den Gesetztafeln", „Salomonis Urtheil"
und „Die Flucht des Min" sind einsach und gut komponirt.
Rein und streng im Stil ist auch Schubert's Skizze,
welche ebenfalls das „Urtheil Salomon's" behandelt. Min-
trop ist in seiner christlichen Auffassnngsweise des Mo-
tivs sehr unglücklich gewesen, ebenso Werner, Elster,
Schultz und Günther. Die Baur'sche Komposition
ist sehr reich, zu reich und mit besonders viel Teufelswerk
beladen. Am wunderlichsten hat Thiel die Sache aufge-
faßt, indem er eine Säulenhalle darstellt, worin die Figur
des „Justizia", als Bildwerk auf einen, Postamente,
über die Großen der Erde, darunter auch etliche römische
Kaiser, Napoleon, Friedrich II. u. s. f. öffentlich Gericht hält,
während symbolische Kinder mit Spruchzetteln am Boden
spielen. — Officiell ist uns der glückliche Gewinner des
Mendoza aus dem Fegefeuer befreit" (267). Bedeuten-
der in jeder Beziehung, besonders im Kolorit, ist die
große ,,Kommunion des heil. Franziskus von Assissi"
(273) , die, wie eine noch vorhandene Quittung des Mei-
sters vom 17. Mai 1619 besagt, für 750 Gulden gemalt
wurde, ein Bild, das an Glanz des Kolorits und
lebensvollem Ausdruck wohl alle anderen des Mu-
seums übertrifft. Zu den Kompositionen von ruhi-
gerer Haltung und lieblicherer Darstellung gehört
zunächst die anmuthige „Erziehung der heil. Jungfrau"
(274) und noch mehr der liebenswürdige „Ungläubige
Thomas" (275—279), ein Triptychon mit lebensgroßen
Figuren (Kniestück), dessen Flügel die ebenso anziehenden
Portraits des Stifters Adrian Rockox, der ein genauer
Freund des Rubens war, und seiner Gattin enthaltend.
Endlich noch (283) eine in kleinerem Maaßstabe ausge-
führte Wiederholung der großen „Kreuzabnahme" in der
Kathedrale.
Weniger würdig als Rubens, für ihre Vaterstadt
nicht würdig genug, sind die beiden bedeutendsten seiner
Schüler vertreten, Jacob Jordaens und van Dyck,
von denen jener die koloristische Seite des Meisters, die-
ser die Seite der Zeichnung und des Gefühls vertritt.
Von dem so ungleichen, sich selbst oft so untreuen Jor-
daens sind vielleicht die besten das „Abendmahl" (Nr. 329)
wegen der Kraft der Färbung, und die „Anbetung der
Hirten" (Nr. 335) wegen des dem Jordaens sonst nicht
eignen edlen Ausdrucks. Von van Dyck ist Nichts vor-
züglicher als der auf Wunsch seines Vaters Franz van
Dyck für Dominikanerinnen gemalte einfache „Christus
am Kreuz" (Nr. 343), umgeben von Katharina von Siena
(der Schutzheiligen der Dominikaner) und dem heil. Do-
minikus, Figuren in Lebensgröße von herrlichem Adel
und trefflicher Malerei; neben diesem sind aber auch die
Kunst
Berliner tu
Wir müssen uns diesmal mit eine flüchtige Ueber-
sicht über das auf den verschiedenen Ausstellungen vor-
handene Hervorragende an Kunstwerken beschränken, und
beginnen mit der
1) Ausstellung der Konkurrenzskizzen für den Elber-
felder Gerichtssaal, welche in einem an die National-
Galerie aus der Akademie anstoßenden Korridor zusani-
mengestellt sind. In einem zweiten Korridor daselbst fin-
det man die andern Konkurrenzskizzen zu dem für die
Nationalgalerie bestimmten „Schlachtenbild aus dem Schles-
wig-Holsteinischen Kriege". Auf eine Beurtheilung dieser
letzteren glauben wir deshalb verzichten zu müssen, weil
einige Skizzen, so z. B. die von Camphausen, bereits zu-
rückgezogen sind, der relative Maaßstab für die Abschätzung
aller einzelnen demnach mangelt. — Was die oben er-
wähnten Skizzen für den Elberfelder Gerichtssaal betrifft,
so ist uns bei der Betrachtung derselben Mancherlei aus-
gefallen; namentlich die merkwürdige unter den Künst-
lern herrschende Unsicherheit in der Beurtheilung der
Grundbedingungen für die Lösung einer solchen Aufgabe,
und zwar sowohl in Rücksicht auf die ideelle wie auf
die technische Seite derselben. Wenige scheinen sich ge-
fragt zu haben, wie die selbstverständlicher Weise symbolisch
oder allegorisch zu fassende Aufgabe mit der auf den Beschauer-
berechneten — und zwar hier aus doppelten Gründen —
realen Wirkung zu vereinigen sei. 28eld)e Stile sind
hier nicht zum Vorschein gekommen, welche Jdeenkreise
herangezogen worden! Altmittelalterlich ist die eine Kom-
position, antik die andere; und welche Farbenstimmungen
— für ein Wandgemälde! Wir wollen von den ganz
schwachen und schülerhaften Machwerken gar nicht sprechen
und selbst S tryow ski 's ebenso wunderliche wie schreiende
Koloritverirrung auf sich beruhen lassen; aber auch von
„Klage um den Leichnam Christi" (Nr. 345), der ähnliche
Gegenstand (Nr. 346) und das Portrait des Bischofs von
Antwerpen Johann MalderuS (Nr. 344) nicht zu über-
sehen. — Die übrigen Zeitgenossen, Schüler und Nach-
folger Rubens würde ich ganz übergehen, darunter auch
ben jüngeren, sehr alt gewordenen Teniers, wenn das
Museum nicht außer einer trefflichen „flämischen Trinker-
gruppe in einer Landschaft" (Nr. 381) ein Bild ganz and-
rer, seltnerer Gattung von ihm aufzuweisen hätte, näm-
lich die „Entsetzung der von den Franzosen belagerten,
damals noch niederländischen Stadt Balenciennes durch
die Spanier unter Don Juan d'Austria im Jahre 1656,"
kein eigentliches Schlachtenbild, sondern eine allegorische
Darstellung der Befreiung der Stadt, die jedenfalls so-
wohl historisch wie kompositiouell interessant ist.
So bleiben mir, da das in der Malerei unerquickliche
18. Jahrhundert kaum repräsentirt ist, nur noch zwei
große Gemälde der letzten Decennien übrig, von denen
das eine die Mitte zwischen jener geschmacklosen Zeit und
der gesunderen Auffassung der Gegenwart einnimmt, das
andere völlig der Neuzeit angehört. Jenes ist „Der Tod
des Rubens" (Nr. 517) von Matth. Jgn. van Bröe
aus dem Jahre 1827, eine noch sehr an David's Ge-
schmack erinnernde Auffassung, theatralisch, aber nicht ohne
Wahrheit in den einzelnen Gestalten; dieses, von Ferd.
de Braekeleer, stellt den Angriff der spanischen Be-
satzung der Citadelle von Antwerpen ans die Stadt und
die Bertheidigung derselben durch die Einwohner und die
deutschen Regimenter im Jahre 1576 dar, wobei anch^
wie die Spuren noch jetzt zeigen, das Rathhaus in Brand '
gesteckt wurde; ein in der Geschichte der Stadt beden-
lungsvoller Moment; von trefflicher Komposition, reich
an Bewegung und Leben, wenn auch nicht kräftig in der
Farbe: das größte, charakteristischste Bild dieses Meisters.
Kritik.
st s dj a u. (Forts.)
den übrigen ist mit sehr geringen Ausnahmen wenig Gutes
zu sagen. Rein koloristisch — also für ein Wandgemälde
im Entferntesten nicht passend — haben das Motiv auf-
gefaßt: Plockhorst, Heyden, Eybel u. m. A, die
einzige Skizze, welche man sich in der gegebenen Farbeu-
stimmung, mit Milderung einiger Disharmonien in den
Tongegensätzen, groß ausgeführt denken könnte, ist die
von Adolph Schmitz, welcher auch in der Komposition
die reinste, stilvollste und nobelste Forni hat, worin sich die
Idee vollkommen klar und in drastischer Einfachheit ansspricht.
Mit Recht ist dieselbe aquarellirt, da Oelskizzen durchaus
nicht Das leisten, was hier erwartet wird. — Widerwär-
tig ist die häufige Anwendung von Tcufelsfrazzen und
Todtengebeinen, wie bei der Skizze von Kehren u. A.
— Nicht übel ist die Skizze von Bublitz, welcher die
lange Wand architektonisch getheilt und daS Mittelbild
von den Seitenbildern durch Pfeiler getrennt hat, an
denen ernste Statuen aufPostamenten stehen. Auch die Bilder
selbst, „Moses mit den Gesetztafeln", „Salomonis Urtheil"
und „Die Flucht des Min" sind einsach und gut komponirt.
Rein und streng im Stil ist auch Schubert's Skizze,
welche ebenfalls das „Urtheil Salomon's" behandelt. Min-
trop ist in seiner christlichen Auffassnngsweise des Mo-
tivs sehr unglücklich gewesen, ebenso Werner, Elster,
Schultz und Günther. Die Baur'sche Komposition
ist sehr reich, zu reich und mit besonders viel Teufelswerk
beladen. Am wunderlichsten hat Thiel die Sache aufge-
faßt, indem er eine Säulenhalle darstellt, worin die Figur
des „Justizia", als Bildwerk auf einen, Postamente,
über die Großen der Erde, darunter auch etliche römische
Kaiser, Napoleon, Friedrich II. u. s. f. öffentlich Gericht hält,
während symbolische Kinder mit Spruchzetteln am Boden
spielen. — Officiell ist uns der glückliche Gewinner des