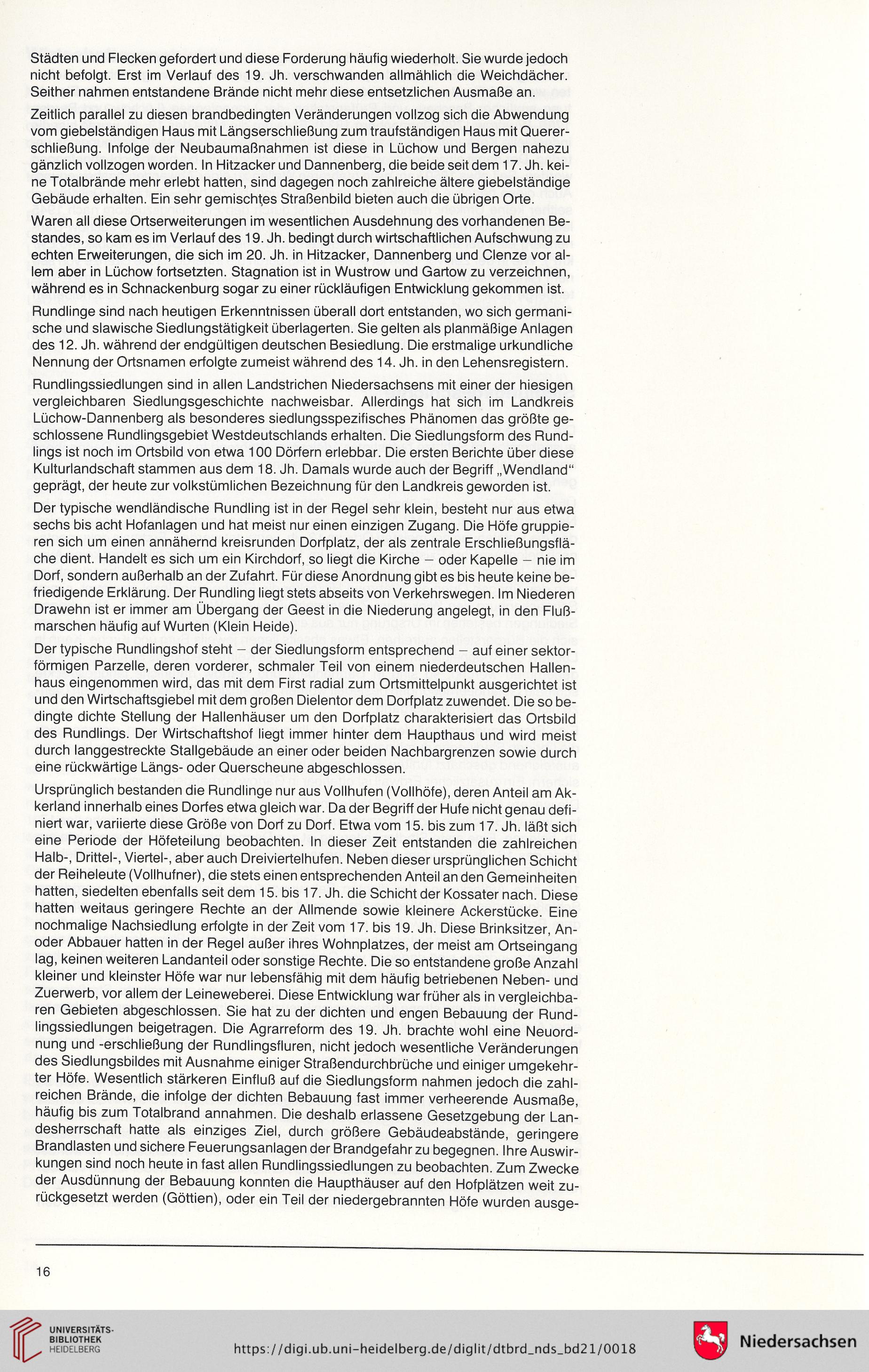Städten und Flecken gefordert und diese Forderung häufig wiederholt. Sie wurde jedoch
nicht befolgt. Erst im Verlauf des 19. Jh. verschwanden allmählich die Weichdächer.
Seither nahmen entstandene Brände nicht mehr diese entsetzlichen Ausmaße an.
Zeitlich parallel zu diesen brandbedingten Veränderungen vollzog sich die Abwendung
vom giebelständigen Haus mit Längserschließung zum traufständigen Haus mit Querer-
schließung. Infolge der Neubaumaßnahmen ist diese in Lüchow und Bergen nahezu
gänzlich vollzogen worden. In Hitzacker und Dannenberg, die beide seit dem 17. Jh. kei-
ne Totalbrände mehr erlebt hatten, sind dagegen noch zahlreiche ältere giebelständige
Gebäude erhalten. Ein sehr gemischtes Straßenbild bieten auch die übrigen Orte.
Waren all diese Ortserweiterungen im wesentlichen Ausdehnung des vorhandenen Be-
standes, so kam es im Verlauf des 19. Jh. bedingt durch wirtschaftlichen Aufschwung zu
echten Erweiterungen, die sich im 20. Jh. in Hitzacker, Dannenberg und Clenze vor al-
lem aber in Lüchow fortsetzten. Stagnation ist in Wustrow und Gartow zu verzeichnen,
während es in Schnackenburg sogar zu einer rückläufigen Entwicklung gekommen ist.
Rundlinge sind nach heutigen Erkenntnissen überall dort entstanden, wo sich germani-
sche und slawische Siedlungstätigkeit überlagerten. Sie gelten als planmäßige Anlagen
des 12. Jh. während der endgültigen deutschen Besiedlung. Die erstmalige urkundliche
Nennung der Ortsnamen erfolgte zumeist während des 14. Jh. in den Lehensregistern.
Rundlingssiedlungen sind in allen Landstrichen Niedersachsens mit einer der hiesigen
vergleichbaren Siedlungsgeschichte nachweisbar. Allerdings hat sich im Landkreis
Lüchow-Dannenberg als besonderes siedlungsspezifisches Phänomen das größte ge-
schlossene Rundlingsgebiet Westdeutschlands erhalten. Die Siedlungsform des Rund-
lings ist noch im Ortsbild von etwa 100 Dörfern erlebbar. Die ersten Berichte über diese
Kulturlandschaft stammen aus dem 18. Jh. Damals wurde auch der Begriff „Wendland“
geprägt, der heute zur volkstümlichen Bezeichnung für den Landkreis geworden ist.
Der typische wendländische Rundling ist in der Regel sehr klein, besteht nur aus etwa
sechs bis acht Hofanlagen und hat meist nur einen einzigen Zugang. Die Höfe gruppie-
ren sich um einen annähernd kreisrunden Dorfplatz, der als zentrale Erschließungsflä-
che dient. Handelt es sich um ein Kirchdorf, so liegt die Kirche - oder Kapelle - nie im
Dorf, sondern außerhalb an der Zufahrt. Für diese Anordnung gibt es bis heute keine be-
friedigende Erklärung. Der Rundling liegt stets abseits von Verkehrswegen. Im Niederen
Drawehn ist er immer am Übergang der Geest in die Niederung angelegt, in den Fluß-
marschen häufig auf Würfen (Klein Heide).
Der typische Rundlingshof steht - der Siedlungsform entsprechend - auf einer sektor-
förmigen Parzelle, deren vorderer, schmaler Teil von einem niederdeutschen Hallen-
haus eingenommen wird, das mit dem First radial zum Ortsmittelpunkt ausgerichtet ist
und den Wirtschaftsgiebel mit dem großen Dielentor dem Dorfplatz zuwendet. Die so be-
dingte dichte Stellung der Hallenhäuser um den Dorfplatz charakterisiert das Ortsbild
des Rundlings. Der Wirtschaftshof liegt immer hinter dem Haupthaus und wird meist
durch langgestreckte Stallgebäude an einer oder beiden Nachbargrenzen sowie durch
eine rückwärtige Längs- oder Querscheune abgeschlossen.
Ursprünglich bestanden die Rundlinge nur aus Vollhufen (Vollhöfe), deren Anteil am Ak-
kerland innerhalb eines Dorfes etwa gleich war. Da der Begriff der Hufe nicht genau defi-
niert war, variierte diese Größe von Dorf zu Dorf. Etwa vom 15. bis zum 17. Jh. läßt sich
eine Periode der Höfeteilung beobachten. In dieser Zeit entstanden die zahlreichen
Halb-, Drittel-, Viertel-, aber auch Dreiviertelhufen. Neben dieser ursprünglichen Schicht
der Reiheleute (Vollhufner), die stets einen entsprechenden Anteil an den Gemeinheiten
hatten, siedelten ebenfalls seit dem 15. bis 17. Jh. die Schicht der Kossater nach. Diese
hatten weitaus geringere Rechte an der Allmende sowie kleinere Ackerstücke. Eine
nochmalige Nachsiedlung erfolgte in der Zeit vom 17. bis 19. Jh. Diese Brinksitzer, An-
oder Abbauer hatten in der Regel außer ihres Wohnplatzes, der meist am Ortseingang
lag, keinen weiteren Landanteil oder sonstige Rechte. Die so entstandene große Anzahl
kleiner und kleinster Höfe war nur lebensfähig mit dem häufig betriebenen Neben- und
Zuerwerb, vor allem der Leineweberei. Diese Entwicklung war früher als in vergleichba-
ren Gebieten abgeschlossen. Sie hat zu der dichten und engen Bebauung der Rund-
lingssiedlungen beigetragen. Die Agrarreform des 19. Jh. brachte wohl eine Neuord-
nung und -erschließung der Rundlingsfluren, nicht jedoch wesentliche Veränderungen
des Siedlungsbildes mit Ausnahme einiger Straßendurchbrüche und einiger umgekehr-
ter Höfe. Wesentlich stärkeren Einfluß auf die Siedlungsform nahmen jedoch die zahl-
reichen Brände, die infolge der dichten Bebauung fast immer verheerende Ausmaße,
häufig bis zum Totalbrand annahmen. Die deshalb erlassene Gesetzgebung der Lan-
desherrschaft hatte als einziges Ziel, durch größere Gebäudeabstände, geringere
Brandlasten und sichere Feuerungsanlagen der Brandgefahr zu begegnen. Ihre Auswir-
kungen sind noch heute in fast allen Rundlingssiedlungen zu beobachten. Zum Zwecke
der Ausdünnung der Bebauung konnten die Haupthäuser auf den Hofplätzen weit zu-
rückgesetzt werden (Göttien), oder ein Teil der niedergebrannten Höfe wurden ausge-
16
nicht befolgt. Erst im Verlauf des 19. Jh. verschwanden allmählich die Weichdächer.
Seither nahmen entstandene Brände nicht mehr diese entsetzlichen Ausmaße an.
Zeitlich parallel zu diesen brandbedingten Veränderungen vollzog sich die Abwendung
vom giebelständigen Haus mit Längserschließung zum traufständigen Haus mit Querer-
schließung. Infolge der Neubaumaßnahmen ist diese in Lüchow und Bergen nahezu
gänzlich vollzogen worden. In Hitzacker und Dannenberg, die beide seit dem 17. Jh. kei-
ne Totalbrände mehr erlebt hatten, sind dagegen noch zahlreiche ältere giebelständige
Gebäude erhalten. Ein sehr gemischtes Straßenbild bieten auch die übrigen Orte.
Waren all diese Ortserweiterungen im wesentlichen Ausdehnung des vorhandenen Be-
standes, so kam es im Verlauf des 19. Jh. bedingt durch wirtschaftlichen Aufschwung zu
echten Erweiterungen, die sich im 20. Jh. in Hitzacker, Dannenberg und Clenze vor al-
lem aber in Lüchow fortsetzten. Stagnation ist in Wustrow und Gartow zu verzeichnen,
während es in Schnackenburg sogar zu einer rückläufigen Entwicklung gekommen ist.
Rundlinge sind nach heutigen Erkenntnissen überall dort entstanden, wo sich germani-
sche und slawische Siedlungstätigkeit überlagerten. Sie gelten als planmäßige Anlagen
des 12. Jh. während der endgültigen deutschen Besiedlung. Die erstmalige urkundliche
Nennung der Ortsnamen erfolgte zumeist während des 14. Jh. in den Lehensregistern.
Rundlingssiedlungen sind in allen Landstrichen Niedersachsens mit einer der hiesigen
vergleichbaren Siedlungsgeschichte nachweisbar. Allerdings hat sich im Landkreis
Lüchow-Dannenberg als besonderes siedlungsspezifisches Phänomen das größte ge-
schlossene Rundlingsgebiet Westdeutschlands erhalten. Die Siedlungsform des Rund-
lings ist noch im Ortsbild von etwa 100 Dörfern erlebbar. Die ersten Berichte über diese
Kulturlandschaft stammen aus dem 18. Jh. Damals wurde auch der Begriff „Wendland“
geprägt, der heute zur volkstümlichen Bezeichnung für den Landkreis geworden ist.
Der typische wendländische Rundling ist in der Regel sehr klein, besteht nur aus etwa
sechs bis acht Hofanlagen und hat meist nur einen einzigen Zugang. Die Höfe gruppie-
ren sich um einen annähernd kreisrunden Dorfplatz, der als zentrale Erschließungsflä-
che dient. Handelt es sich um ein Kirchdorf, so liegt die Kirche - oder Kapelle - nie im
Dorf, sondern außerhalb an der Zufahrt. Für diese Anordnung gibt es bis heute keine be-
friedigende Erklärung. Der Rundling liegt stets abseits von Verkehrswegen. Im Niederen
Drawehn ist er immer am Übergang der Geest in die Niederung angelegt, in den Fluß-
marschen häufig auf Würfen (Klein Heide).
Der typische Rundlingshof steht - der Siedlungsform entsprechend - auf einer sektor-
förmigen Parzelle, deren vorderer, schmaler Teil von einem niederdeutschen Hallen-
haus eingenommen wird, das mit dem First radial zum Ortsmittelpunkt ausgerichtet ist
und den Wirtschaftsgiebel mit dem großen Dielentor dem Dorfplatz zuwendet. Die so be-
dingte dichte Stellung der Hallenhäuser um den Dorfplatz charakterisiert das Ortsbild
des Rundlings. Der Wirtschaftshof liegt immer hinter dem Haupthaus und wird meist
durch langgestreckte Stallgebäude an einer oder beiden Nachbargrenzen sowie durch
eine rückwärtige Längs- oder Querscheune abgeschlossen.
Ursprünglich bestanden die Rundlinge nur aus Vollhufen (Vollhöfe), deren Anteil am Ak-
kerland innerhalb eines Dorfes etwa gleich war. Da der Begriff der Hufe nicht genau defi-
niert war, variierte diese Größe von Dorf zu Dorf. Etwa vom 15. bis zum 17. Jh. läßt sich
eine Periode der Höfeteilung beobachten. In dieser Zeit entstanden die zahlreichen
Halb-, Drittel-, Viertel-, aber auch Dreiviertelhufen. Neben dieser ursprünglichen Schicht
der Reiheleute (Vollhufner), die stets einen entsprechenden Anteil an den Gemeinheiten
hatten, siedelten ebenfalls seit dem 15. bis 17. Jh. die Schicht der Kossater nach. Diese
hatten weitaus geringere Rechte an der Allmende sowie kleinere Ackerstücke. Eine
nochmalige Nachsiedlung erfolgte in der Zeit vom 17. bis 19. Jh. Diese Brinksitzer, An-
oder Abbauer hatten in der Regel außer ihres Wohnplatzes, der meist am Ortseingang
lag, keinen weiteren Landanteil oder sonstige Rechte. Die so entstandene große Anzahl
kleiner und kleinster Höfe war nur lebensfähig mit dem häufig betriebenen Neben- und
Zuerwerb, vor allem der Leineweberei. Diese Entwicklung war früher als in vergleichba-
ren Gebieten abgeschlossen. Sie hat zu der dichten und engen Bebauung der Rund-
lingssiedlungen beigetragen. Die Agrarreform des 19. Jh. brachte wohl eine Neuord-
nung und -erschließung der Rundlingsfluren, nicht jedoch wesentliche Veränderungen
des Siedlungsbildes mit Ausnahme einiger Straßendurchbrüche und einiger umgekehr-
ter Höfe. Wesentlich stärkeren Einfluß auf die Siedlungsform nahmen jedoch die zahl-
reichen Brände, die infolge der dichten Bebauung fast immer verheerende Ausmaße,
häufig bis zum Totalbrand annahmen. Die deshalb erlassene Gesetzgebung der Lan-
desherrschaft hatte als einziges Ziel, durch größere Gebäudeabstände, geringere
Brandlasten und sichere Feuerungsanlagen der Brandgefahr zu begegnen. Ihre Auswir-
kungen sind noch heute in fast allen Rundlingssiedlungen zu beobachten. Zum Zwecke
der Ausdünnung der Bebauung konnten die Haupthäuser auf den Hofplätzen weit zu-
rückgesetzt werden (Göttien), oder ein Teil der niedergebrannten Höfe wurden ausge-
16